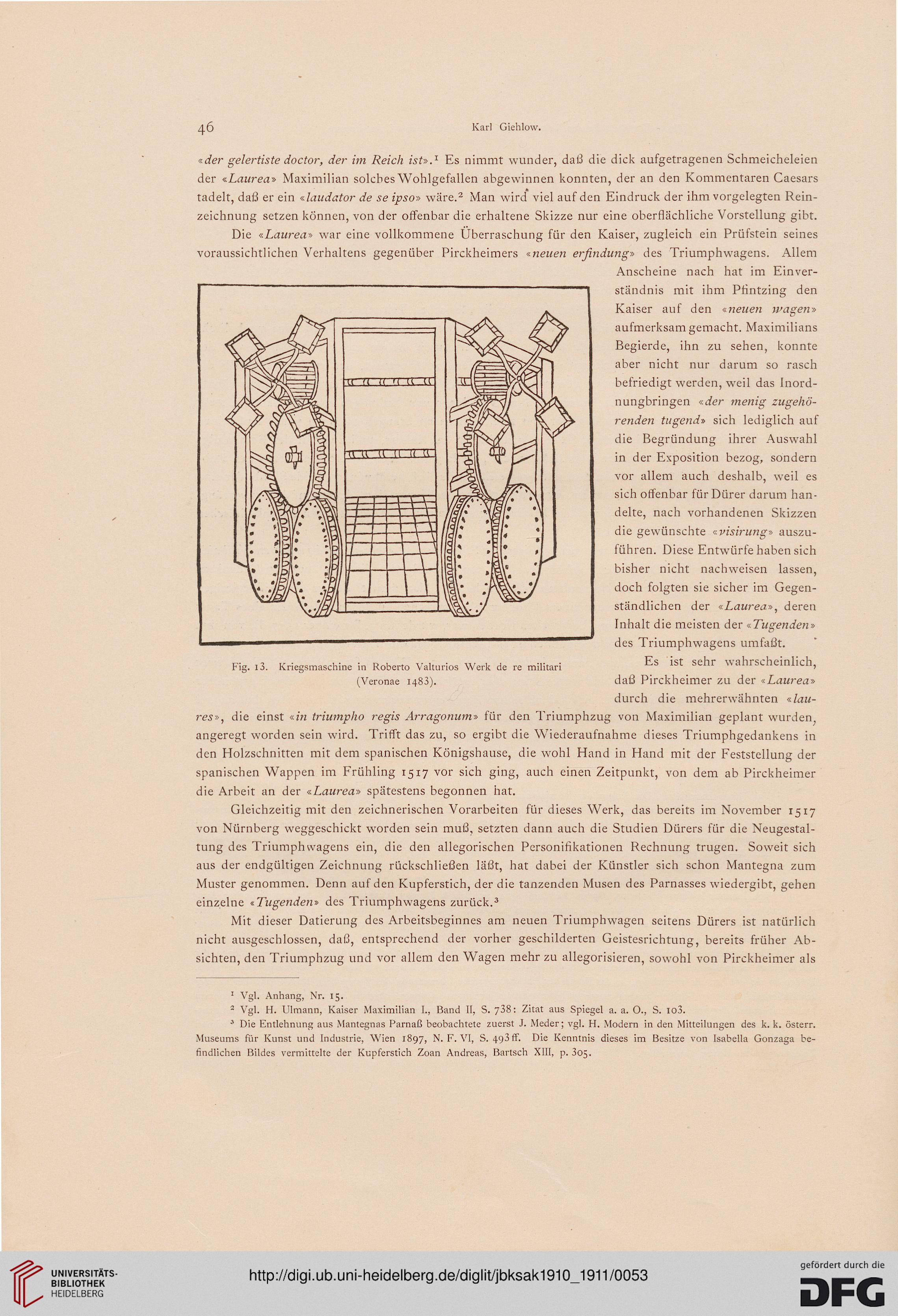46
Karl Giehlow.
«der gelertiste doctor, der im Reich ist».1 Es nimmt wunder, dai3 die dick aufgetragenen Schmeicheleien
der «Laurea» Maximilian solches Wohlgefallen abgewinnen konnten, der an den Kommentaren Caesars
tadelt, daß er ein «laudator de se ipso» wäre.2 Man wird viel auf den Eindruck der ihm vorgelegten Rein-
zeichnung setzen können, von der offenbar die erhaltene Skizze nur eine oberflächliche Vorstellung gibt.
Die «Laurea» war eine vollkommene Überraschung für den Kaiser, zugleich ein Prüfstein seines
voraussichtlichen Verhaltens gegenüber Pirckheimers «neuen erfindung» des Triumphwagens. Allem
Anscheine nach hat im Einver-
ständnis mit ihm Pfintzing den
Kaiser auf den «neuen wagen»
aufmerksam gemacht. Maximilians
Begierde, ihn zu sehen, konnte
aber nicht nur darum so rasch
befriedigt werden, weil das Inord-
nungbringen «der menig zugehö-
renden tilgend* sich lediglich auf
die Begründung ihrer Auswahl
in der Exposition bezog, sondern
vor allem auch deshalb, weil es
sich offenbar für Dürer darum han-
delte, nach vorhandenen Skizzen
die gewünschte «visirung* auszu-
führen. Diese Entwürfe haben sich
bisher nicht nachweisen lassen,
doch folgten sie sicher im Gegen-
ständlichen der «Laurea», deren
Inhalt die meisten der «Tugenden»
des Triumphwagens umfaßt.
Es ist sehr wahrscheinlich,
daß Pirckheimer zu der «Laurea»
durch die mehrerwähnten «lau-
?~es», die einst «in triumpho regis Arragonum» für den Triumphzug von Maximilian geplant wurden^
angeregt worden sein wird. Trifft das zu, so ergibt die Wiederaufnahme dieses Triumphgedankens in
den Holzschnitten mit dem spanischen Königshause, die wohl Hand in Hand mit der Feststellung der
spanischen Wappen im Frühling 1517 vor sich ging, auch einen Zeitpunkt, von dem ab Pirckheimer
die Arbeit an der «Laurea» spätestens begonnen hat.
Gleichzeitig mit den zeichnerischen Vorarbeiten für dieses Werk, das bereits im November 1517
von Nürnberg weggeschickt worden sein muß, setzten dann auch die Studien Dürers für die Neugestal-
tung des Triumphwagens ein, die den allegorischen Personifikationen Rechnung trugen. Soweit sich
aus der endgültigen Zeichnung rückschließen läßt, hat dabei der Künstler sich schon Mantegna zum
Muster genommen. Denn auf den Kupferstich, der die tanzenden Musen des Parnasses wiedergibt, gehen
einzelne «Tugenden» des Triumphwagens zurück.3
Mit dieser Datierung des Arbeitsbeginnes am neuen Triumphwagen seitens Dürers ist natürlich
nicht ausgeschlossen, daß, entsprechend der vorher geschilderten Geistesrichtung, bereits früher Ab-
sichten, den Triumphzug und vor allem den Wagen mehr zu allegorisieren, sowohl von Pirckheimer als
Fig. l3. Kriegsmaschine in Roberto Valturios Werk de re militari
(Veronae 1483).
1 Vgl. Anhang, Nr. 15.
2 Vgl. H. Ulmann, Kaiser Maximilian L, Band II, S. 738: Zitat aus Spiegel a. a. O., S. io3.
3 Die Entlehnung aus Mantegnas Parnaß beobachtete zuerst J. Meder; vgl. H. Modern in den Mitteilungen des k. k. österr.
Museums für Kunst und Industrie, Wien 1897, N. F. VI, S. 493 ff. Die Kenntnis dieses im Besitze von Isabella Gonzaga be-
findlichen Bildes vermittelte der Kupferstich Zoan Andreas, Bartsch XIII, p. 305.
Karl Giehlow.
«der gelertiste doctor, der im Reich ist».1 Es nimmt wunder, dai3 die dick aufgetragenen Schmeicheleien
der «Laurea» Maximilian solches Wohlgefallen abgewinnen konnten, der an den Kommentaren Caesars
tadelt, daß er ein «laudator de se ipso» wäre.2 Man wird viel auf den Eindruck der ihm vorgelegten Rein-
zeichnung setzen können, von der offenbar die erhaltene Skizze nur eine oberflächliche Vorstellung gibt.
Die «Laurea» war eine vollkommene Überraschung für den Kaiser, zugleich ein Prüfstein seines
voraussichtlichen Verhaltens gegenüber Pirckheimers «neuen erfindung» des Triumphwagens. Allem
Anscheine nach hat im Einver-
ständnis mit ihm Pfintzing den
Kaiser auf den «neuen wagen»
aufmerksam gemacht. Maximilians
Begierde, ihn zu sehen, konnte
aber nicht nur darum so rasch
befriedigt werden, weil das Inord-
nungbringen «der menig zugehö-
renden tilgend* sich lediglich auf
die Begründung ihrer Auswahl
in der Exposition bezog, sondern
vor allem auch deshalb, weil es
sich offenbar für Dürer darum han-
delte, nach vorhandenen Skizzen
die gewünschte «visirung* auszu-
führen. Diese Entwürfe haben sich
bisher nicht nachweisen lassen,
doch folgten sie sicher im Gegen-
ständlichen der «Laurea», deren
Inhalt die meisten der «Tugenden»
des Triumphwagens umfaßt.
Es ist sehr wahrscheinlich,
daß Pirckheimer zu der «Laurea»
durch die mehrerwähnten «lau-
?~es», die einst «in triumpho regis Arragonum» für den Triumphzug von Maximilian geplant wurden^
angeregt worden sein wird. Trifft das zu, so ergibt die Wiederaufnahme dieses Triumphgedankens in
den Holzschnitten mit dem spanischen Königshause, die wohl Hand in Hand mit der Feststellung der
spanischen Wappen im Frühling 1517 vor sich ging, auch einen Zeitpunkt, von dem ab Pirckheimer
die Arbeit an der «Laurea» spätestens begonnen hat.
Gleichzeitig mit den zeichnerischen Vorarbeiten für dieses Werk, das bereits im November 1517
von Nürnberg weggeschickt worden sein muß, setzten dann auch die Studien Dürers für die Neugestal-
tung des Triumphwagens ein, die den allegorischen Personifikationen Rechnung trugen. Soweit sich
aus der endgültigen Zeichnung rückschließen läßt, hat dabei der Künstler sich schon Mantegna zum
Muster genommen. Denn auf den Kupferstich, der die tanzenden Musen des Parnasses wiedergibt, gehen
einzelne «Tugenden» des Triumphwagens zurück.3
Mit dieser Datierung des Arbeitsbeginnes am neuen Triumphwagen seitens Dürers ist natürlich
nicht ausgeschlossen, daß, entsprechend der vorher geschilderten Geistesrichtung, bereits früher Ab-
sichten, den Triumphzug und vor allem den Wagen mehr zu allegorisieren, sowohl von Pirckheimer als
Fig. l3. Kriegsmaschine in Roberto Valturios Werk de re militari
(Veronae 1483).
1 Vgl. Anhang, Nr. 15.
2 Vgl. H. Ulmann, Kaiser Maximilian L, Band II, S. 738: Zitat aus Spiegel a. a. O., S. io3.
3 Die Entlehnung aus Mantegnas Parnaß beobachtete zuerst J. Meder; vgl. H. Modern in den Mitteilungen des k. k. österr.
Museums für Kunst und Industrie, Wien 1897, N. F. VI, S. 493 ff. Die Kenntnis dieses im Besitze von Isabella Gonzaga be-
findlichen Bildes vermittelte der Kupferstich Zoan Andreas, Bartsch XIII, p. 305.