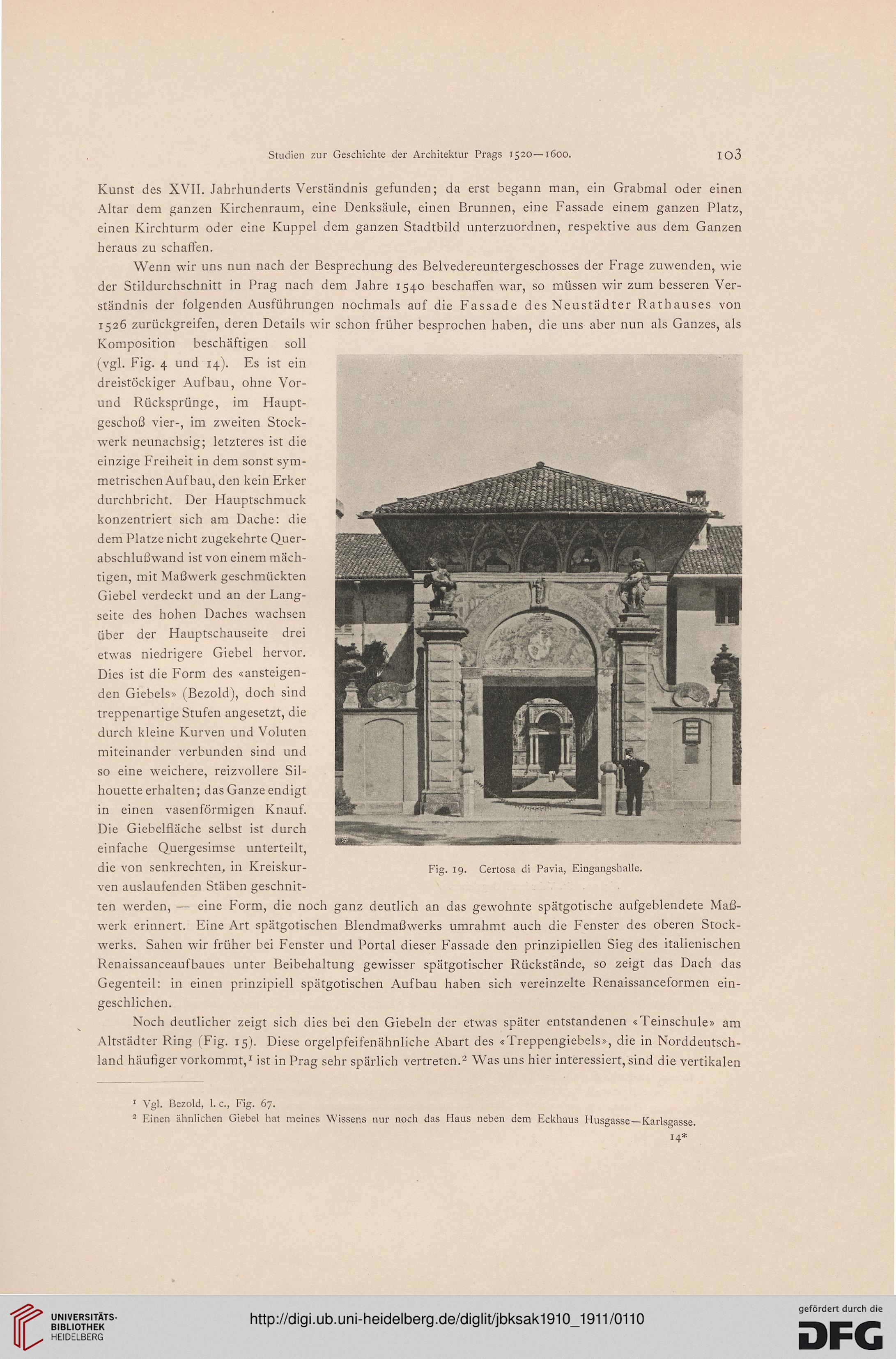Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.
io3
Kunst des XVII. Jahrhunderts Verständnis gefunden; da erst begann man, ein Grabmal oder einen
Altar dem ganzen Kirchenraum, eine Denksäule, einen Brunnen, eine Fassade einem ganzen Platz,
einen Kirchturm oder eine Kuppel dem ganzen Stadtbild unterzuordnen, respektive aus dem Ganzen
heraus zu schaffen.
Wenn wir uns nun nach der Besprechung des Belvedereuntergeschosses der Frage zuwenden, wie
der Stildurchschnitt in Prag nach dem Jahre 1540 beschaffen war, so müssen wir zum besseren Ver-
ständnis der folgenden Ausführungen nochmals auf die Fassade des Neustädter Rathauses von
1526 zurückgreifen, deren Details wir schon früher besprochen haben, die uns aber nun als Ganzes, als
Komposition beschäftigen soll
(vgl. Fig. 4 und 14). Es ist ein
dreistöckiger Aufbau, ohne Vor-
und Rücksprünge, im Haupt-
geschoß vier-, im zweiten Stock-
werk neunachsig; letzteres ist die
einzige Freiheit in dem sonst sym-
metrischen Auf bau, den kein Erker
durchbricht. Der Hauptschmuck
konzentriert sich am Dache: die
dem Platze nicht zugekehrte Quer-
abschlußwand ist von einem mäch-
tigen, mit Maßwerk geschmückten
Giebel verdeckt und an der Lang-
seite des hohen Daches wachsen
über der Hauptschauseite drei
etwas niedrigere Giebel hervor.
Dies ist die Form des «ansteigen-
den Giebels» (Bezold), doch sind
treppenartige Stufen angesetzt, die
durch kleine Kurven und Voluten
miteinander verbunden sind und
so eine weichere, reizvollere Sil-
houette erhalten; das Ganze endigt
in einen vasenförmigen Knauf.
Die Giebelfläche selbst ist durch
einfache Quergesimse unterteilt,
die von senkrechten, in Kreiskur-
ven auslaufenden Stäben geschnit-
ten werden, — eine Form, die noch ganz deutlich an das gewohnte spätgotische aufgeblendete Maß-
werk erinnert. Eine Art spätgotischen Blendmaßwerks umrahmt auch die Fenster des oberen Stock-
werks. Sahen wir früher bei Fenster und Portal dieser Fassade den prinzipiellen Sieg des italienischen
Renaissanceaufbaues unter Beibehaltung gewisser spätgotischer Rückstände, so zeigt das Dach das
Gegenteil: in einen prinzipiell spätgotischen Aufbau haben sich vereinzelte Renaissanceformen ein-
geschlichen.
Noch deutlicher zeigt sich dies bei den Giebeln der etwas später entstandenen «Teinschule» am
Altstädter Ring (Fig. 15). Diese orgelpfeifenähnliche Abart des «Treppengiebels», die in Norddeutsch-
land häufiger vorkommt,1 ist in Prag sehr spärlich vertreten.2 Was uns hier interessiert, sind die vertikalen
Fig. 19. Certosa di Pavia, Eingangshalle.
1 Vgl. Bezold, I.e., Fig. 67.
- Einen ähnlichen Giebel hat meines Wissens nur noch das Haus neben dem Eckhaus Husgasse—
Karlsgasse.
14*
io3
Kunst des XVII. Jahrhunderts Verständnis gefunden; da erst begann man, ein Grabmal oder einen
Altar dem ganzen Kirchenraum, eine Denksäule, einen Brunnen, eine Fassade einem ganzen Platz,
einen Kirchturm oder eine Kuppel dem ganzen Stadtbild unterzuordnen, respektive aus dem Ganzen
heraus zu schaffen.
Wenn wir uns nun nach der Besprechung des Belvedereuntergeschosses der Frage zuwenden, wie
der Stildurchschnitt in Prag nach dem Jahre 1540 beschaffen war, so müssen wir zum besseren Ver-
ständnis der folgenden Ausführungen nochmals auf die Fassade des Neustädter Rathauses von
1526 zurückgreifen, deren Details wir schon früher besprochen haben, die uns aber nun als Ganzes, als
Komposition beschäftigen soll
(vgl. Fig. 4 und 14). Es ist ein
dreistöckiger Aufbau, ohne Vor-
und Rücksprünge, im Haupt-
geschoß vier-, im zweiten Stock-
werk neunachsig; letzteres ist die
einzige Freiheit in dem sonst sym-
metrischen Auf bau, den kein Erker
durchbricht. Der Hauptschmuck
konzentriert sich am Dache: die
dem Platze nicht zugekehrte Quer-
abschlußwand ist von einem mäch-
tigen, mit Maßwerk geschmückten
Giebel verdeckt und an der Lang-
seite des hohen Daches wachsen
über der Hauptschauseite drei
etwas niedrigere Giebel hervor.
Dies ist die Form des «ansteigen-
den Giebels» (Bezold), doch sind
treppenartige Stufen angesetzt, die
durch kleine Kurven und Voluten
miteinander verbunden sind und
so eine weichere, reizvollere Sil-
houette erhalten; das Ganze endigt
in einen vasenförmigen Knauf.
Die Giebelfläche selbst ist durch
einfache Quergesimse unterteilt,
die von senkrechten, in Kreiskur-
ven auslaufenden Stäben geschnit-
ten werden, — eine Form, die noch ganz deutlich an das gewohnte spätgotische aufgeblendete Maß-
werk erinnert. Eine Art spätgotischen Blendmaßwerks umrahmt auch die Fenster des oberen Stock-
werks. Sahen wir früher bei Fenster und Portal dieser Fassade den prinzipiellen Sieg des italienischen
Renaissanceaufbaues unter Beibehaltung gewisser spätgotischer Rückstände, so zeigt das Dach das
Gegenteil: in einen prinzipiell spätgotischen Aufbau haben sich vereinzelte Renaissanceformen ein-
geschlichen.
Noch deutlicher zeigt sich dies bei den Giebeln der etwas später entstandenen «Teinschule» am
Altstädter Ring (Fig. 15). Diese orgelpfeifenähnliche Abart des «Treppengiebels», die in Norddeutsch-
land häufiger vorkommt,1 ist in Prag sehr spärlich vertreten.2 Was uns hier interessiert, sind die vertikalen
Fig. 19. Certosa di Pavia, Eingangshalle.
1 Vgl. Bezold, I.e., Fig. 67.
- Einen ähnlichen Giebel hat meines Wissens nur noch das Haus neben dem Eckhaus Husgasse—
Karlsgasse.
14*