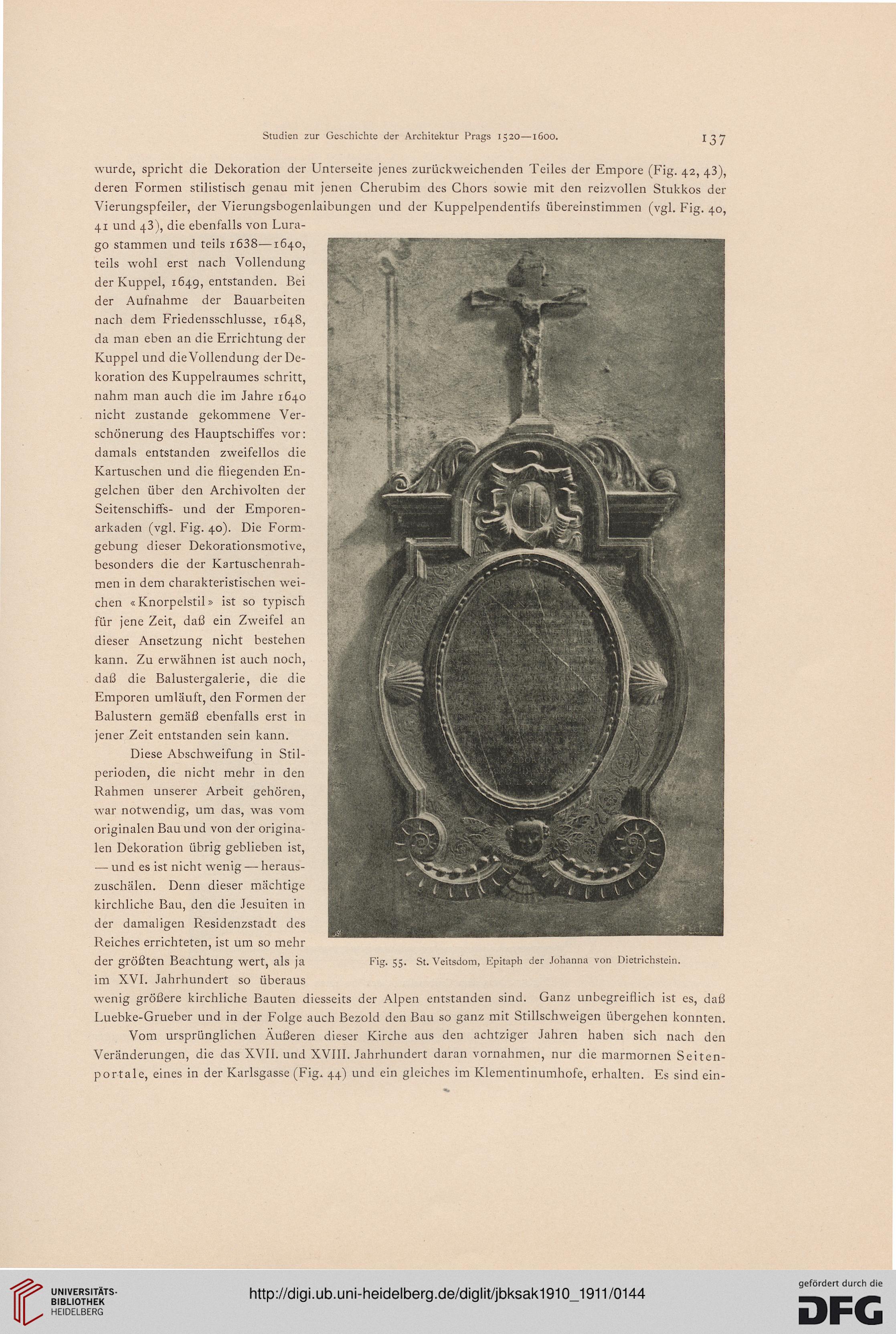Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.
137
wurde, spricht die Dekoration der Unterseite jenes zurückweichenden Teiles der Empore (Fig. 42, 43),
deren Formen stilistisch genau mit jenen Cherubim des Chors sowie mit den reizvollen Stukkos der
Vierungspfeiler, der Vierungsbogenlaibungen und der Kuppelpendentifs übereinstimmen (vgl. Fig. 40,
41 und 43), die ebenfalls von Lura-
go stammen und teils i638—1640,
teils wohl erst nach Vollendung
der Kuppel, 1649, entstanden. Bei
der Aufnahme der Bauarbeiten
nach dem Friedensschlüsse, 1648,
da man eben an die Errichtung der
Kuppel und die Vollendung der De-
koration des Kuppelraumes schritt,
nahm man auch die im Jahre 1640
nicht zustande gekommene Ver-
schönerung des Hauptschiffes vor:
damals entstanden zweifellos die
Kartuschen und die fliegenden En-
gelchen über den Archivolten der
Seitenschiffs- und der Emporen-
arkaden (vgl. Fig. 40). Die Form-
gebung dieser Dekorationsmotive,
besonders die der Kartuschenrah-
men in dem charakteristischen wei-
chen «Knorpelstil» ist so typisch
für jene Zeit, daß ein Zweifel an
dieser Ansetzung nicht bestehen
kann. Zu erwähnen ist auch noch,
daß die Balustergalerie, die die
Emporen umläuft, den Formen der
Balustern gemäß ebenfalls erst in
jener Zeit entstanden sein kann.
Diese Abschweifung in Stil-
perioden, die nicht mehr in den
Rahmen unserer Arbeit gehören,
wrar notwendig, um das, was vom
originalen Bau und von der origina-
len Dekoration übrig geblieben ist,
— und es ist nicht wenig — heraus-
zuschälen. Denn dieser mächtige
kirchliche Bau, den die Jesuiten in
der damaligen Residenzstadt des
Reiches errichteten, ist um so mehr
der größten Beachtung wert, als ja
im XVI. Jahrhundert so überaus
wenig größere kirchliche Bauten diesseits der Alpen entstanden sind. Ganz unbegreiflich ist es, daß
Luebke-Grueber und in der Folge auch Bezold den Bau so ganz mit Stillschweigen übergehen konnten.
Vom ursprünglichen Äußeren dieser Kirche aus den achtziger Jahren haben sich nach den
Veränderungen, die das XVII. und XVIII. Jahrhundert daran vornahmen, nur die marmornen Seiten-
portale, eines in der Karlsgasse (Fig. 44) und ein gleiches im Klementinumhofe, erhalten. Es sind ein-
Fig. 55. St. Veitsdom, Epitaph der Johanna von Dietrichstein.
137
wurde, spricht die Dekoration der Unterseite jenes zurückweichenden Teiles der Empore (Fig. 42, 43),
deren Formen stilistisch genau mit jenen Cherubim des Chors sowie mit den reizvollen Stukkos der
Vierungspfeiler, der Vierungsbogenlaibungen und der Kuppelpendentifs übereinstimmen (vgl. Fig. 40,
41 und 43), die ebenfalls von Lura-
go stammen und teils i638—1640,
teils wohl erst nach Vollendung
der Kuppel, 1649, entstanden. Bei
der Aufnahme der Bauarbeiten
nach dem Friedensschlüsse, 1648,
da man eben an die Errichtung der
Kuppel und die Vollendung der De-
koration des Kuppelraumes schritt,
nahm man auch die im Jahre 1640
nicht zustande gekommene Ver-
schönerung des Hauptschiffes vor:
damals entstanden zweifellos die
Kartuschen und die fliegenden En-
gelchen über den Archivolten der
Seitenschiffs- und der Emporen-
arkaden (vgl. Fig. 40). Die Form-
gebung dieser Dekorationsmotive,
besonders die der Kartuschenrah-
men in dem charakteristischen wei-
chen «Knorpelstil» ist so typisch
für jene Zeit, daß ein Zweifel an
dieser Ansetzung nicht bestehen
kann. Zu erwähnen ist auch noch,
daß die Balustergalerie, die die
Emporen umläuft, den Formen der
Balustern gemäß ebenfalls erst in
jener Zeit entstanden sein kann.
Diese Abschweifung in Stil-
perioden, die nicht mehr in den
Rahmen unserer Arbeit gehören,
wrar notwendig, um das, was vom
originalen Bau und von der origina-
len Dekoration übrig geblieben ist,
— und es ist nicht wenig — heraus-
zuschälen. Denn dieser mächtige
kirchliche Bau, den die Jesuiten in
der damaligen Residenzstadt des
Reiches errichteten, ist um so mehr
der größten Beachtung wert, als ja
im XVI. Jahrhundert so überaus
wenig größere kirchliche Bauten diesseits der Alpen entstanden sind. Ganz unbegreiflich ist es, daß
Luebke-Grueber und in der Folge auch Bezold den Bau so ganz mit Stillschweigen übergehen konnten.
Vom ursprünglichen Äußeren dieser Kirche aus den achtziger Jahren haben sich nach den
Veränderungen, die das XVII. und XVIII. Jahrhundert daran vornahmen, nur die marmornen Seiten-
portale, eines in der Karlsgasse (Fig. 44) und ein gleiches im Klementinumhofe, erhalten. Es sind ein-
Fig. 55. St. Veitsdom, Epitaph der Johanna von Dietrichstein.