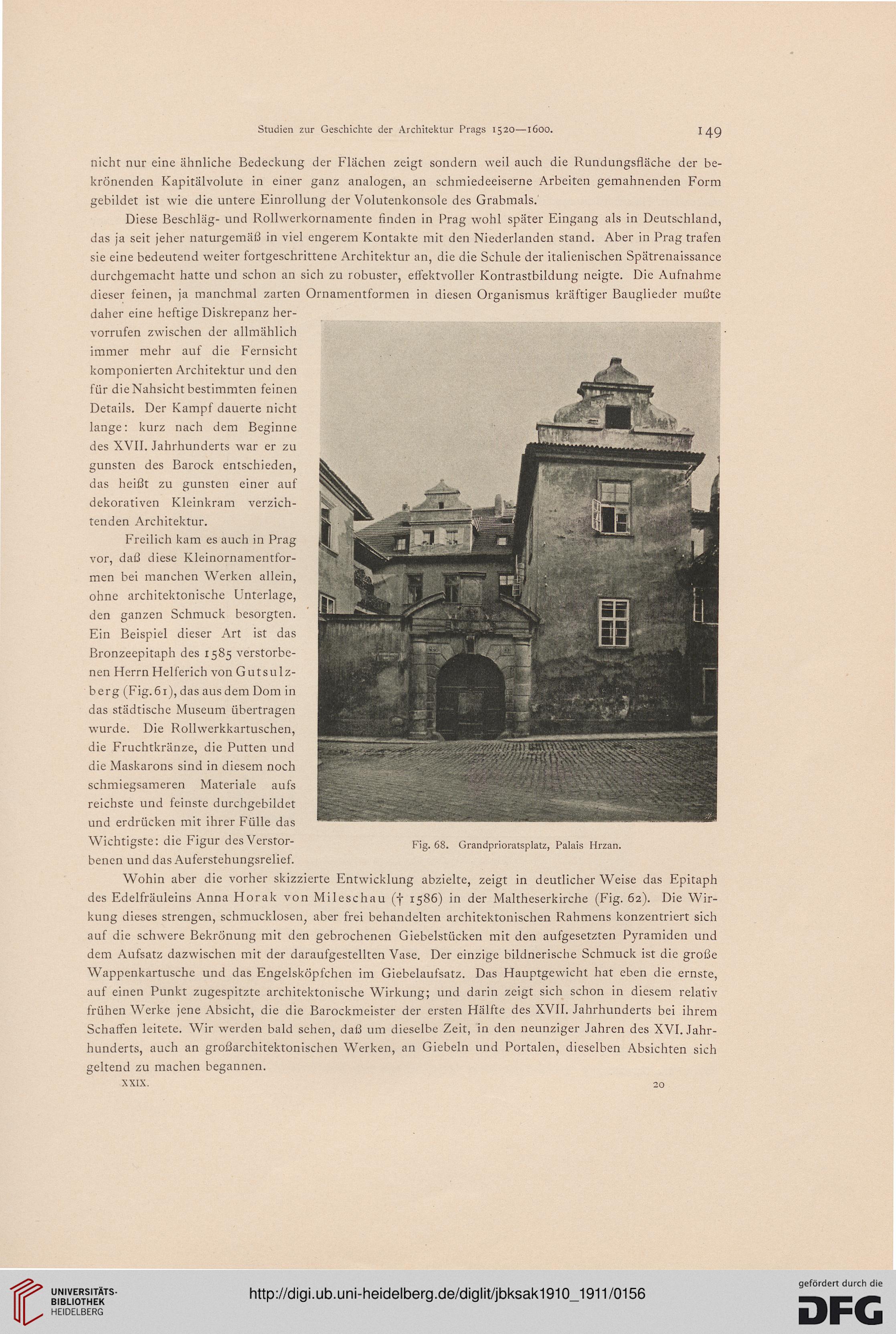Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.
149
nicht nur eine ähnliche Bedeckung der Flächen zeigt sondern weil auch die Rundungsfläche der be-
krönenden Kapitälvolute in einer ganz analogen, an schmiedeeiserne Arbeiten gemahnenden Form
gebildet ist wie die untere Einrollung der Volutenkonsole des Grabmals.'
Diese Beschlag- und Rollwerkornamente finden in Prag wohl später Eingang als in Deutschland,
das ja seit jeher naturgemäß in viel engerem Kontakte mit den Niederlanden stand. Aber in Prag trafen
sie eine bedeutend weiter fortgeschrittene Architektur an, die die Schule der italienischen Spätrenaissance
durchgemacht hatte und schon an sich zu robuster, effektvoller Kontrastbildung neigte. Die Aufnahme
dieser feinen, ja manchmal zarten Ornamentformen in diesen Organismus kräftiger Bauglieder mußte
daher eine heftige Diskrepanz her-
vorrufen zwischen der allmählich
immer mehr auf die Fernsicht
komponierten Architektur und den
für die Nahsicht bestimmten feinen
Details. Der Kampf dauerte nicht
lange: kurz nach dem Beginne
des XVII. Jahrhunderts war er zu
gunsten des Barock entschieden,
das heißt zu gunsten einer auf
dekorativen Kleinkram verzich-
tenden Architektur.
Freilich kam es auch in Prag
vor, daß diese Kleinornamentfor-
men bei manchen Werken allein,
ohne architektonische Unterlage,
den ganzen Schmuck besorgten.
Ein Beispiel dieser Art ist das
Bronzeepitaph des 1585 verstorbe-
nen Herrn Helferich von Gutsulz-
berg (Fig. 61), das aus dem Dom in
das städtische Museum übertragen
wurde. Die Rollwerkkartuschen,
die Fruchtkränze, die Putten und
die Maskarons sind in diesem noch
schmiegsameren Materiale aufs
reichste und feinste durchgebildet
und erdrücken mit ihrer Fülle das
Wichtigste: die Figur des Verstor- Fig_ 6g. Grandprioratsplatz, Palais Hrzan.
benen und das Auferstehungsrelief.
Wohin aber die vorher skizzierte Entwicklung abzielte, zeigt in deutlicher Weise das Epitaph
des Edelfräuleins Anna Horak von Mileschau (f 1586) in der Maltheserkirche (Fig. 62). Die Wir-
kung dieses strengen, schmucklosen, aber frei behandelten architektonischen Rahmens konzentriert sich
auf die schwere Bekrönung mit den gebrochenen Giebelstücken mit den aufgesetzten Pyramiden und
dem Aufsatz dazwischen mit der daraufgestellten Vase. Der einzige bildnerische Schmuck ist die große
Wappenkartusche und das Engelsköpfchen im Giebelaufsatz. Das Hauptgewicht hat eben die ernste,
auf einen Punkt zugespitzte architektonische Wirkung; und darin zeigt sich schon in diesem relativ
frühen Werke jene Absicht, die die Barockmeister der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bei ihrem
Schaffen leitete. Wir werden bald sehen, daß um dieselbe Zeit, in den neunziger Jahren des XVI. Jahr-
hunderts, auch an großarchitektonischen Werken, an Giebeln und Portalen, dieselben Absichten sich
geltend zu machen begannen.
xxix. 20
149
nicht nur eine ähnliche Bedeckung der Flächen zeigt sondern weil auch die Rundungsfläche der be-
krönenden Kapitälvolute in einer ganz analogen, an schmiedeeiserne Arbeiten gemahnenden Form
gebildet ist wie die untere Einrollung der Volutenkonsole des Grabmals.'
Diese Beschlag- und Rollwerkornamente finden in Prag wohl später Eingang als in Deutschland,
das ja seit jeher naturgemäß in viel engerem Kontakte mit den Niederlanden stand. Aber in Prag trafen
sie eine bedeutend weiter fortgeschrittene Architektur an, die die Schule der italienischen Spätrenaissance
durchgemacht hatte und schon an sich zu robuster, effektvoller Kontrastbildung neigte. Die Aufnahme
dieser feinen, ja manchmal zarten Ornamentformen in diesen Organismus kräftiger Bauglieder mußte
daher eine heftige Diskrepanz her-
vorrufen zwischen der allmählich
immer mehr auf die Fernsicht
komponierten Architektur und den
für die Nahsicht bestimmten feinen
Details. Der Kampf dauerte nicht
lange: kurz nach dem Beginne
des XVII. Jahrhunderts war er zu
gunsten des Barock entschieden,
das heißt zu gunsten einer auf
dekorativen Kleinkram verzich-
tenden Architektur.
Freilich kam es auch in Prag
vor, daß diese Kleinornamentfor-
men bei manchen Werken allein,
ohne architektonische Unterlage,
den ganzen Schmuck besorgten.
Ein Beispiel dieser Art ist das
Bronzeepitaph des 1585 verstorbe-
nen Herrn Helferich von Gutsulz-
berg (Fig. 61), das aus dem Dom in
das städtische Museum übertragen
wurde. Die Rollwerkkartuschen,
die Fruchtkränze, die Putten und
die Maskarons sind in diesem noch
schmiegsameren Materiale aufs
reichste und feinste durchgebildet
und erdrücken mit ihrer Fülle das
Wichtigste: die Figur des Verstor- Fig_ 6g. Grandprioratsplatz, Palais Hrzan.
benen und das Auferstehungsrelief.
Wohin aber die vorher skizzierte Entwicklung abzielte, zeigt in deutlicher Weise das Epitaph
des Edelfräuleins Anna Horak von Mileschau (f 1586) in der Maltheserkirche (Fig. 62). Die Wir-
kung dieses strengen, schmucklosen, aber frei behandelten architektonischen Rahmens konzentriert sich
auf die schwere Bekrönung mit den gebrochenen Giebelstücken mit den aufgesetzten Pyramiden und
dem Aufsatz dazwischen mit der daraufgestellten Vase. Der einzige bildnerische Schmuck ist die große
Wappenkartusche und das Engelsköpfchen im Giebelaufsatz. Das Hauptgewicht hat eben die ernste,
auf einen Punkt zugespitzte architektonische Wirkung; und darin zeigt sich schon in diesem relativ
frühen Werke jene Absicht, die die Barockmeister der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bei ihrem
Schaffen leitete. Wir werden bald sehen, daß um dieselbe Zeit, in den neunziger Jahren des XVI. Jahr-
hunderts, auch an großarchitektonischen Werken, an Giebeln und Portalen, dieselben Absichten sich
geltend zu machen begannen.
xxix. 20