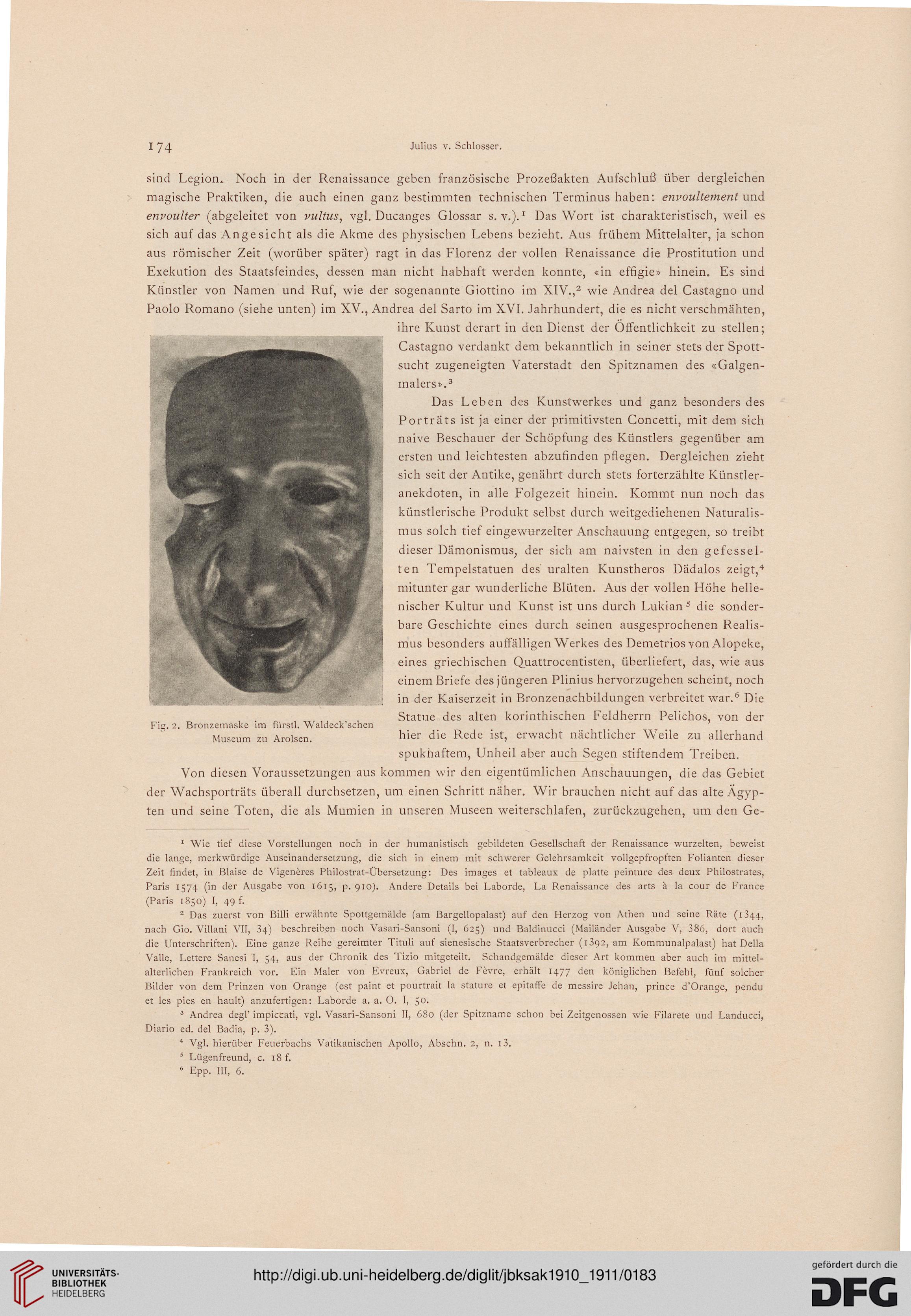174
Julius v. Schlosser.
sind Legion. Noch in der Renaissance geben französische Prozeßakten Aufschluß über dergleichen
magische Praktiken, die auch einen ganz bestimmten technischen Terminus haben: envoultement und
envoulter (abgeleitet von vultus, vgl. Ducanges Glossar s.v.).1 Das Wort ist charakteristisch, weil es
sich auf das Angesicht als die Akme des physischen Lebens bezieht. Aus frühem Mittelalter, ja schon
aus römischer Zeit (worüber später) ragt in das Florenz der vollen Renaissance die Prostitution und
Exekution des Staatsfeindes, dessen man nicht habhaft werden konnte, «in effigie» hinein. Es sind
Künstler von Namen und Ruf, wie der sogenannte Giottino im XIV.,2 wie Andrea del Castagno und
Paolo Romano (siehe unten) im XV., Andrea del Sarto im XVI. Jahrhundert, die es nicht verschmähten,
ihre Kunst derart in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen;
Castagno verdankt dem bekanntlich in seiner stets der Spott-
sucht zugeneigten Vaterstadt den Spitznamen des «Galgen-
malerst>.3
Das Leben des Kunstwerkes und ganz besonders des
Porträts ist ja einer der primitivsten Concetti, mit dem sich
naive Beschauer der Schöpfung des Künstlers gegenüber am
ersten und leichtesten abzufinden pflegen. Dergleichen zieht
sich seit der Antike, genährt durch stets forterzählte Künstler-
anekdoten, in alle Folgezeit hinein. Kommt nun noch das
künstlerische Produkt selbst durch weitgediehenen Naturalis-
mus solch tief eingewurzelter Anschauung entgegen, so treibt
dieser Dämonismus, der sich am naivsten in den gefessel-
ten Tempelstatuen des' uralten Kunstheros Dädalos zeigt,4
mitunter gar wunderliche Blüten. Aus der vollen Höhe helle-
nischer Kultur und Kunst ist uns durch Lukian5 die sonder-
bare Geschichte eines durch seinen ausgesprochenen Realis-
mus besonders auffälligen Werkes des Demetriosvon Alopeke,
eines griechischen Quattrocentisten, überliefert, das, wie aus
einem Briefe des jüngeren Plinius hervorzugehen scheint, noch
in der Kaiserzeit in Bronzenachbildungen verbreitet war.6 Die
Statue des alten korinthischen Feldherrn Pelichos, von der
Fig. 2. Bronzemaske im fiirstl. Waldeck'schen
Museum zu Arolsen. mer die Rede ist, erwacht nächtlicher Weile zu allerhand
spukhaftem, Unheil aber auch Segen stiftendem Treiben.
Von diesen Voraussetzungen aus kommen wir den eigentümlichen Anschauungen, die das Gebiet
der Wachsporträts überall durchsetzen, um einen Schritt näher. Wir brauchen nicht auf das alte Ägyp-
ten und seine Toten, die als Mumien in unseren Museen weiterschlafen, zurückzugehen, um den Ge-
1 Wie tief diese Vorstellungen noch in der humanistisch gebildeten Gesellschaft der Renaissance wurzelten, beweist
die lange, merkwürdige Auseinandersetzung, die sich in einem mit schwerer Gelehrsamkeit vollgepfropften Folianten dieser
Zeit findet, in ßlaise de Vigeneres Philostrat-Übersetzung: Des imagcs et tableaux de platte peinture des deux Philostrates,
Paris 1574 (in der Ausgabe von 1615, p. 910). Andere Details bei Laborde, La Renaissance des arts ä la cour de France
(Paris 1850) I, 49 f.
2 Das zuerst von Billi erwähnte Spottgemälde (am ßargellopalast) auf den Herzog von Athen und seine Räte (1344,
nach Gio. Villani VII, 34) beschreiben noch Vasari-Sansoni (I, 625) und Baldinucci (Mailänder Ausgabe V, 386, dort auch
die Unterschriften). Eine ganze Reihe gereimter Tituli auf sienesische Staatsverbrecher (1392, am Kommunalpalast) hat Deila
Valle, Lettere Sanesi I, 54, aus der Chronik des Tizio mitgeteilt. Schandgemälde dieser Art kommen aber auch im mittel-
alterlichen Frankreich vor. Ein Maler von Evreux, Gabriel de Fevre, erhält 1477 den königlichen Befehl, fünf solcher
Bilder von dem Prinzen von Orange (est paint et pourtrait la stature et epitaffe de messire Jehau, prince d'Orange, pendu
et Ies pics en hault) anzufertigen: Laborde a. a. O. I, J0>
3 Andrea degl' impiccati, vgl. Vasari-Sansoni II, 680 (der Spitzname schon bei Zeitgenossen wie Filarete und Landucci,
Diario ed. del Badia, p. 3).
4 Vgl. hierüber Feuerbachs Vatikanischen Apollo, Abschn. 2, n. i3.
! Lügenfreund, c. 18 f.
6 Epp. III, 6.
Julius v. Schlosser.
sind Legion. Noch in der Renaissance geben französische Prozeßakten Aufschluß über dergleichen
magische Praktiken, die auch einen ganz bestimmten technischen Terminus haben: envoultement und
envoulter (abgeleitet von vultus, vgl. Ducanges Glossar s.v.).1 Das Wort ist charakteristisch, weil es
sich auf das Angesicht als die Akme des physischen Lebens bezieht. Aus frühem Mittelalter, ja schon
aus römischer Zeit (worüber später) ragt in das Florenz der vollen Renaissance die Prostitution und
Exekution des Staatsfeindes, dessen man nicht habhaft werden konnte, «in effigie» hinein. Es sind
Künstler von Namen und Ruf, wie der sogenannte Giottino im XIV.,2 wie Andrea del Castagno und
Paolo Romano (siehe unten) im XV., Andrea del Sarto im XVI. Jahrhundert, die es nicht verschmähten,
ihre Kunst derart in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen;
Castagno verdankt dem bekanntlich in seiner stets der Spott-
sucht zugeneigten Vaterstadt den Spitznamen des «Galgen-
malerst>.3
Das Leben des Kunstwerkes und ganz besonders des
Porträts ist ja einer der primitivsten Concetti, mit dem sich
naive Beschauer der Schöpfung des Künstlers gegenüber am
ersten und leichtesten abzufinden pflegen. Dergleichen zieht
sich seit der Antike, genährt durch stets forterzählte Künstler-
anekdoten, in alle Folgezeit hinein. Kommt nun noch das
künstlerische Produkt selbst durch weitgediehenen Naturalis-
mus solch tief eingewurzelter Anschauung entgegen, so treibt
dieser Dämonismus, der sich am naivsten in den gefessel-
ten Tempelstatuen des' uralten Kunstheros Dädalos zeigt,4
mitunter gar wunderliche Blüten. Aus der vollen Höhe helle-
nischer Kultur und Kunst ist uns durch Lukian5 die sonder-
bare Geschichte eines durch seinen ausgesprochenen Realis-
mus besonders auffälligen Werkes des Demetriosvon Alopeke,
eines griechischen Quattrocentisten, überliefert, das, wie aus
einem Briefe des jüngeren Plinius hervorzugehen scheint, noch
in der Kaiserzeit in Bronzenachbildungen verbreitet war.6 Die
Statue des alten korinthischen Feldherrn Pelichos, von der
Fig. 2. Bronzemaske im fiirstl. Waldeck'schen
Museum zu Arolsen. mer die Rede ist, erwacht nächtlicher Weile zu allerhand
spukhaftem, Unheil aber auch Segen stiftendem Treiben.
Von diesen Voraussetzungen aus kommen wir den eigentümlichen Anschauungen, die das Gebiet
der Wachsporträts überall durchsetzen, um einen Schritt näher. Wir brauchen nicht auf das alte Ägyp-
ten und seine Toten, die als Mumien in unseren Museen weiterschlafen, zurückzugehen, um den Ge-
1 Wie tief diese Vorstellungen noch in der humanistisch gebildeten Gesellschaft der Renaissance wurzelten, beweist
die lange, merkwürdige Auseinandersetzung, die sich in einem mit schwerer Gelehrsamkeit vollgepfropften Folianten dieser
Zeit findet, in ßlaise de Vigeneres Philostrat-Übersetzung: Des imagcs et tableaux de platte peinture des deux Philostrates,
Paris 1574 (in der Ausgabe von 1615, p. 910). Andere Details bei Laborde, La Renaissance des arts ä la cour de France
(Paris 1850) I, 49 f.
2 Das zuerst von Billi erwähnte Spottgemälde (am ßargellopalast) auf den Herzog von Athen und seine Räte (1344,
nach Gio. Villani VII, 34) beschreiben noch Vasari-Sansoni (I, 625) und Baldinucci (Mailänder Ausgabe V, 386, dort auch
die Unterschriften). Eine ganze Reihe gereimter Tituli auf sienesische Staatsverbrecher (1392, am Kommunalpalast) hat Deila
Valle, Lettere Sanesi I, 54, aus der Chronik des Tizio mitgeteilt. Schandgemälde dieser Art kommen aber auch im mittel-
alterlichen Frankreich vor. Ein Maler von Evreux, Gabriel de Fevre, erhält 1477 den königlichen Befehl, fünf solcher
Bilder von dem Prinzen von Orange (est paint et pourtrait la stature et epitaffe de messire Jehau, prince d'Orange, pendu
et Ies pics en hault) anzufertigen: Laborde a. a. O. I, J0>
3 Andrea degl' impiccati, vgl. Vasari-Sansoni II, 680 (der Spitzname schon bei Zeitgenossen wie Filarete und Landucci,
Diario ed. del Badia, p. 3).
4 Vgl. hierüber Feuerbachs Vatikanischen Apollo, Abschn. 2, n. i3.
! Lügenfreund, c. 18 f.
6 Epp. III, 6.