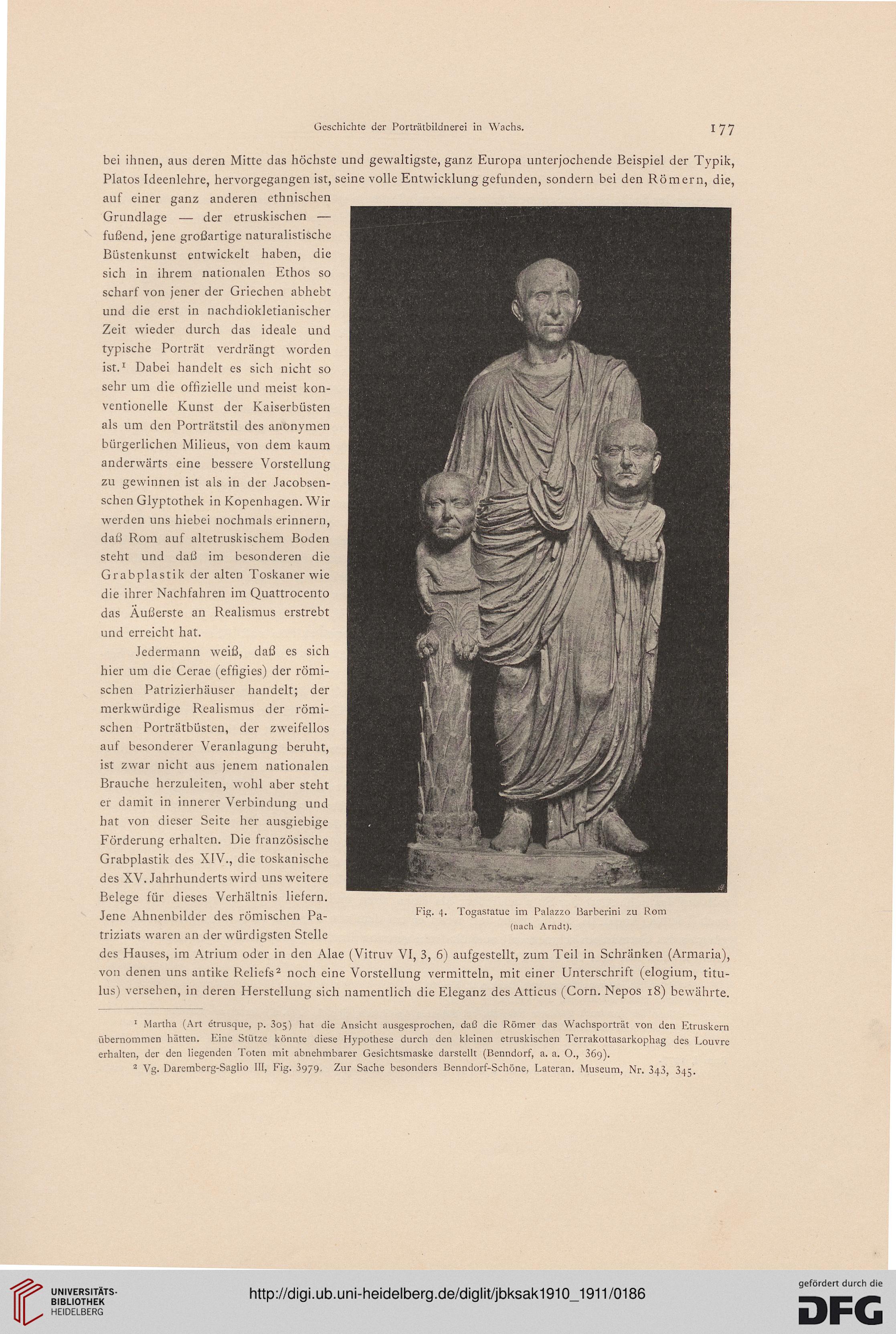Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.
177
bei ihnen, aus deren Mitte das höchste und gewaltigste, ganz Europa unterjochende Beispiel der Typik,
Piatos Ideenlehre, hervorgegangen ist, seine volle Entwicklung gefunden, sondern bei den Römern, die,
auf einer ganz anderen ethnischen
Grundlage — der etruskischen —
fußend, jene großartige naturalistische
Büstenkunst entwickelt haben, die
sich in ihrem nationalen Ethos so
scharf von jener der Griechen abhebt
und die erst in nachdiokletianischer
Zeit wieder durch das ideale und
typische Porträt verdrängt worden
ist.1 Dabei handelt es sich nicht so
sehr um die offizielle und meist kon-
ventionelle Kunst der Kaiserbüsten
als um den Porträtstil des anonymen
bürgerlichen Milieus, von dem kaum
anderwärts eine bessere Vorstellung
zu gewinnen ist als in der Jacobsen-
schen Glyptothek in Kopenhagen. Wir
werden uns hiebei nochmals erinnern,
daß Rom auf altetruskischem Boden
steht und daß im besonderen die
Grabplastik der alten Toskaner wie
die ihrer Nachfahren im Quattrocento
das Äußerste an Realismus erstrebt
und erreicht hat.
Jedermann weiß, daß es sich
hier um die Cerae (effigies) der römi-
schen Patrizierhäuser handelt; der
merkwürdige Realismus der römi-
schen Porträtbüsten, der zweifellos
auf besonderer Veranlagung beruht,
ist zwar nicht aus jenem nationalen
Brauche herzuleiten, wohl aber steht
er damit in innerer Verbindung und
hat von dieser Seite her ausgiebige
Förderung erhalten. Die französische
Grabplastik des XIV., die toskanische
des XV. Jahrhunderts wird uns weitere
Belege für dieses Verhältnis liefern.
Jene Ahnenbilder des römischen Pa-
triziats waren an der würdigsten Stelle
Fig. 4. Togastatuc im Palazzo Barberini zu Rom
(nach Arndt).
des Hauses, im Atrium oder in den Alae (Vitruv VI, 3, 6) aufgestellt, zum Teil in Schränken (Armaria),
von denen uns antike Reliefs2 noch eine Vorstellung vermitteln, mit einer Unterschrift (elogium, titu-
lus) versehen, in deren Herstellung sich namentlich die Eleganz des Atticus (Corn. Nepos 18) bewährte.
1 Martha (Art etrusque, p. 3o,) hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Römer das Wachsporträt von den Etruskern
übernommen hatten. F.ine Stütze könnte diese Hypothese durch den kleinen etruskischen Terrakottasarkophag des Louvre
erhalten, der den liegenden Toten mit abnehmbarer Gesichtsmaske darstellt (Benndorf, a. a. O., 369).
2 Vg. Daremberg-Saglio III, Fig. 3979. Zur Sache besonders Benndorf-Schöne, Lateran. Museum, Nr. 343, 34;.
177
bei ihnen, aus deren Mitte das höchste und gewaltigste, ganz Europa unterjochende Beispiel der Typik,
Piatos Ideenlehre, hervorgegangen ist, seine volle Entwicklung gefunden, sondern bei den Römern, die,
auf einer ganz anderen ethnischen
Grundlage — der etruskischen —
fußend, jene großartige naturalistische
Büstenkunst entwickelt haben, die
sich in ihrem nationalen Ethos so
scharf von jener der Griechen abhebt
und die erst in nachdiokletianischer
Zeit wieder durch das ideale und
typische Porträt verdrängt worden
ist.1 Dabei handelt es sich nicht so
sehr um die offizielle und meist kon-
ventionelle Kunst der Kaiserbüsten
als um den Porträtstil des anonymen
bürgerlichen Milieus, von dem kaum
anderwärts eine bessere Vorstellung
zu gewinnen ist als in der Jacobsen-
schen Glyptothek in Kopenhagen. Wir
werden uns hiebei nochmals erinnern,
daß Rom auf altetruskischem Boden
steht und daß im besonderen die
Grabplastik der alten Toskaner wie
die ihrer Nachfahren im Quattrocento
das Äußerste an Realismus erstrebt
und erreicht hat.
Jedermann weiß, daß es sich
hier um die Cerae (effigies) der römi-
schen Patrizierhäuser handelt; der
merkwürdige Realismus der römi-
schen Porträtbüsten, der zweifellos
auf besonderer Veranlagung beruht,
ist zwar nicht aus jenem nationalen
Brauche herzuleiten, wohl aber steht
er damit in innerer Verbindung und
hat von dieser Seite her ausgiebige
Förderung erhalten. Die französische
Grabplastik des XIV., die toskanische
des XV. Jahrhunderts wird uns weitere
Belege für dieses Verhältnis liefern.
Jene Ahnenbilder des römischen Pa-
triziats waren an der würdigsten Stelle
Fig. 4. Togastatuc im Palazzo Barberini zu Rom
(nach Arndt).
des Hauses, im Atrium oder in den Alae (Vitruv VI, 3, 6) aufgestellt, zum Teil in Schränken (Armaria),
von denen uns antike Reliefs2 noch eine Vorstellung vermitteln, mit einer Unterschrift (elogium, titu-
lus) versehen, in deren Herstellung sich namentlich die Eleganz des Atticus (Corn. Nepos 18) bewährte.
1 Martha (Art etrusque, p. 3o,) hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Römer das Wachsporträt von den Etruskern
übernommen hatten. F.ine Stütze könnte diese Hypothese durch den kleinen etruskischen Terrakottasarkophag des Louvre
erhalten, der den liegenden Toten mit abnehmbarer Gesichtsmaske darstellt (Benndorf, a. a. O., 369).
2 Vg. Daremberg-Saglio III, Fig. 3979. Zur Sache besonders Benndorf-Schöne, Lateran. Museum, Nr. 343, 34;.