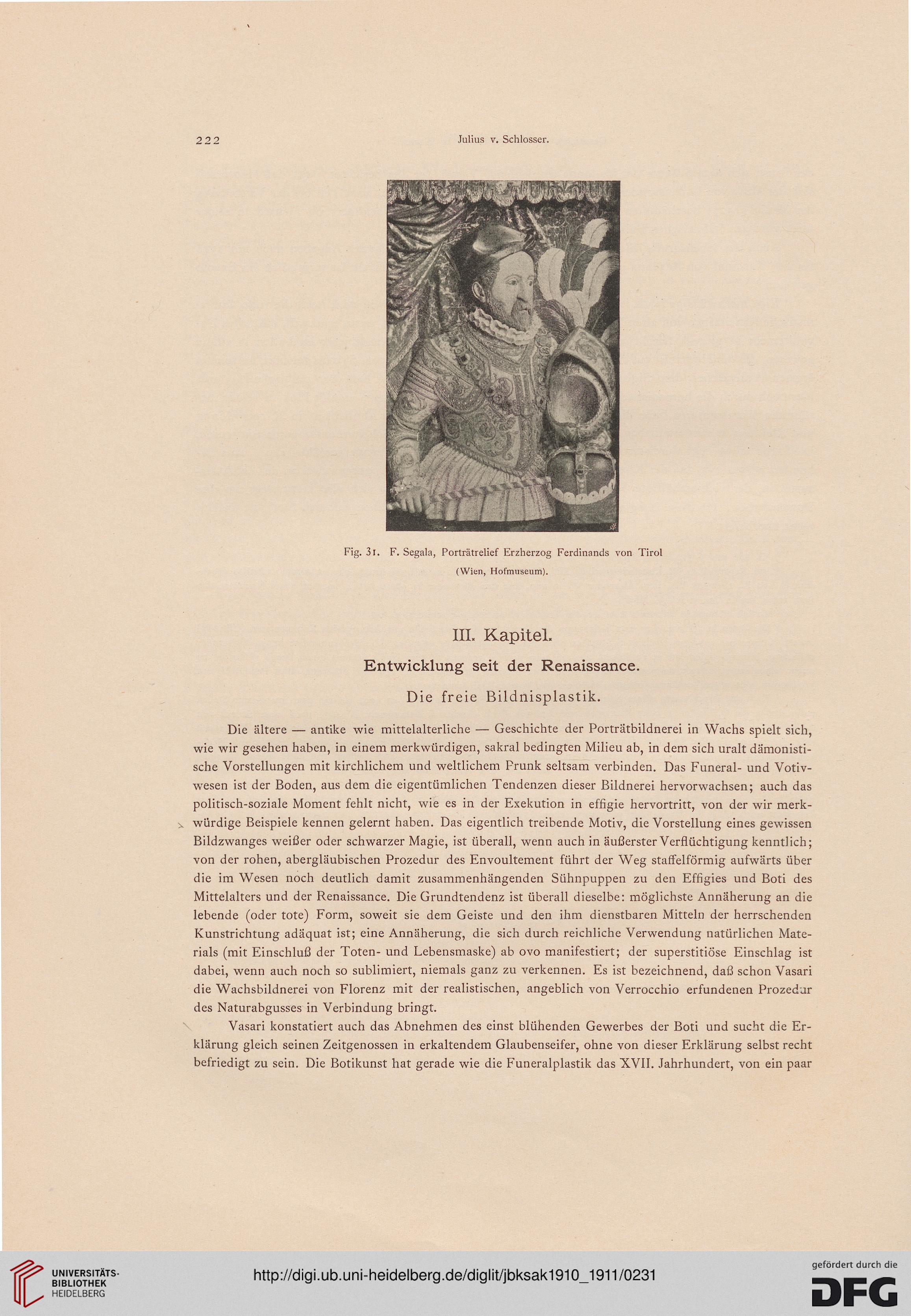222
Julius v. Schlosser.
Fig. 3l. F. Segala, Porträtrelief Erzherzog Ferdinands von Tirol
(Wien, Hofmuseum).
III. Kapitel.
Entwicklung seit der Renaissance.
Die freie Bildnisplastik.
Die ältere — antike wie mittelalterliche — Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs spielt sich,
wie wir gesehen haben, in einem merkwürdigen, sakral bedingten Milieu ab, in dem sich uralt dämonisti-
sche Vorstellungen mit kirchlichem und weltlichem Prunk seltsam verbinden. Das Funeral- und Votiv-
wesen ist der Boden, aus dem die eigentümlichen Tendenzen dieser ßildnerei hervorwachsen; auch das
politisch-soziale Moment fehlt nicht, wie es in der Exekution in effigie hervortritt, von der wir merk-
x würdige Beispiele kennen gelernt haben. Das eigentlich treibende Motiv, die Vorstellung eines gewissen
Bildzwanges weißer oder schwarzer Magie, ist überall, wenn auch in äußerster Verflüchtigung kenntlich;
von der rohen, abergläubischen Prozedur des Envoultement führt der Weg staffeiförmig aufwärts über
die im Wesen noch deutlich damit zusammenhängenden Sühnpuppen zu den Effigies und Boti des
Mittelalters und der Renaissance. Die Grundtendenz ist überall dieselbe: möglichste Annäherung an die
lebende (oder tote) Form, soweit sie dem Geiste und den ihm dienstbaren Mitteln der herrschenden
Kunstrichtung adäquat ist; eine Annäherung, die sich durch reichliche Verwendung natürlichen Mate-
rials (mit Einschluß der Toten- und Lebensmaske) ab ovo manifestiert; der superstitiöse Einschlag ist
dabei, wenn auch noch so sublimiert, niemals ganz zu verkennen. Es ist bezeichnend, daß schon Vasari
die Wachsbildnerei von Florenz mit der realistischen, angeblich von Verrocchio erfundenen Prozedur
des Naturabgusses in Verbindung bringt.
Vasari konstatiert auch das Abnehmen des einst blühenden Gewerbes der Boti und sucht die Er-
klärung gleich seinen Zeitgenossen in erkaltendem Glaubenseifer, ohne von dieser Erklärung selbst recht
befriedigt zu sein. Die Botikunst hat gerade wie die Funeralplastik das XVII. Jahrhundert, von ein paar
Julius v. Schlosser.
Fig. 3l. F. Segala, Porträtrelief Erzherzog Ferdinands von Tirol
(Wien, Hofmuseum).
III. Kapitel.
Entwicklung seit der Renaissance.
Die freie Bildnisplastik.
Die ältere — antike wie mittelalterliche — Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs spielt sich,
wie wir gesehen haben, in einem merkwürdigen, sakral bedingten Milieu ab, in dem sich uralt dämonisti-
sche Vorstellungen mit kirchlichem und weltlichem Prunk seltsam verbinden. Das Funeral- und Votiv-
wesen ist der Boden, aus dem die eigentümlichen Tendenzen dieser ßildnerei hervorwachsen; auch das
politisch-soziale Moment fehlt nicht, wie es in der Exekution in effigie hervortritt, von der wir merk-
x würdige Beispiele kennen gelernt haben. Das eigentlich treibende Motiv, die Vorstellung eines gewissen
Bildzwanges weißer oder schwarzer Magie, ist überall, wenn auch in äußerster Verflüchtigung kenntlich;
von der rohen, abergläubischen Prozedur des Envoultement führt der Weg staffeiförmig aufwärts über
die im Wesen noch deutlich damit zusammenhängenden Sühnpuppen zu den Effigies und Boti des
Mittelalters und der Renaissance. Die Grundtendenz ist überall dieselbe: möglichste Annäherung an die
lebende (oder tote) Form, soweit sie dem Geiste und den ihm dienstbaren Mitteln der herrschenden
Kunstrichtung adäquat ist; eine Annäherung, die sich durch reichliche Verwendung natürlichen Mate-
rials (mit Einschluß der Toten- und Lebensmaske) ab ovo manifestiert; der superstitiöse Einschlag ist
dabei, wenn auch noch so sublimiert, niemals ganz zu verkennen. Es ist bezeichnend, daß schon Vasari
die Wachsbildnerei von Florenz mit der realistischen, angeblich von Verrocchio erfundenen Prozedur
des Naturabgusses in Verbindung bringt.
Vasari konstatiert auch das Abnehmen des einst blühenden Gewerbes der Boti und sucht die Er-
klärung gleich seinen Zeitgenossen in erkaltendem Glaubenseifer, ohne von dieser Erklärung selbst recht
befriedigt zu sein. Die Botikunst hat gerade wie die Funeralplastik das XVII. Jahrhundert, von ein paar