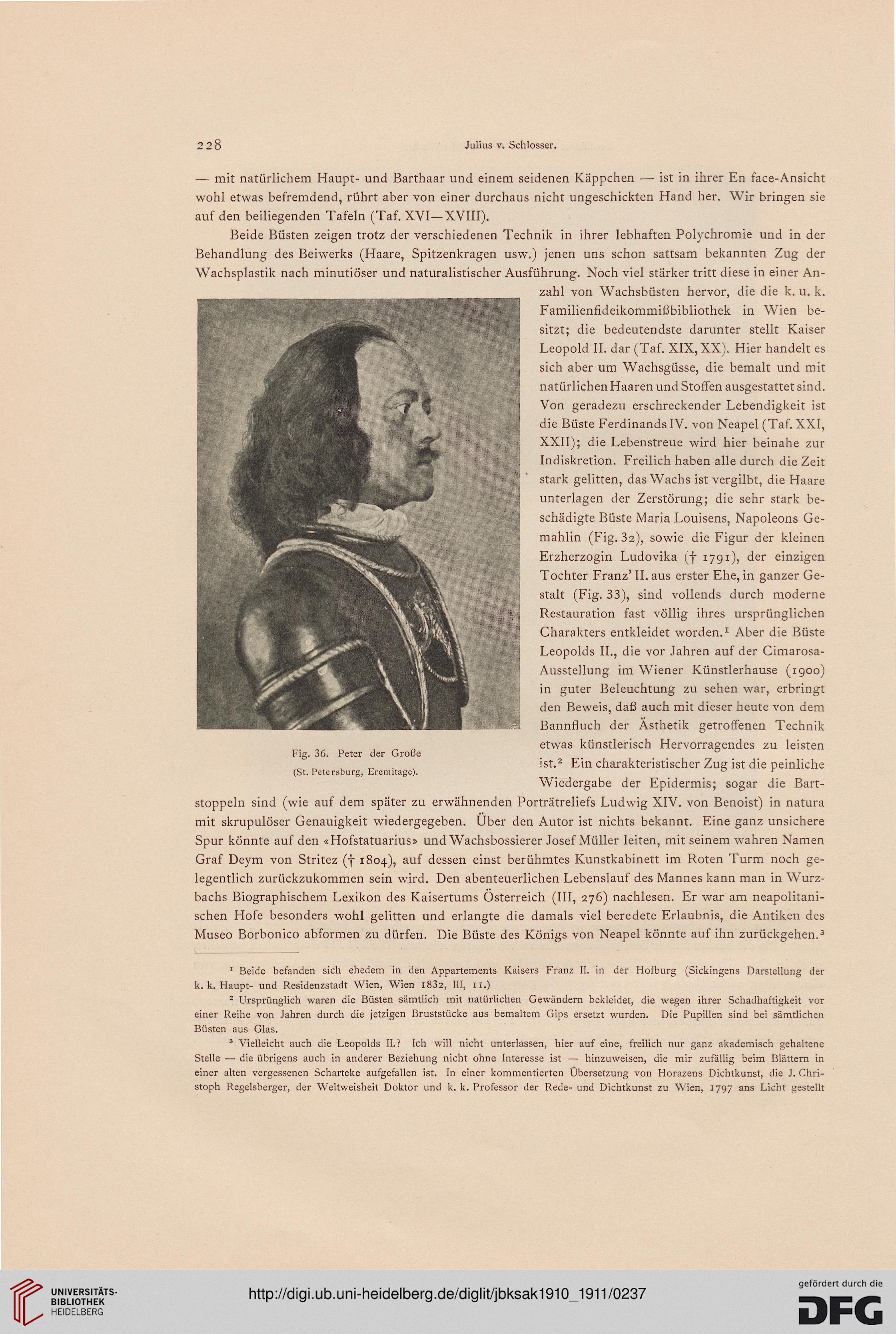228
Julius v. Schlosser.
— mit natürlichem Haupt- und Barthaar und einem seidenen Käppchen — ist in ihrer En face-Ansicht
wohl etwas befremdend, rührt aber von einer durchaus nicht ungeschickten Hand her. Wir bringen sie
auf den beiliegenden Tafeln (Taf. XVI-XVIII).
Beide Büsten zeigen trotz der verschiedenen Technik in ihrer lebhaften Polychromie und in der
Behandlung des Beiwerks (Haare, Spitzenkragen usw.) jenen uns schon sattsam bekannten Zug der
Wachsplastik nach minutiöser und naturalistischer Ausführung. Noch viel stärker tritt diese in einer An-
zahl von Wachsbüsten hervor, die die k. u. k.
Familienfideikommißbibliothek in Wien be-
sitzt; die bedeutendste darunter stellt Kaiser
Leopold II. dar (Taf. XIX, XX). Hier handelt es
sich aber um Wachsgüsse, die bemalt und mit
natürlichen Haaren und Stoffen ausgestattet sind.
Von geradezu erschreckender Lebendigkeit ist
die Büste Ferdinands IV. von Neapel (Taf. XXI,
XXII); die Lebenstreue wird hier beinahe zur
Indiskretion. Freilich haben alle durch die Zeit
stark gelitten, das Wachs ist vergilbt, die Haare
unterlagen der Zerstörung; die sehr stark be-
schädigte Büste Maria Louisens, Napoleons Ge-
mahlin (Fig. 32), sowie die Figur der kleinen
Erzherzogin Ludovika (f 17g 1), der einzigen
Tochter Franz' II. aus erster Ehe, in ganzer Ge-
stalt (Fig. 33), sind vollends durch moderne
Restauration fast völlig ihres ursprünglichen
Charakters entkleidet worden.1 Aber die Büste
Leopolds II., die vor Jahren auf der Cimarosa-
Ausstellung im Wiener Künstlerhause (1900)
in guter Beleuchtung zu sehen war, erbringt
den Beweis, daß auch mit dieser heute von dem
Bannfluch der Ästhetik getroffenen Technik
etwas künstlerisch Hervorragendes zu leisten
ist.2 Ein charakteristischer Zug ist die peinliche
Wiedergabe der Epidermis; sogar die Bart-
stoppeln sind (wie auf dem später zu erwähnenden Porträtreliefs Ludwig XIV. von Benoist) in natura
mit skrupulöser Genauigkeit wiedergegeben. Uber den Autor ist nichts bekannt. Eine ganz unsichere
Spur könnte auf den «Hofstatuarius» und Wachsbossierer Josef Müller leiten, mit seinem wahren Namen
Graf Deym von Stritez (f 1804), auf dessen einst berühmtes Kunstkabinett im Roten Turm noch ge-
legentlich zurückzukommen sein wird. Den abenteuerlichen Lebenslauf des Mannes kann man in Wurz-
bachs Biographischem Lexikon des Kaisertums Osterreich (III, 276) nachlesen. Er war am neapolitani-
schen Hofe besonders wohl gelitten und erlangte die damals viel beredete Erlaubnis, die Antiken des
Museo Borbonico abformen zu dürfen. Die Büste des Königs von Neapel könnte auf ihn zurückgehen.3
Fig. 36. Peter der Große
(St. Petersburg, Eremitage).
1 Beide befanden sich ehedem in den Appartements Kaisers Franz II. in der Hofburg (Sickingens Darstellung der
k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Wien 1832, III, 11.)
2 Ursprünglich waren die Büsten sämtlich mit natürlichen Gewändern bekleidet, die wegen ihrer Schadhaftigkeit vor
einer Reihe von Jahren durch die jetzigen Bruststücke aus bemaltem Gips ersetzt wurden. Die Pupillen sind bei sämtlichen
Büsten aus Glas.
3 Vielleicht auch die Leopolds II.? Ich will nicht unterlassen, hier auf eine, freilich nur ganz akademisch gehaltene
Stelle — die übrigens auch in anderer Beziehung nicht ohne Interesse ist — hinzuweisen, die mir zufällig beim Blättern in
einer alten vergessenen Scharteke aufgefallen ist. In einer kommentierten Übersetzung von Horazens Dichtkunst, die J. Chri-
stoph Regelsberger, der Weltweisheit Doktor und k. k. Professor der Rede- und Dichtkunst zu Wien, 1797 ans Licht gestellt
Julius v. Schlosser.
— mit natürlichem Haupt- und Barthaar und einem seidenen Käppchen — ist in ihrer En face-Ansicht
wohl etwas befremdend, rührt aber von einer durchaus nicht ungeschickten Hand her. Wir bringen sie
auf den beiliegenden Tafeln (Taf. XVI-XVIII).
Beide Büsten zeigen trotz der verschiedenen Technik in ihrer lebhaften Polychromie und in der
Behandlung des Beiwerks (Haare, Spitzenkragen usw.) jenen uns schon sattsam bekannten Zug der
Wachsplastik nach minutiöser und naturalistischer Ausführung. Noch viel stärker tritt diese in einer An-
zahl von Wachsbüsten hervor, die die k. u. k.
Familienfideikommißbibliothek in Wien be-
sitzt; die bedeutendste darunter stellt Kaiser
Leopold II. dar (Taf. XIX, XX). Hier handelt es
sich aber um Wachsgüsse, die bemalt und mit
natürlichen Haaren und Stoffen ausgestattet sind.
Von geradezu erschreckender Lebendigkeit ist
die Büste Ferdinands IV. von Neapel (Taf. XXI,
XXII); die Lebenstreue wird hier beinahe zur
Indiskretion. Freilich haben alle durch die Zeit
stark gelitten, das Wachs ist vergilbt, die Haare
unterlagen der Zerstörung; die sehr stark be-
schädigte Büste Maria Louisens, Napoleons Ge-
mahlin (Fig. 32), sowie die Figur der kleinen
Erzherzogin Ludovika (f 17g 1), der einzigen
Tochter Franz' II. aus erster Ehe, in ganzer Ge-
stalt (Fig. 33), sind vollends durch moderne
Restauration fast völlig ihres ursprünglichen
Charakters entkleidet worden.1 Aber die Büste
Leopolds II., die vor Jahren auf der Cimarosa-
Ausstellung im Wiener Künstlerhause (1900)
in guter Beleuchtung zu sehen war, erbringt
den Beweis, daß auch mit dieser heute von dem
Bannfluch der Ästhetik getroffenen Technik
etwas künstlerisch Hervorragendes zu leisten
ist.2 Ein charakteristischer Zug ist die peinliche
Wiedergabe der Epidermis; sogar die Bart-
stoppeln sind (wie auf dem später zu erwähnenden Porträtreliefs Ludwig XIV. von Benoist) in natura
mit skrupulöser Genauigkeit wiedergegeben. Uber den Autor ist nichts bekannt. Eine ganz unsichere
Spur könnte auf den «Hofstatuarius» und Wachsbossierer Josef Müller leiten, mit seinem wahren Namen
Graf Deym von Stritez (f 1804), auf dessen einst berühmtes Kunstkabinett im Roten Turm noch ge-
legentlich zurückzukommen sein wird. Den abenteuerlichen Lebenslauf des Mannes kann man in Wurz-
bachs Biographischem Lexikon des Kaisertums Osterreich (III, 276) nachlesen. Er war am neapolitani-
schen Hofe besonders wohl gelitten und erlangte die damals viel beredete Erlaubnis, die Antiken des
Museo Borbonico abformen zu dürfen. Die Büste des Königs von Neapel könnte auf ihn zurückgehen.3
Fig. 36. Peter der Große
(St. Petersburg, Eremitage).
1 Beide befanden sich ehedem in den Appartements Kaisers Franz II. in der Hofburg (Sickingens Darstellung der
k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Wien 1832, III, 11.)
2 Ursprünglich waren die Büsten sämtlich mit natürlichen Gewändern bekleidet, die wegen ihrer Schadhaftigkeit vor
einer Reihe von Jahren durch die jetzigen Bruststücke aus bemaltem Gips ersetzt wurden. Die Pupillen sind bei sämtlichen
Büsten aus Glas.
3 Vielleicht auch die Leopolds II.? Ich will nicht unterlassen, hier auf eine, freilich nur ganz akademisch gehaltene
Stelle — die übrigens auch in anderer Beziehung nicht ohne Interesse ist — hinzuweisen, die mir zufällig beim Blättern in
einer alten vergessenen Scharteke aufgefallen ist. In einer kommentierten Übersetzung von Horazens Dichtkunst, die J. Chri-
stoph Regelsberger, der Weltweisheit Doktor und k. k. Professor der Rede- und Dichtkunst zu Wien, 1797 ans Licht gestellt