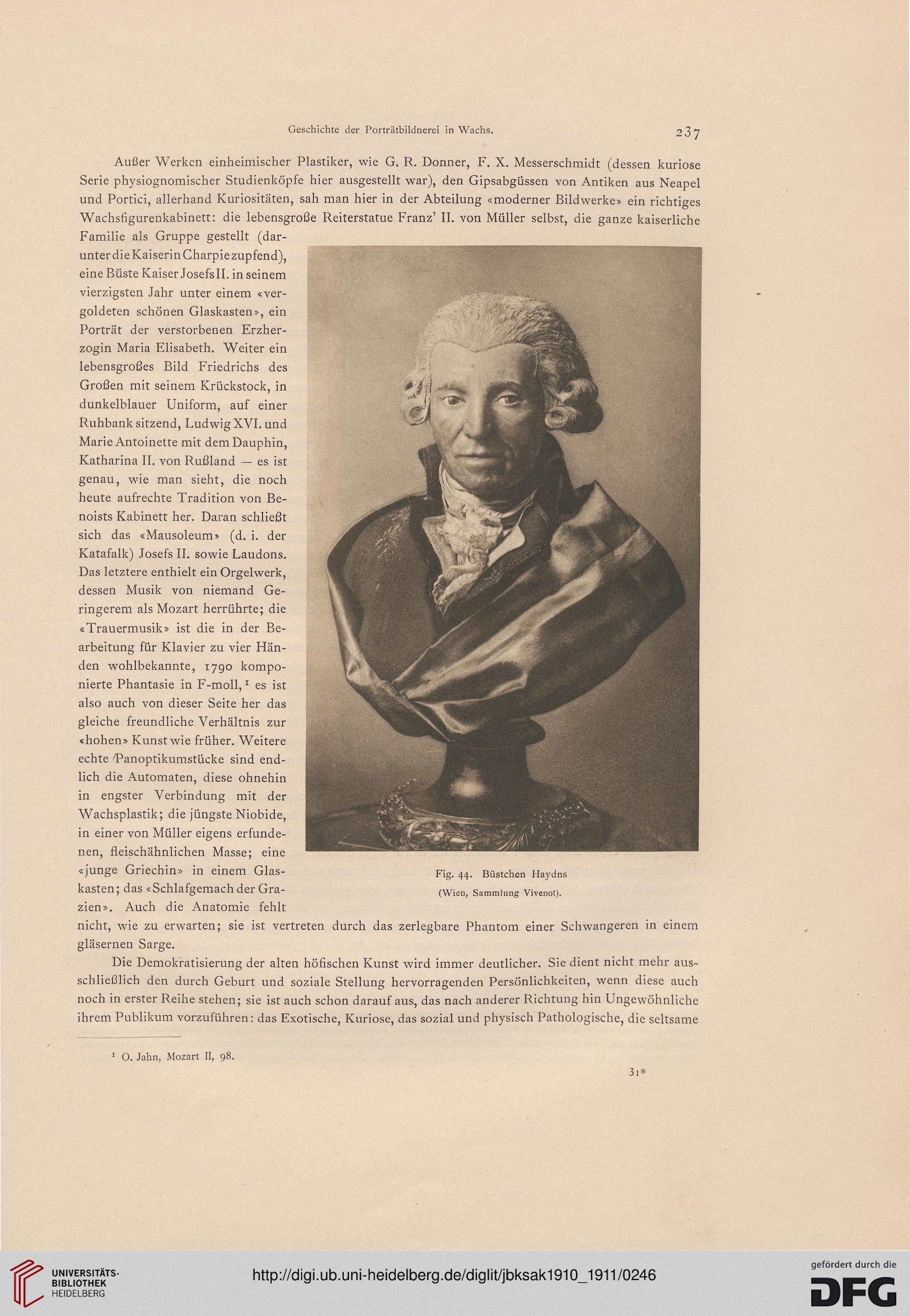Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.
Außer Werken einheimischer Plastiker, wie G. R. Donner, F. X. Messerschmidt (dessen kuriose
Serie physiognomischer Studienköpfe hier ausgestellt war), den Gipsabgüssen von Antiken aus Neapel
und Portici, allerhand Kuriositäten, sah man hier in der Abteilung «moderner Bildwerke» ein richtiges
Wachsfigurenkabinett: die lebensgroße Reiterstatue Franz' II. von Müller selbst, die ganze kaiserliche
Familie als Gruppe gestellt (dar-
unter die Kaiserin Charpie zupfend),
eine Büste Kaiser Josefs II. in seinem
vierzigsten Jahr unter einem «ver-
goldeten schönen Glaskasten», ein
Porträt der verstorbenen Erzher-
zogin Maria Elisabeth. Weiter ein
lebensgroßes Bild Friedrichs des
Großen mit seinem Krückstock, in
dunkelblauer Uniform, auf einer
Ruhbank sitzend, Ludwig XVI. und
Marie Antoinette mit dem Dauphin,
Katharina II. von Rußland — es ist
genau, wie man sieht, die noch
heute aufrechte Tradition von Be-
noists Kabinett her. Daran schließt
sich das «Mausoleum» (d. i. der
Katafalk) Josefs II. sowie Laudons.
Das letztere enthielt ein Orgelwerk,
dessen Musik von niemand Ge-
ringerem als Mozart herrührte; die
«Trauermusik» ist die in der Be-
arbeitung für Klavier zu vier Hän-
den wohlbekannte, 1790 kompo-
nierte Phantasie in F-moll,1 es ist
also auch von dieser Seite her das
gleiche freundliche Verhältnis zur
«hohen» Kunst wie früher. Weitere
echte T'anoptikumstücke sind end-
lich die Automaten, diese ohnehin
in engster Verbindung mit der
Wachsplastik; die jüngste Niobide,
in einer von Müller eigens erfunde-
nen, fleischähnlichen Masse; eine
«junge Griechin» in einem Glas-
kasten; das «Schlafgemach der Gra-
zien». Auch die Anatomie fehlt
nicht, wie zu erwarten; sie ist vertreten durch das zerlegbare Phantom einer Schwangeren in einem
gläsernen Sarge.
Die Demokratisierung der alten höfischen Kunst wird immer deutlicher. Sie dient nicht mehr aus-
schließlich den durch Geburt und soziale Stellung hervorragenden Persönlichkeiten, wenn diese auch
noch in erster Reihe stehen; sie ist auch schon darauf aus, das nach anderer Richtung hin Ungewöhnliche
ihrem Publikum vorzuführen: das Exotische, Kuriose, das sozial und physisch Pathologische, die seltsame
Fig. 44. Büstchen Haydns
(Wien, Sammlung Vivenot).
O. Jahn, Mozart II, 98.
3l*
Außer Werken einheimischer Plastiker, wie G. R. Donner, F. X. Messerschmidt (dessen kuriose
Serie physiognomischer Studienköpfe hier ausgestellt war), den Gipsabgüssen von Antiken aus Neapel
und Portici, allerhand Kuriositäten, sah man hier in der Abteilung «moderner Bildwerke» ein richtiges
Wachsfigurenkabinett: die lebensgroße Reiterstatue Franz' II. von Müller selbst, die ganze kaiserliche
Familie als Gruppe gestellt (dar-
unter die Kaiserin Charpie zupfend),
eine Büste Kaiser Josefs II. in seinem
vierzigsten Jahr unter einem «ver-
goldeten schönen Glaskasten», ein
Porträt der verstorbenen Erzher-
zogin Maria Elisabeth. Weiter ein
lebensgroßes Bild Friedrichs des
Großen mit seinem Krückstock, in
dunkelblauer Uniform, auf einer
Ruhbank sitzend, Ludwig XVI. und
Marie Antoinette mit dem Dauphin,
Katharina II. von Rußland — es ist
genau, wie man sieht, die noch
heute aufrechte Tradition von Be-
noists Kabinett her. Daran schließt
sich das «Mausoleum» (d. i. der
Katafalk) Josefs II. sowie Laudons.
Das letztere enthielt ein Orgelwerk,
dessen Musik von niemand Ge-
ringerem als Mozart herrührte; die
«Trauermusik» ist die in der Be-
arbeitung für Klavier zu vier Hän-
den wohlbekannte, 1790 kompo-
nierte Phantasie in F-moll,1 es ist
also auch von dieser Seite her das
gleiche freundliche Verhältnis zur
«hohen» Kunst wie früher. Weitere
echte T'anoptikumstücke sind end-
lich die Automaten, diese ohnehin
in engster Verbindung mit der
Wachsplastik; die jüngste Niobide,
in einer von Müller eigens erfunde-
nen, fleischähnlichen Masse; eine
«junge Griechin» in einem Glas-
kasten; das «Schlafgemach der Gra-
zien». Auch die Anatomie fehlt
nicht, wie zu erwarten; sie ist vertreten durch das zerlegbare Phantom einer Schwangeren in einem
gläsernen Sarge.
Die Demokratisierung der alten höfischen Kunst wird immer deutlicher. Sie dient nicht mehr aus-
schließlich den durch Geburt und soziale Stellung hervorragenden Persönlichkeiten, wenn diese auch
noch in erster Reihe stehen; sie ist auch schon darauf aus, das nach anderer Richtung hin Ungewöhnliche
ihrem Publikum vorzuführen: das Exotische, Kuriose, das sozial und physisch Pathologische, die seltsame
Fig. 44. Büstchen Haydns
(Wien, Sammlung Vivenot).
O. Jahn, Mozart II, 98.
3l*