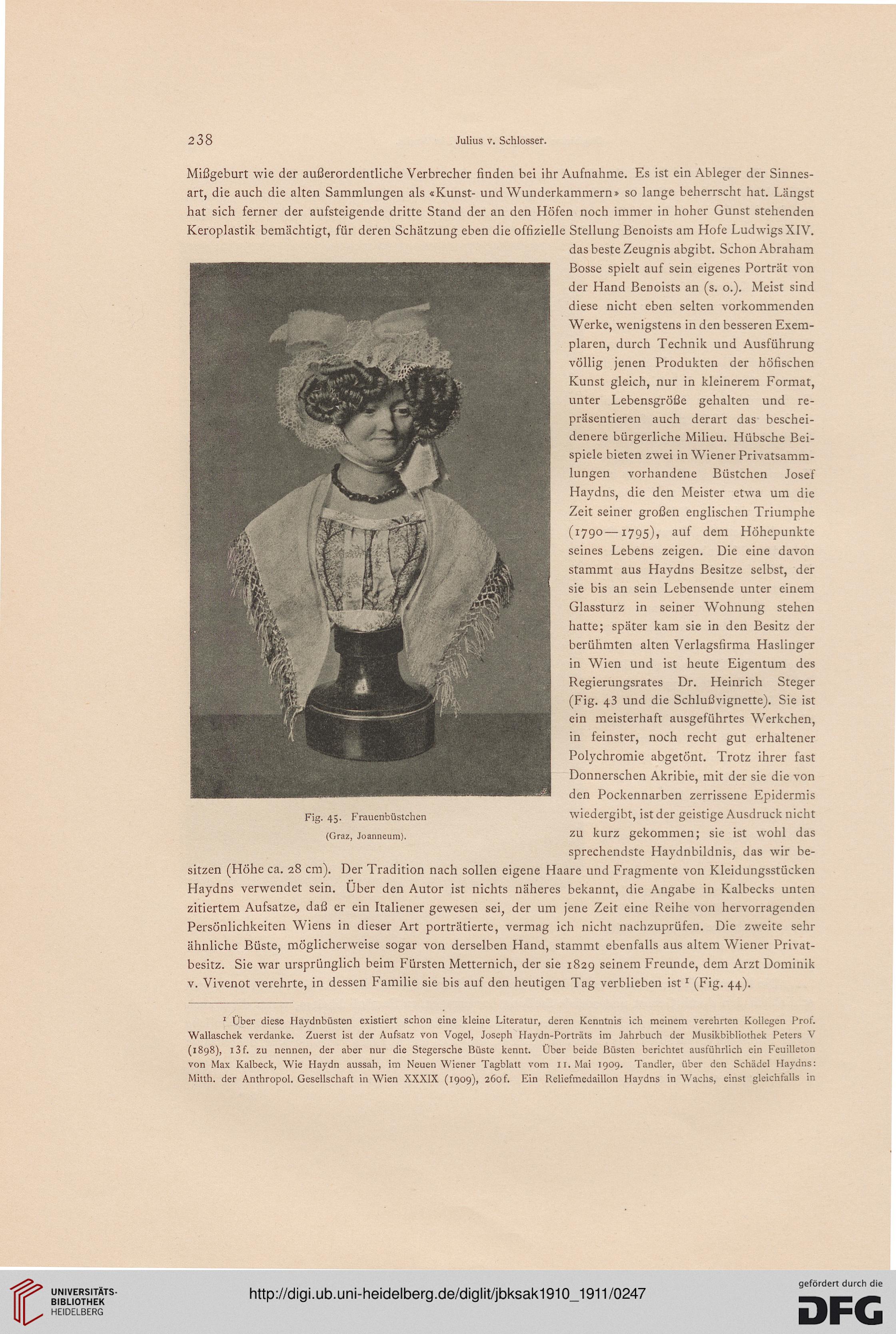238
Julius v. Schlosser.
Mißgeburt wie der außerordentliche Verbrecher finden bei ihr Aufnahme. Es ist ein Ableger der Sinnes-
art, die auch die alten Sammlungen als «Kunst- und Wunderkammern» so lange beherrscht hat. Längst
hat sich ferner der aufsteigende dritte Stand der an den Höfen noch immer in hoher Gunst stehenden
Keroplastik bemächtigt, für deren Schätzung eben die offizielle Stellung Benoists am Hofe Ludwigs XIV.
das beste Zeugnis abgibt. Schon Abraham
Bosse spielt auf sein eigenes Porträt von
der Hand Benoists an (s. o.). Meist sind
diese nicht eben selten vorkommenden
Werke, wenigstens in den besseren Exem-
plaren, durch Technik und Ausführung
völlig jenen Produkten der höfischen
Kunst gleich, nur in kleinerem Format,
unter Lebensgröße gehalten und re-
präsentieren auch derart das beschei-
denere bürgerliche Milieu. Hübsche Bei-
spiele bieten zwei in Wiener Privatsamm-
lungen vorhandene Büstchen Josef
Haydns, die den Meister etwa um die
Zeit seiner großen englischen Triumphe
(1790—1795), auf dem Höhepunkte
seines Lebens zeigen. Die eine davon
stammt aus Haydns Besitze selbst, der
sie bis an sein Lebensende unter einem
Glassturz in seiner Wohnung stehen
hatte; später kam sie in den Besitz der
berühmten alten Verlagsfirma Haslinger
in Wien und ist heute Eigentum des
Regierungsrates Dr. Heinrich Steger
(Fig. 43 und die Schlußvignette). Sie ist
ein meisterhaft ausgeführtes Werkchen,
in feinster, noch recht gut erhaltener
Polychromie abgetönt. Trotz ihrer fast
Donnerschen Akribie, mit der sie die von
den Pockennarben zerrissene Epidermis
Fig. 45. Frauenbüstchen wiedergibt, ist der geistige Ausdruck nicht
(Graz, Joanneum). zu kurz gekommen; sie ist wohl das
sprechendste Haydnbildnis, das wir be-
sitzen (Höhe ca. 28 cm). Der Tradition nach sollen eigene Haare und Fragmente von Kleidungsstücken
Haydns verwendet sein. Über den Autor ist nichts näheres bekannt, die Angabe in Kalbecks unten
zitiertem Aufsatze, daß er ein Italiener gewesen sei, der um jene Zeit eine Reihe von hervorragenden
Persönlichkeiten Wiens in dieser Art porträtierte, vermag ich nicht nachzuprüfen. Die zweite sehr
ähnliche Büste, möglicherweise sogar von derselben Hand, stammt ebenfalls aus altem Wiener Privat-
besitz. Sie war ursprünglich beim Fürsten Metternich, der sie 1829 seinem Freunde, dem Arzt Dominik
v. Vivenot verehrte, in dessen Familie sie bis auf den heutigen Tag verblieben ist1 (Fig. 44).
1 Über diese Haydnbüsten existiert schon eine kleine Literatur, deren Kenntnis ich meinem verehrten Kollegen Prof.
Wallaschek verdanke. Zuerst ist der Aufsatz von Vogel, Joseph Haydn-Porträts im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters V
(1898), 13 f. zu nennen, der aber nur die Stegersche Büste kennt. Über beide Büsten berichtet ausführlich ein Feuilleton
von Max Kalbeck, Wie Haydn aussah, im Neuen Wiener Tagblatt vom II. Mai 1909. Tandler, über den Schädel Haydns:
Mitth. der Anthropol. Gesellschaft in Wien XXXIX (1909), 26of. Ein Reliefmedaillon Haydns in Wachs, einst gleichfalls in
Julius v. Schlosser.
Mißgeburt wie der außerordentliche Verbrecher finden bei ihr Aufnahme. Es ist ein Ableger der Sinnes-
art, die auch die alten Sammlungen als «Kunst- und Wunderkammern» so lange beherrscht hat. Längst
hat sich ferner der aufsteigende dritte Stand der an den Höfen noch immer in hoher Gunst stehenden
Keroplastik bemächtigt, für deren Schätzung eben die offizielle Stellung Benoists am Hofe Ludwigs XIV.
das beste Zeugnis abgibt. Schon Abraham
Bosse spielt auf sein eigenes Porträt von
der Hand Benoists an (s. o.). Meist sind
diese nicht eben selten vorkommenden
Werke, wenigstens in den besseren Exem-
plaren, durch Technik und Ausführung
völlig jenen Produkten der höfischen
Kunst gleich, nur in kleinerem Format,
unter Lebensgröße gehalten und re-
präsentieren auch derart das beschei-
denere bürgerliche Milieu. Hübsche Bei-
spiele bieten zwei in Wiener Privatsamm-
lungen vorhandene Büstchen Josef
Haydns, die den Meister etwa um die
Zeit seiner großen englischen Triumphe
(1790—1795), auf dem Höhepunkte
seines Lebens zeigen. Die eine davon
stammt aus Haydns Besitze selbst, der
sie bis an sein Lebensende unter einem
Glassturz in seiner Wohnung stehen
hatte; später kam sie in den Besitz der
berühmten alten Verlagsfirma Haslinger
in Wien und ist heute Eigentum des
Regierungsrates Dr. Heinrich Steger
(Fig. 43 und die Schlußvignette). Sie ist
ein meisterhaft ausgeführtes Werkchen,
in feinster, noch recht gut erhaltener
Polychromie abgetönt. Trotz ihrer fast
Donnerschen Akribie, mit der sie die von
den Pockennarben zerrissene Epidermis
Fig. 45. Frauenbüstchen wiedergibt, ist der geistige Ausdruck nicht
(Graz, Joanneum). zu kurz gekommen; sie ist wohl das
sprechendste Haydnbildnis, das wir be-
sitzen (Höhe ca. 28 cm). Der Tradition nach sollen eigene Haare und Fragmente von Kleidungsstücken
Haydns verwendet sein. Über den Autor ist nichts näheres bekannt, die Angabe in Kalbecks unten
zitiertem Aufsatze, daß er ein Italiener gewesen sei, der um jene Zeit eine Reihe von hervorragenden
Persönlichkeiten Wiens in dieser Art porträtierte, vermag ich nicht nachzuprüfen. Die zweite sehr
ähnliche Büste, möglicherweise sogar von derselben Hand, stammt ebenfalls aus altem Wiener Privat-
besitz. Sie war ursprünglich beim Fürsten Metternich, der sie 1829 seinem Freunde, dem Arzt Dominik
v. Vivenot verehrte, in dessen Familie sie bis auf den heutigen Tag verblieben ist1 (Fig. 44).
1 Über diese Haydnbüsten existiert schon eine kleine Literatur, deren Kenntnis ich meinem verehrten Kollegen Prof.
Wallaschek verdanke. Zuerst ist der Aufsatz von Vogel, Joseph Haydn-Porträts im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters V
(1898), 13 f. zu nennen, der aber nur die Stegersche Büste kennt. Über beide Büsten berichtet ausführlich ein Feuilleton
von Max Kalbeck, Wie Haydn aussah, im Neuen Wiener Tagblatt vom II. Mai 1909. Tandler, über den Schädel Haydns:
Mitth. der Anthropol. Gesellschaft in Wien XXXIX (1909), 26of. Ein Reliefmedaillon Haydns in Wachs, einst gleichfalls in