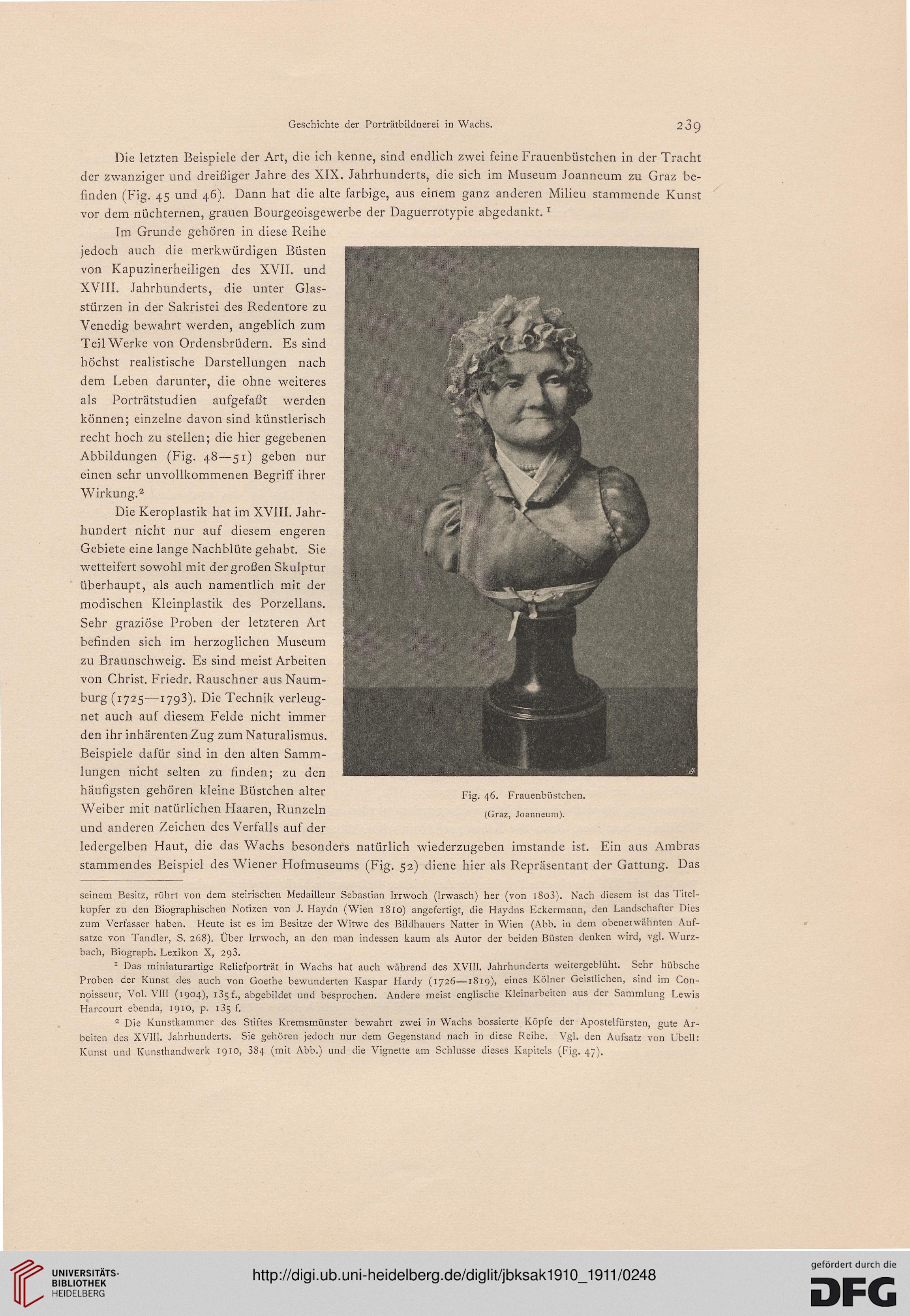Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.
239
Die letzten Beispiele der Art, die ich kenne, sind endlich zwei feine Frauenbüstchen in der Tracht
der zwanziger und dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts, die sich im Museum Joanneum zu Graz be-
finden (Fig. 45 und 46). Dann hat die alte farbige, aus einem ganz anderen Milieu stammende Kunst
vor dem nüchternen, grauen Bourgeoisgewerbe der Daguerrotypie abgedankt.1
Im Grunde gehören in diese Reihe
jedoch auch die merkwürdigen Büsten
von Kapuzinerheiligen des XVII. und
XVIII. Jahrhunderts, die unter Glas-
stürzen in der Sakristei des Redentore zu
Venedig bewahrt werden, angeblich zum
Teil Werke von Ordensbrüdern. Es sind
höchst realistische Darstellungen nach
dem Leben darunter, die ohne weiteres
als Porträtstudien aufgefaßt werden
können; einzelne davon sind künstlerisch
recht hoch zu stellen; die hier gegebenen
Abbildungen (Fig. 48—51) geben nur
einen sehr unvollkommenen Begriff ihrer
Wirkung.2
Die Keroplastik hat im XVIII. Jahr-
hundert nicht nur auf diesem engeren
Gebiete eine lange Nachblüte gehabt. Sie
wetteifert sowohl mit der großen Skulptur
überhaupt, als auch namentlich mit der
modischen Kleinplastik des Porzellans.
Sehr graziöse Proben der letzteren Art
befinden sich im herzoglichen Museum
zu Braunschweig. Es sind meist Arbeiten
von Christ. Friedr. Rauschner aus Naum-
burg (1725—1793). Die Technik verleug-
net auch auf diesem Felde nicht immer
den ihr inhärenten Zug zum Naturalismus.
Beispiele dafür sind in den alten Samm-
lungen nicht selten zu finden; zu den
häufigsten gehören kleine Büstchen alter
Weiber mit natürlichen Haaren, Runzeln
und anderen Zeichen des Verfalls auf der
ledergelben Haut, die das Wachs besonders natürlich wiederzugeben imstande ist. Ein aus Ambras
stammendes Beispiel des Wiener Hofmuseums (Fig. 52) diene hier als Repräsentant der Gattung. Das
Fig. 46. Frauenbüstchen.
(Graz, Joanneum).
seinem Besitz, rührt von dem steirischen Medailleur Sebastian Irrwoch (lrwasch) her (von i8o3). Nach diesem ist das Titel-
kupfer zu den Biographischen Notizen von J. Haydn (Wien 1810) angefertigt, die Haydns Eckermann, den Landschafter Dies
zum Verfasser haben. Heute ist es im Besitze der Witwe des Bildhauers Natter in Wien (Abb. in dem obeneiwähnten Auf-
satze von Tandler, S. 268). Über Irrwoch, an den man indessen kaum als Autor der beiden Büsten denken wird, vgl. Wurz-
bach, Biograph. Lexikon X, 293.
1 Das miniaturartige Reliefporträt in Wachs hat auch während des XVIII. Jahrhunderts weitergeblüht. Sehr hübsche
Proben der Kunst des auch von Goethe bewunderten Kaspar Hardy (1726—1819), eines Kölner Geistlichen, sind im Con-
npisseur, Vol. VIII (1904), 135 f., abgebildet und besprochen. Andere meist englische Kleinarbeiten aus der Sammlung Lewis
Harcourt ebenda, 1910, p. 135 f.
2 Die Kunstkammer des Stiftes Kremsmünster bewahrt zwei in Wachs bossierte Köpfe der Apostelfürsten, gute Ar-
beiten des XVIII. Jahrhunderts. Sie gehören jedoch nur dem Gegenstand nach in diese Reihe. Vgl. den Aufsatz von Ubell:
Kunst und Kunsthandwerk 1910, 384 (mit Abb.) und die Vignette am Schlüsse dieses Kapitels (Fig. 47).
239
Die letzten Beispiele der Art, die ich kenne, sind endlich zwei feine Frauenbüstchen in der Tracht
der zwanziger und dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts, die sich im Museum Joanneum zu Graz be-
finden (Fig. 45 und 46). Dann hat die alte farbige, aus einem ganz anderen Milieu stammende Kunst
vor dem nüchternen, grauen Bourgeoisgewerbe der Daguerrotypie abgedankt.1
Im Grunde gehören in diese Reihe
jedoch auch die merkwürdigen Büsten
von Kapuzinerheiligen des XVII. und
XVIII. Jahrhunderts, die unter Glas-
stürzen in der Sakristei des Redentore zu
Venedig bewahrt werden, angeblich zum
Teil Werke von Ordensbrüdern. Es sind
höchst realistische Darstellungen nach
dem Leben darunter, die ohne weiteres
als Porträtstudien aufgefaßt werden
können; einzelne davon sind künstlerisch
recht hoch zu stellen; die hier gegebenen
Abbildungen (Fig. 48—51) geben nur
einen sehr unvollkommenen Begriff ihrer
Wirkung.2
Die Keroplastik hat im XVIII. Jahr-
hundert nicht nur auf diesem engeren
Gebiete eine lange Nachblüte gehabt. Sie
wetteifert sowohl mit der großen Skulptur
überhaupt, als auch namentlich mit der
modischen Kleinplastik des Porzellans.
Sehr graziöse Proben der letzteren Art
befinden sich im herzoglichen Museum
zu Braunschweig. Es sind meist Arbeiten
von Christ. Friedr. Rauschner aus Naum-
burg (1725—1793). Die Technik verleug-
net auch auf diesem Felde nicht immer
den ihr inhärenten Zug zum Naturalismus.
Beispiele dafür sind in den alten Samm-
lungen nicht selten zu finden; zu den
häufigsten gehören kleine Büstchen alter
Weiber mit natürlichen Haaren, Runzeln
und anderen Zeichen des Verfalls auf der
ledergelben Haut, die das Wachs besonders natürlich wiederzugeben imstande ist. Ein aus Ambras
stammendes Beispiel des Wiener Hofmuseums (Fig. 52) diene hier als Repräsentant der Gattung. Das
Fig. 46. Frauenbüstchen.
(Graz, Joanneum).
seinem Besitz, rührt von dem steirischen Medailleur Sebastian Irrwoch (lrwasch) her (von i8o3). Nach diesem ist das Titel-
kupfer zu den Biographischen Notizen von J. Haydn (Wien 1810) angefertigt, die Haydns Eckermann, den Landschafter Dies
zum Verfasser haben. Heute ist es im Besitze der Witwe des Bildhauers Natter in Wien (Abb. in dem obeneiwähnten Auf-
satze von Tandler, S. 268). Über Irrwoch, an den man indessen kaum als Autor der beiden Büsten denken wird, vgl. Wurz-
bach, Biograph. Lexikon X, 293.
1 Das miniaturartige Reliefporträt in Wachs hat auch während des XVIII. Jahrhunderts weitergeblüht. Sehr hübsche
Proben der Kunst des auch von Goethe bewunderten Kaspar Hardy (1726—1819), eines Kölner Geistlichen, sind im Con-
npisseur, Vol. VIII (1904), 135 f., abgebildet und besprochen. Andere meist englische Kleinarbeiten aus der Sammlung Lewis
Harcourt ebenda, 1910, p. 135 f.
2 Die Kunstkammer des Stiftes Kremsmünster bewahrt zwei in Wachs bossierte Köpfe der Apostelfürsten, gute Ar-
beiten des XVIII. Jahrhunderts. Sie gehören jedoch nur dem Gegenstand nach in diese Reihe. Vgl. den Aufsatz von Ubell:
Kunst und Kunsthandwerk 1910, 384 (mit Abb.) und die Vignette am Schlüsse dieses Kapitels (Fig. 47).