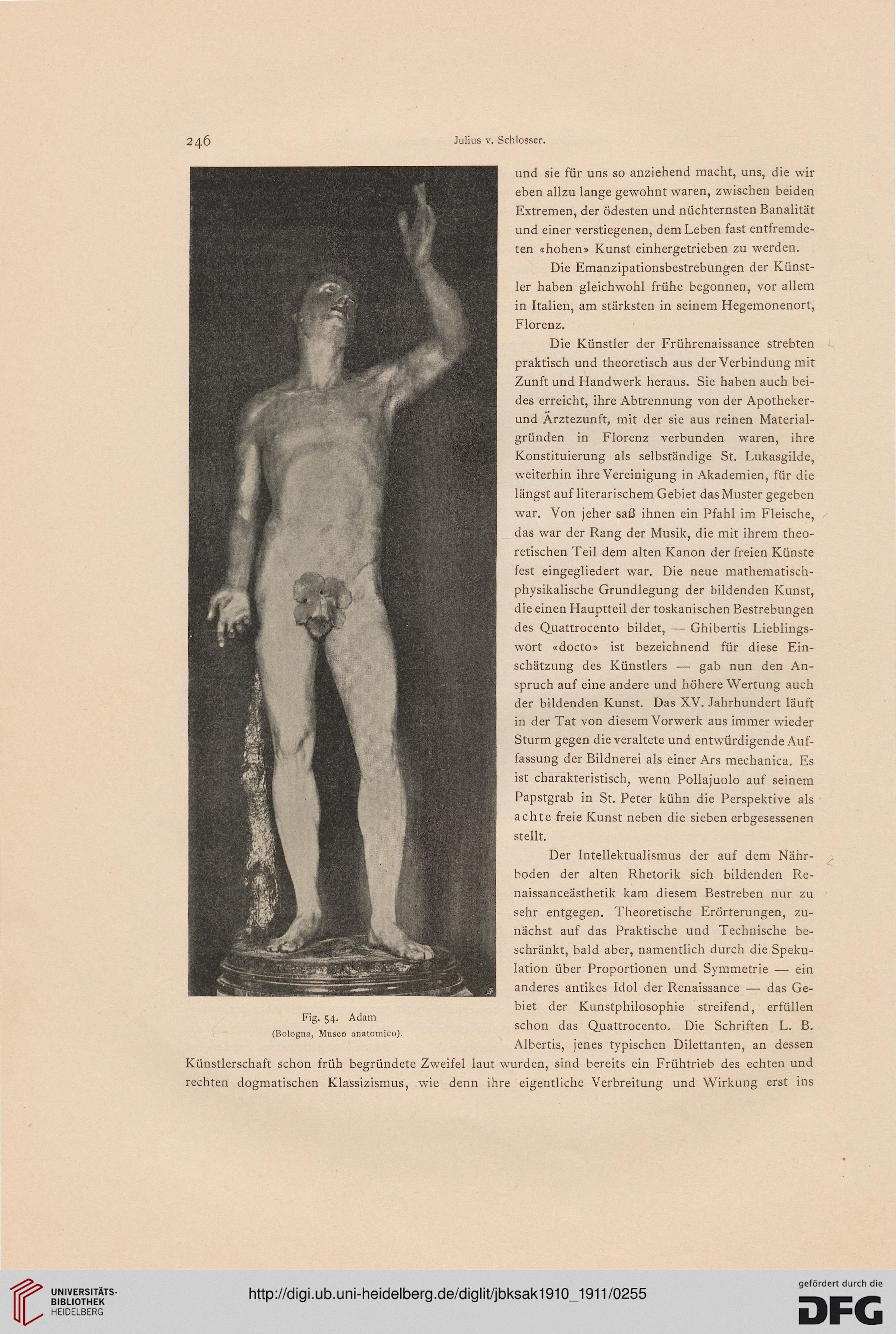246
Julius v. Schlosser.
und sie für uns so anziehend macht, uns, die wir
eben allzu lange gewohnt waren, zwischen beiden
Extremen, der ödesten und nüchternsten Banalität
und einer verstiegenen, dem Leben fast entfremde-
ten «hohen» Kunst einhergetrieben zu werden.
Die Emanzipationsbestrebungen der Künst-
ler haben gleichwohl frühe begonnen, vor allem
in Italien, am stärksten in seinem Hegemonenort,
Florenz.
Die Künstler der Frührenaissance strebten
praktisch und theoretisch aus der Verbindung mit
Zunft und Handwerk heraus. Sie haben auch bei-
des erreicht, ihre Abtrennung von der Apotheker-
und Arztezunft, mit der sie aus reinen Material-
gründen in Florenz verbunden waren, ihre
Konstituierung als selbständige St. Lukasgilde,
weiterhin ihre Vereinigung in Akademien, für die
längst auf literarischem Gebiet das Muster gegeben
war. Von jeher saß ihnen ein Pfahl im Fleische,
das war der Rang der Musik, die mit ihrem theo-
retischen Teil dem alten Kanon der freien Künste
fest eingegliedert war. Die neue mathematisch-
physikalische Grundlegung der bildenden Kunst,
die einen Hauptteil der toskanischen Bestrebungen
des Quattrocento bildet, — Ghibertis Lieblings-
wort «docto» ist bezeichnend für diese Ein-
schätzung des Künstlers — gab nun den An-
spruch auf eine andere und höhere Wertung auch
der bildenden Kunst. Das XV. Jahrhundert läuft
in der Tat von diesem Vorwerk aus immer wieder
Sturm gegen die veraltete und entwürdigende Auf-
fassung der Bildnerei als einer Ars mechanica. Es
ist charakteristisch, wenn Pollajuolo auf seinem
Papstgrab in St. Peter kühn die Perspektive als
achte freie Kunst neben die sieben erbgesessenen
stellt.
Der Intellektualismus der auf dem Nähr-
boden der alten Rhetorik sich bildenden Re-
naissanceästhetik kam diesem Bestreben nur zu
sehr entgegen. Theoretische Erörterungen, zu-
nächst auf das Praktische und Technische be-
schränkt, bald aber, namentlich durch die Speku-
lation über Proportionen und Symmetrie — ein
anderes antikes Idol der Renaissance — das Ge-
biet der Kunstphilosophie streifend, erfüllen
schon das Quattrocento. Die Schriften L. B.
Albertis, jenes typischen Dilettanten, an dessen
Künstlerschaft schon früh begründete Zweifel laut wurden, sind bereits ein Frühtrieb des echten und
rechten dogmatischen Klassizismus, wie denn ihre eigentliche Verbreitung und Wirkung erst ins
Fig. 54. Adam
(Bologna, Museo anatomico).
Julius v. Schlosser.
und sie für uns so anziehend macht, uns, die wir
eben allzu lange gewohnt waren, zwischen beiden
Extremen, der ödesten und nüchternsten Banalität
und einer verstiegenen, dem Leben fast entfremde-
ten «hohen» Kunst einhergetrieben zu werden.
Die Emanzipationsbestrebungen der Künst-
ler haben gleichwohl frühe begonnen, vor allem
in Italien, am stärksten in seinem Hegemonenort,
Florenz.
Die Künstler der Frührenaissance strebten
praktisch und theoretisch aus der Verbindung mit
Zunft und Handwerk heraus. Sie haben auch bei-
des erreicht, ihre Abtrennung von der Apotheker-
und Arztezunft, mit der sie aus reinen Material-
gründen in Florenz verbunden waren, ihre
Konstituierung als selbständige St. Lukasgilde,
weiterhin ihre Vereinigung in Akademien, für die
längst auf literarischem Gebiet das Muster gegeben
war. Von jeher saß ihnen ein Pfahl im Fleische,
das war der Rang der Musik, die mit ihrem theo-
retischen Teil dem alten Kanon der freien Künste
fest eingegliedert war. Die neue mathematisch-
physikalische Grundlegung der bildenden Kunst,
die einen Hauptteil der toskanischen Bestrebungen
des Quattrocento bildet, — Ghibertis Lieblings-
wort «docto» ist bezeichnend für diese Ein-
schätzung des Künstlers — gab nun den An-
spruch auf eine andere und höhere Wertung auch
der bildenden Kunst. Das XV. Jahrhundert läuft
in der Tat von diesem Vorwerk aus immer wieder
Sturm gegen die veraltete und entwürdigende Auf-
fassung der Bildnerei als einer Ars mechanica. Es
ist charakteristisch, wenn Pollajuolo auf seinem
Papstgrab in St. Peter kühn die Perspektive als
achte freie Kunst neben die sieben erbgesessenen
stellt.
Der Intellektualismus der auf dem Nähr-
boden der alten Rhetorik sich bildenden Re-
naissanceästhetik kam diesem Bestreben nur zu
sehr entgegen. Theoretische Erörterungen, zu-
nächst auf das Praktische und Technische be-
schränkt, bald aber, namentlich durch die Speku-
lation über Proportionen und Symmetrie — ein
anderes antikes Idol der Renaissance — das Ge-
biet der Kunstphilosophie streifend, erfüllen
schon das Quattrocento. Die Schriften L. B.
Albertis, jenes typischen Dilettanten, an dessen
Künstlerschaft schon früh begründete Zweifel laut wurden, sind bereits ein Frühtrieb des echten und
rechten dogmatischen Klassizismus, wie denn ihre eigentliche Verbreitung und Wirkung erst ins
Fig. 54. Adam
(Bologna, Museo anatomico).