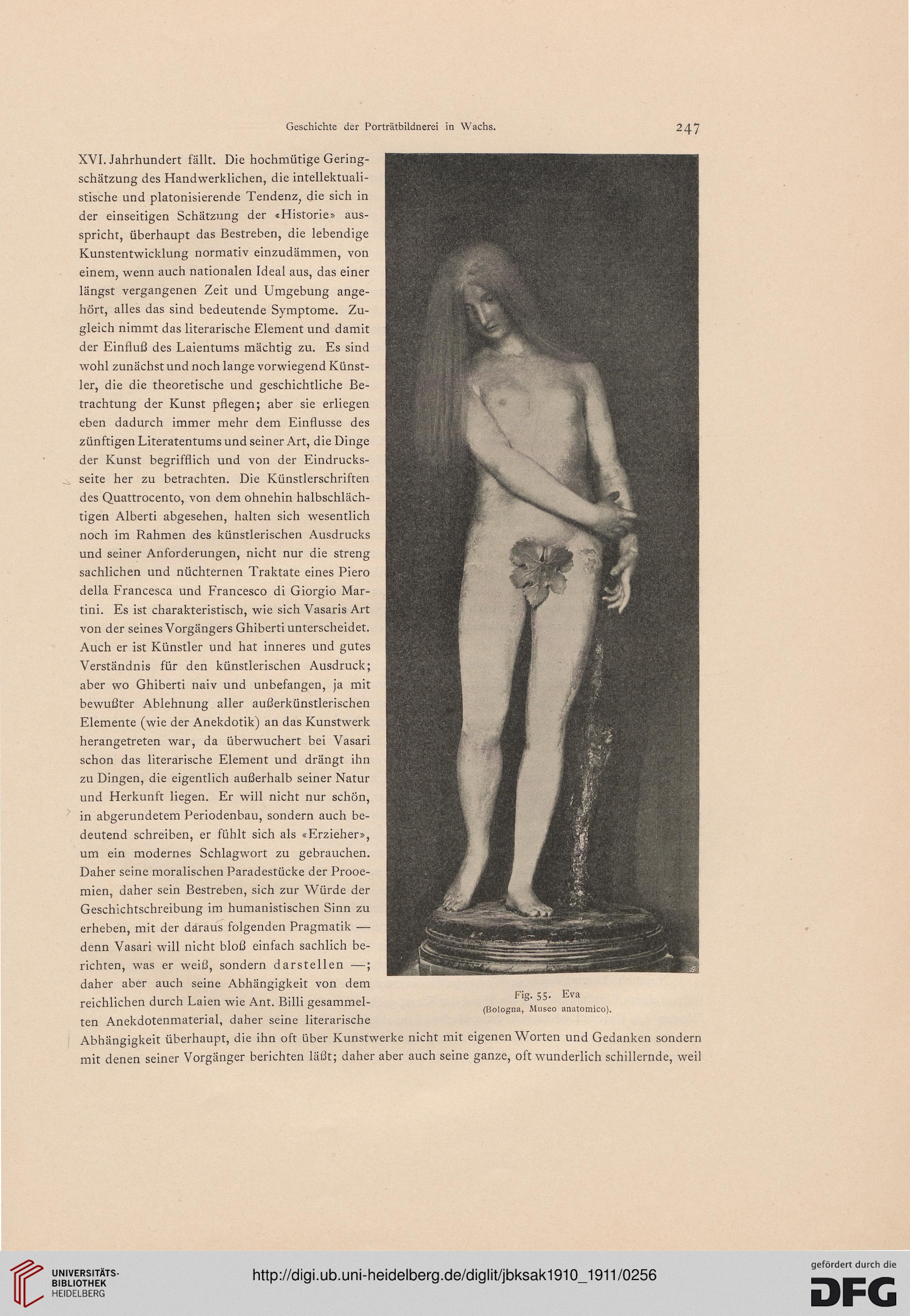Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.
247
XVI. Jahrhundert fällt. Die hochmütige Gering-
schätzung des Handwerklichen, die intellektuali-
stische und platonisierende Tendenz, die sich in
der einseitigen Schätzung der «Historie» aus-
spricht, überhaupt das Bestreben, die lebendige
Kunstentwicklung normativ einzudämmen, von
einem, wenn auch nationalen Ideal aus, das einer
längst vergangenen Zeit und Umgebung ange-
hört, alles das sind bedeutende Symptome. Zu-
gleich nimmt das literarische Element und damit
der Einfluß des Laientums mächtig zu. Es sind
wohl zunächst und noch lange vorwiegend Künst-
ler, die die theoretische und geschichtliche Be-
trachtung der Kunst pflegen; aber sie erliegen
eben dadurch immer mehr dem Einflüsse des
zünftigen Literatentums und seiner Art, die Dinge
der Kunst begrifflich und von der Eindrucks-
seite her zu betrachten. Die Künstlerschriften
des Quattrocento, von dem ohnehin halbschläch-
tigen Alberti abgesehen, halten sich wesentlich
noch im Rahmen des künstlerischen Ausdrucks
und seiner Anforderungen, nicht nur die streng
sachlichen und nüchternen Traktate eines Piero
della Francesca und Francesco di Giorgio Mar-
tini. Es ist charakteristisch, wie sich Vasaris Art
von der seines Vorgängers Ghiberti unterscheidet.
Auch er ist Künstler und hat inneres und gutes
Verständnis für den künstlerischen Ausdruck;
aber wo Ghiberti naiv und unbefangen, ja mit
bewußter Ablehnung aller außerkünstlerischen
Elemente (wie der Anekdotik) an das Kunstwerk
herangetreten war, da überwuchert bei Vasari
schon das literarische Element und drängt ihn
zu Dingen, die eigentlich außerhalb seiner Natur
und Herkunft liegen. Er will nicht nur schön,
in abgerundetem Periodenbau, sondern auch be-
deutend schreiben, er fühlt sich als «Erzieher»,
um ein modernes Schlagwort zu gebrauchen.
Daher seine moralischen Paradestücke der Prooe-
mien, daher sein Bestreben, sich zur Würde der
Geschichtschreibung im humanistischen Sinn zu
erheben, mit der daraus folgenden Pragmatik —
denn Vasari will nicht bloß einfach sachlich be-
richten, was er weiß, sondern darstellen —;
daher aber auch seine Abhängigkeit von dem
reichlichen durch Laien wie Ant. Billi gesammel-
ten Anekdotenmaterial, daher seine literarische
Abhängigkeit überhaupt, die ihn oft über Kunstwerke nicht mit eigenen Worten und Gedanken sondern
mit denen seiner Vorgänger berichten läßt; daher aber auch seine ganze, oft wunderlich schillernde, weil
Fig. 55. Eva
(Bologna, Masco anutomico).
247
XVI. Jahrhundert fällt. Die hochmütige Gering-
schätzung des Handwerklichen, die intellektuali-
stische und platonisierende Tendenz, die sich in
der einseitigen Schätzung der «Historie» aus-
spricht, überhaupt das Bestreben, die lebendige
Kunstentwicklung normativ einzudämmen, von
einem, wenn auch nationalen Ideal aus, das einer
längst vergangenen Zeit und Umgebung ange-
hört, alles das sind bedeutende Symptome. Zu-
gleich nimmt das literarische Element und damit
der Einfluß des Laientums mächtig zu. Es sind
wohl zunächst und noch lange vorwiegend Künst-
ler, die die theoretische und geschichtliche Be-
trachtung der Kunst pflegen; aber sie erliegen
eben dadurch immer mehr dem Einflüsse des
zünftigen Literatentums und seiner Art, die Dinge
der Kunst begrifflich und von der Eindrucks-
seite her zu betrachten. Die Künstlerschriften
des Quattrocento, von dem ohnehin halbschläch-
tigen Alberti abgesehen, halten sich wesentlich
noch im Rahmen des künstlerischen Ausdrucks
und seiner Anforderungen, nicht nur die streng
sachlichen und nüchternen Traktate eines Piero
della Francesca und Francesco di Giorgio Mar-
tini. Es ist charakteristisch, wie sich Vasaris Art
von der seines Vorgängers Ghiberti unterscheidet.
Auch er ist Künstler und hat inneres und gutes
Verständnis für den künstlerischen Ausdruck;
aber wo Ghiberti naiv und unbefangen, ja mit
bewußter Ablehnung aller außerkünstlerischen
Elemente (wie der Anekdotik) an das Kunstwerk
herangetreten war, da überwuchert bei Vasari
schon das literarische Element und drängt ihn
zu Dingen, die eigentlich außerhalb seiner Natur
und Herkunft liegen. Er will nicht nur schön,
in abgerundetem Periodenbau, sondern auch be-
deutend schreiben, er fühlt sich als «Erzieher»,
um ein modernes Schlagwort zu gebrauchen.
Daher seine moralischen Paradestücke der Prooe-
mien, daher sein Bestreben, sich zur Würde der
Geschichtschreibung im humanistischen Sinn zu
erheben, mit der daraus folgenden Pragmatik —
denn Vasari will nicht bloß einfach sachlich be-
richten, was er weiß, sondern darstellen —;
daher aber auch seine Abhängigkeit von dem
reichlichen durch Laien wie Ant. Billi gesammel-
ten Anekdotenmaterial, daher seine literarische
Abhängigkeit überhaupt, die ihn oft über Kunstwerke nicht mit eigenen Worten und Gedanken sondern
mit denen seiner Vorgänger berichten läßt; daher aber auch seine ganze, oft wunderlich schillernde, weil
Fig. 55. Eva
(Bologna, Masco anutomico).