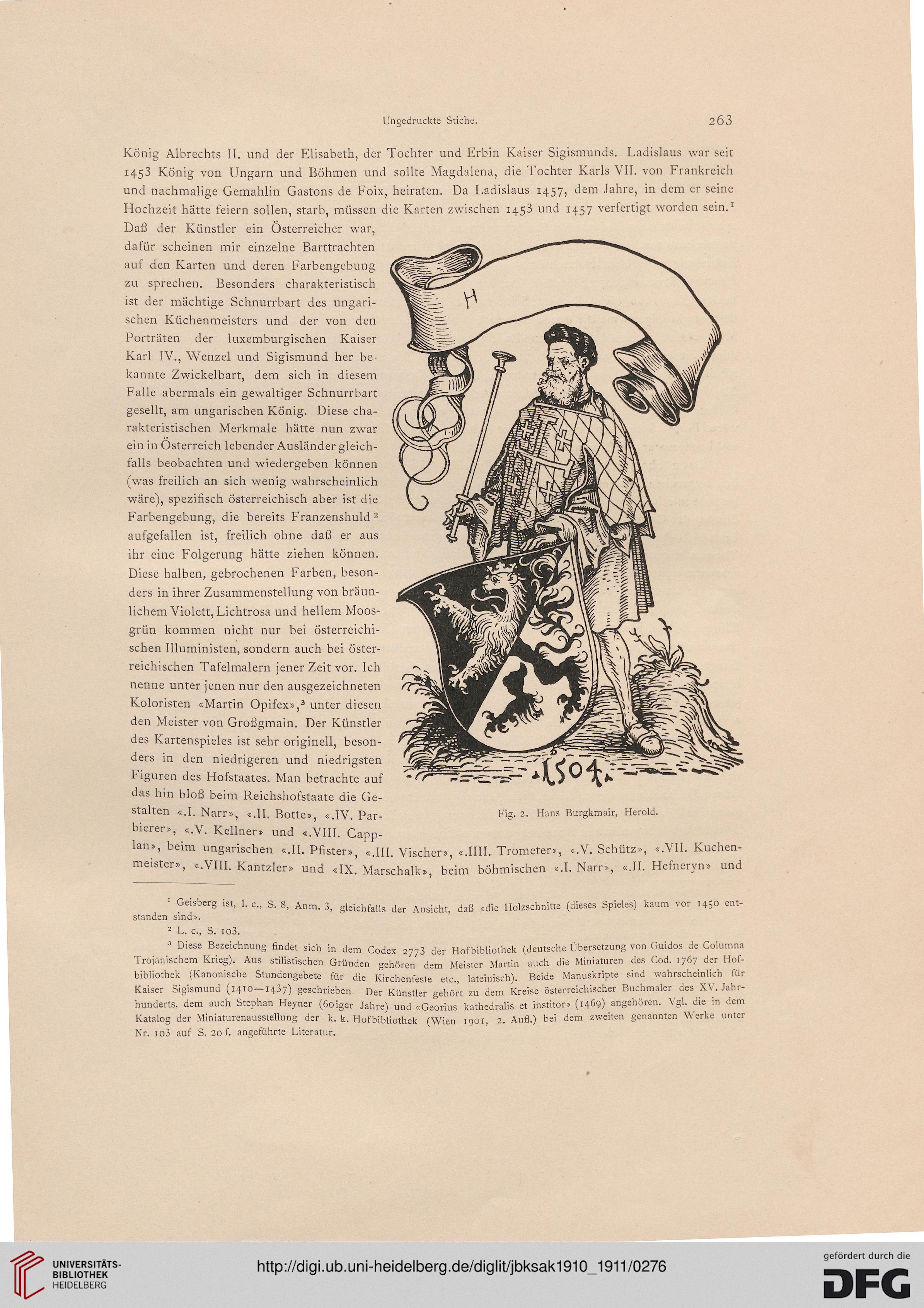Ungedruckte Stiche.
263
König Albrechts II. und der Elisabeth, der Tochter und Erbin Kaiser Sigismunds. Ladislaus war seit
1453 König von Ungarn und Böhmen und sollte Magdalena, die Tochter Karls VII. von Frankreich
und nachmalige Gemahlin Gastons de Foix, heiraten. Da Ladislaus 1457, dem Jahre, in dem er seine
Hochzeit hätte feiern sollen, starb, müssen die Karten zwischen 1453 und 1457 verfertigt worden sein.1
Daß der Künstler ein Österreicher war,
dafür scheinen mir einzelne Barttrachten
auf den Karten und deren Farbengebung
zu sprechen. Besonders charakteristisch
ist der mächtige Schnurrbart des ungari-
schen Küchenmeisters und der von den
Porträten der luxemburgischen Kaiser
Karl IV., Wenzel und Sigismund her be-
kannte Zwickelbart, dem sich in diesem
Falle abermals ein gewaltiger Schnurrbart
gesellt, am ungarischen König. Diese cha-
rakteristischen Merkmale hätte nun zwar
ein in Osterreich lebender Ausländer gleich-
falls beobachten und wiedergeben können
(was freilich an sich wenig wahrscheinlich
wäre), spezifisch österreichisch aber ist die
Farbengebung, die bereits Franzenshuld2
aufgefallen ist, freilich ohne daß er aus
ihr eine Folgerung hätte ziehen können.
Diese halben, gebrochenen Farben, beson-
ders in ihrer Zusammenstellung von bräun-
lichem Violett, Lichtrosa und hellem Moos-
grün kommen nicht nur bei österreichi-
schen Illuministen, sondern auch bei öster-
reichischen Tafelmalern jener Zeit vor. Ich
nenne unter jenen nur den ausgezeichneten
Koloristen «Martin Opifex»,3 unter diesen
den Meister von Großgmain. Der Künstler
des Kartenspieles ist sehr originell, beson-
ders in den niedrigeren und niedrigsten
Figuren des Hofstaates. Man betrachte auf
das hin bloß beim Reichshofstaate die Ge-
stalten «.I.Narr», «.II. Botte», «.IV. Par-
bierer», «.V. Kellner» und «.VIII. Capp-
Fig. 2. Hans Burgkmair, Herold.
lan», beim ungarischen «.II. Pfister», «.III. Vischer», «.IUI. Trometer», «.V. Schütz», «.VII. Kuchen-
meister., «.VIII. Kantzier» und «IX. Marschalk», beim böhmischen «.I. Narr», «.II. Hefneryn» und
1 Geisberg ist, 1. c, S. 8, Anm. 3, gleichfalls der Ansicht, daß «die Holzschnitte (dieses Spieles) kaum vor 1450 ent-
standen sind».
2 L. c, S. io3.
' Diese Bezeichnung findet sich in dem Codex 2773 der Hofbibliothek (deutsche Übersetzung von Guidos de Columna
Trojanischem Krieg). Aus stilistischen Gründen gehören dem Meister Martin auch die Miniaturen des Cod. 1767 der Hof-
bibliothek (Kanonische Stundengebete für die Kirchenfeste etc., lateinisch). Beide Manuskripte sind wahrschcinl.ch für
Kaiser Sigismund (1410-1437) geschrieben. Der Künstler gehört zu dem Kreise österreichischer Buchmaler des XV. Jahr-
hunderts, dem auch Stephan Heyner (Ooiger Jahre) und «Georius kathedralis et institor» (1469) angehören. VgL dte in dem
Katalog der Miniaturenausstellung der k. k. Hofbibliothek (Wien 1901, 2. Aufl.) bei dem zweiten genannten Werke unter
Nr. io3 auf S. 20 f. angeführte Literatur.
263
König Albrechts II. und der Elisabeth, der Tochter und Erbin Kaiser Sigismunds. Ladislaus war seit
1453 König von Ungarn und Böhmen und sollte Magdalena, die Tochter Karls VII. von Frankreich
und nachmalige Gemahlin Gastons de Foix, heiraten. Da Ladislaus 1457, dem Jahre, in dem er seine
Hochzeit hätte feiern sollen, starb, müssen die Karten zwischen 1453 und 1457 verfertigt worden sein.1
Daß der Künstler ein Österreicher war,
dafür scheinen mir einzelne Barttrachten
auf den Karten und deren Farbengebung
zu sprechen. Besonders charakteristisch
ist der mächtige Schnurrbart des ungari-
schen Küchenmeisters und der von den
Porträten der luxemburgischen Kaiser
Karl IV., Wenzel und Sigismund her be-
kannte Zwickelbart, dem sich in diesem
Falle abermals ein gewaltiger Schnurrbart
gesellt, am ungarischen König. Diese cha-
rakteristischen Merkmale hätte nun zwar
ein in Osterreich lebender Ausländer gleich-
falls beobachten und wiedergeben können
(was freilich an sich wenig wahrscheinlich
wäre), spezifisch österreichisch aber ist die
Farbengebung, die bereits Franzenshuld2
aufgefallen ist, freilich ohne daß er aus
ihr eine Folgerung hätte ziehen können.
Diese halben, gebrochenen Farben, beson-
ders in ihrer Zusammenstellung von bräun-
lichem Violett, Lichtrosa und hellem Moos-
grün kommen nicht nur bei österreichi-
schen Illuministen, sondern auch bei öster-
reichischen Tafelmalern jener Zeit vor. Ich
nenne unter jenen nur den ausgezeichneten
Koloristen «Martin Opifex»,3 unter diesen
den Meister von Großgmain. Der Künstler
des Kartenspieles ist sehr originell, beson-
ders in den niedrigeren und niedrigsten
Figuren des Hofstaates. Man betrachte auf
das hin bloß beim Reichshofstaate die Ge-
stalten «.I.Narr», «.II. Botte», «.IV. Par-
bierer», «.V. Kellner» und «.VIII. Capp-
Fig. 2. Hans Burgkmair, Herold.
lan», beim ungarischen «.II. Pfister», «.III. Vischer», «.IUI. Trometer», «.V. Schütz», «.VII. Kuchen-
meister., «.VIII. Kantzier» und «IX. Marschalk», beim böhmischen «.I. Narr», «.II. Hefneryn» und
1 Geisberg ist, 1. c, S. 8, Anm. 3, gleichfalls der Ansicht, daß «die Holzschnitte (dieses Spieles) kaum vor 1450 ent-
standen sind».
2 L. c, S. io3.
' Diese Bezeichnung findet sich in dem Codex 2773 der Hofbibliothek (deutsche Übersetzung von Guidos de Columna
Trojanischem Krieg). Aus stilistischen Gründen gehören dem Meister Martin auch die Miniaturen des Cod. 1767 der Hof-
bibliothek (Kanonische Stundengebete für die Kirchenfeste etc., lateinisch). Beide Manuskripte sind wahrschcinl.ch für
Kaiser Sigismund (1410-1437) geschrieben. Der Künstler gehört zu dem Kreise österreichischer Buchmaler des XV. Jahr-
hunderts, dem auch Stephan Heyner (Ooiger Jahre) und «Georius kathedralis et institor» (1469) angehören. VgL dte in dem
Katalog der Miniaturenausstellung der k. k. Hofbibliothek (Wien 1901, 2. Aufl.) bei dem zweiten genannten Werke unter
Nr. io3 auf S. 20 f. angeführte Literatur.