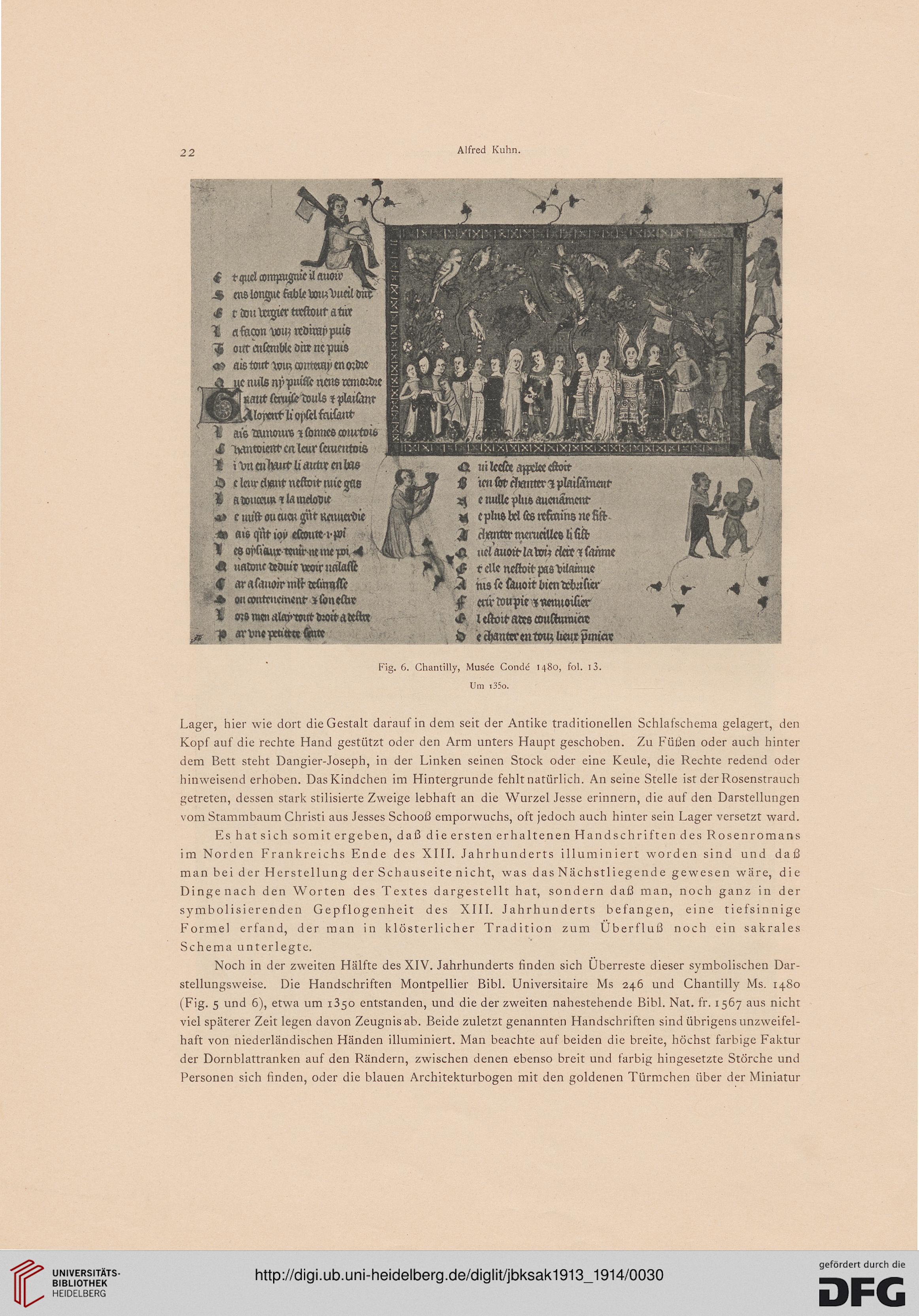22
Alfred Kuhn.
4
«
f
1»
t<picl compugtue il aumr
nie iongut fable tomlwftl
t aoutogurttcflOMtatttt
afiaccm lau? rcörcat>put$
otrrcnftniWc Otttncpw's
nute nppnöfc neue ommiae
smtt (tmjfetoulö f plauttw
at'e uunoure1 (btmee wmiow
ThÄntoUitt entattr (entnitots
i tm tnlwwt U Aubx en 6ae
c Iciur dptt neflmt tute gas
atoitccuttilamdrtur
c uu'ft ou aw« gut Kouwöie
«»& q*rtt iov tßoutt-i-n«-
CO opfi&ur wuiV'iit int pi, <4
uatonc ttouiT vcotrualofle
ar afaiwir mtt tc&raflc
onoMUTuement »tbncfhr
rooi üiaptmit teottaicfttt
<Q ni Iccfit a^pdec eftotr
ten fet> cltttitcr 31 plaißment
c nulle plus aucuÄmeut
c plne W (es ttfarihs nr fift-
rlxmttrmoitciUcelifift
uetauott lato» detc t fttnme
t eile neflottjÄS "Warane
iw» fc ftuott Iiicn tefctfter'
f ewloupit »wtwoiGer
itflortates CDußunutte
ö e cfymtwcntmu ueur ptnt'i
T
Fig. 6. Chantilly, Musee Conde 1480, fol. l3.
Um i35o.
Lager, hier wie dort die Gestalt darauf in dem seit der Antike traditionellen Schlafschema gelagert, den
Kopf auf die rechte Hand gestützt oder den Arm unters Haupt geschoben. Zu Füßen oder auch hinter
dem Bett steht Dangier-Joseph, in der Linken seinen Stock oder eine Keule, die Rechte redend oder
hinweisend erhoben. Das Kindchen im Hintergrunde fehlt natürlich. An seine Stelle ist der Rosenstrauch
getreten, dessen stark stilisierte Zweige lebhaft an die Wurzel Jesse erinnern, die auf den Darstellungen
vom Stammbaum Christi aus Jesses Schooß emporwuchs, oft jedoch auch hinter sein Lager versetzt ward.
Es hat sich somit ergeben, daß die ersten erhaltenen Handschriften des Rosenromans
im Norden Frankreichs Ende des XIII. Jahrhunderts illuminiert worden sind und daß
man bei der Herstellung der Schauseite nicht, was dasNächstliegende gewesen wäre, die
Dingenach den Worten des Textes dargestellt hat, sondern daß man, noch ganz in der
symbolisierenden Gepflogenheit des XIII. Jahrhunderts befangen, eine tiefsinnige
Formel erfand, der man in klösterlicher Tradition zum Uberfluß noch ein sakrales
Schema unterlegte.
Noch in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts finden sich Uberreste dieser symbolischen Dar-
stellungsweise. Die Handschriften Montpellier Bibl. Universitaire Ms 246 und Chantilly Ms. 1480
(Fig. 5 und 6), etwa um 1350 entstanden, und die der zweiten nahestehende Bibl. Nat. fr. 1567 aus nicht
viel späterer Zeit legen davon Zeugnis ab. Beide zuletzt genannten Handschriften sind übrigens unzweifel-
haft von niederländischen Händen illuminiert. Man beachte auf beiden die breite, höchst farbige Faktur
der Dornblattranken auf den Rändern, zwischen denen ebenso breit und farbig hingesetzte Störche und
Personen sich finden, oder die blauen Architekturbogen mit den goldenen Türmchen über der Miniatur
Alfred Kuhn.
4
«
f
1»
t<picl compugtue il aumr
nie iongut fable tomlwftl
t aoutogurttcflOMtatttt
afiaccm lau? rcörcat>put$
otrrcnftniWc Otttncpw's
nute nppnöfc neue ommiae
smtt (tmjfetoulö f plauttw
at'e uunoure1 (btmee wmiow
ThÄntoUitt entattr (entnitots
i tm tnlwwt U Aubx en 6ae
c Iciur dptt neflmt tute gas
atoitccuttilamdrtur
c uu'ft ou aw« gut Kouwöie
«»& q*rtt iov tßoutt-i-n«-
CO opfi&ur wuiV'iit int pi, <4
uatonc ttouiT vcotrualofle
ar afaiwir mtt tc&raflc
onoMUTuement »tbncfhr
rooi üiaptmit teottaicfttt
<Q ni Iccfit a^pdec eftotr
ten fet> cltttitcr 31 plaißment
c nulle plus aucuÄmeut
c plne W (es ttfarihs nr fift-
rlxmttrmoitciUcelifift
uetauott lato» detc t fttnme
t eile neflottjÄS "Warane
iw» fc ftuott Iiicn tefctfter'
f ewloupit »wtwoiGer
itflortates CDußunutte
ö e cfymtwcntmu ueur ptnt'i
T
Fig. 6. Chantilly, Musee Conde 1480, fol. l3.
Um i35o.
Lager, hier wie dort die Gestalt darauf in dem seit der Antike traditionellen Schlafschema gelagert, den
Kopf auf die rechte Hand gestützt oder den Arm unters Haupt geschoben. Zu Füßen oder auch hinter
dem Bett steht Dangier-Joseph, in der Linken seinen Stock oder eine Keule, die Rechte redend oder
hinweisend erhoben. Das Kindchen im Hintergrunde fehlt natürlich. An seine Stelle ist der Rosenstrauch
getreten, dessen stark stilisierte Zweige lebhaft an die Wurzel Jesse erinnern, die auf den Darstellungen
vom Stammbaum Christi aus Jesses Schooß emporwuchs, oft jedoch auch hinter sein Lager versetzt ward.
Es hat sich somit ergeben, daß die ersten erhaltenen Handschriften des Rosenromans
im Norden Frankreichs Ende des XIII. Jahrhunderts illuminiert worden sind und daß
man bei der Herstellung der Schauseite nicht, was dasNächstliegende gewesen wäre, die
Dingenach den Worten des Textes dargestellt hat, sondern daß man, noch ganz in der
symbolisierenden Gepflogenheit des XIII. Jahrhunderts befangen, eine tiefsinnige
Formel erfand, der man in klösterlicher Tradition zum Uberfluß noch ein sakrales
Schema unterlegte.
Noch in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts finden sich Uberreste dieser symbolischen Dar-
stellungsweise. Die Handschriften Montpellier Bibl. Universitaire Ms 246 und Chantilly Ms. 1480
(Fig. 5 und 6), etwa um 1350 entstanden, und die der zweiten nahestehende Bibl. Nat. fr. 1567 aus nicht
viel späterer Zeit legen davon Zeugnis ab. Beide zuletzt genannten Handschriften sind übrigens unzweifel-
haft von niederländischen Händen illuminiert. Man beachte auf beiden die breite, höchst farbige Faktur
der Dornblattranken auf den Rändern, zwischen denen ebenso breit und farbig hingesetzte Störche und
Personen sich finden, oder die blauen Architekturbogen mit den goldenen Türmchen über der Miniatur