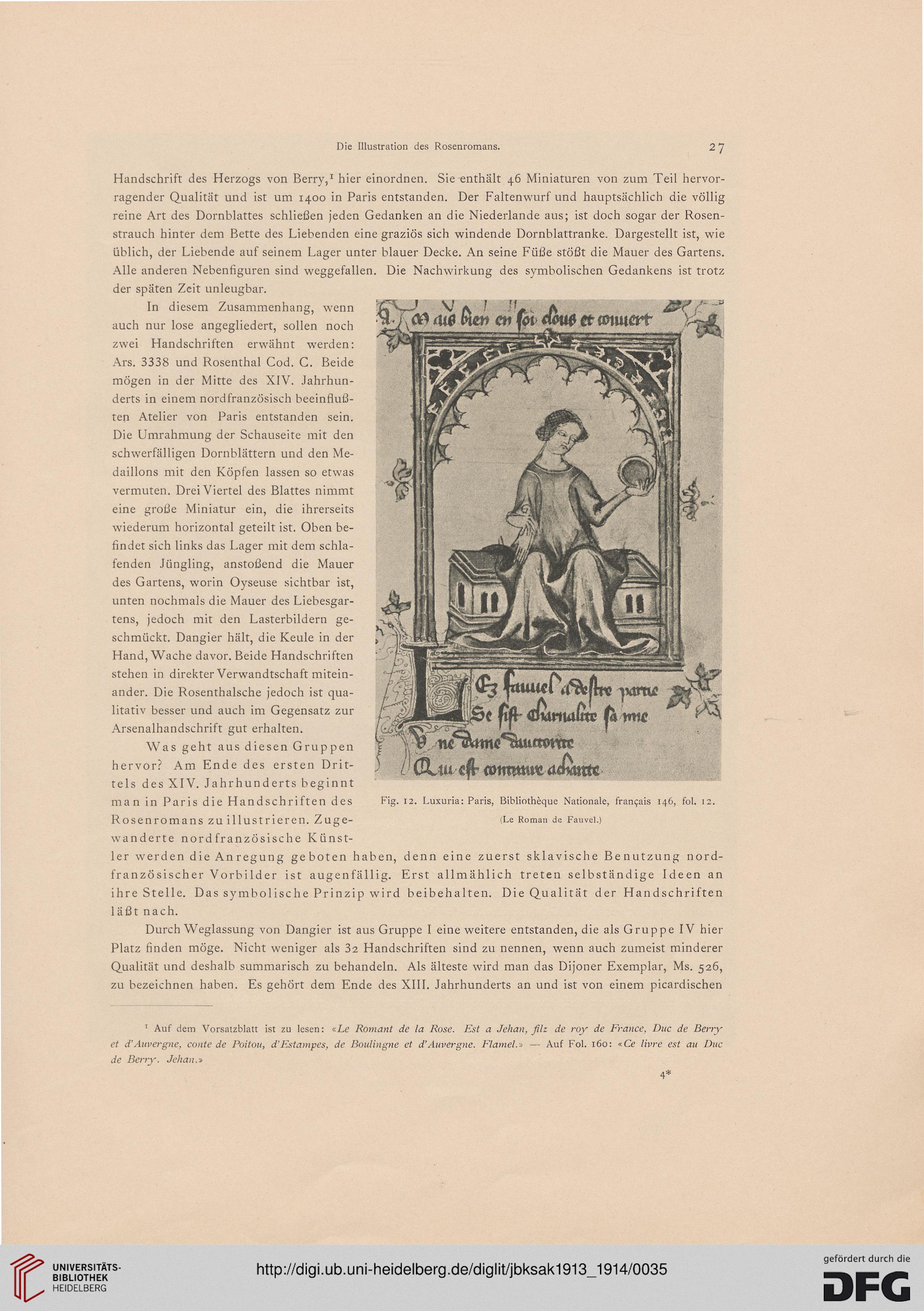Die Illustration des Rosenromans.
27
Handschrift des Herzogs von Berry,1 hier einordnen. Sie enthält 46 Miniaturen von zum Teil hervor-
ragender Qualität und ist um 1400 in Paris entstanden. Der Faltenwurf und hauptsächlich die völlig
reine Art des Dornblattes schließen jeden Gedanken an die Niederlande aus; ist doch sogar der Rosen-
strauch hinter dem Bette des Liebenden eine graziös sich windende Dornblattranke. Dargestellt ist, wie
üblich, der Liebende auf seinem Lager unter blauer Decke. An seine Füße stößt die Mauer des Gartens.
Alle anderen Nebenfiguren sind weggefallen. Die Nachwirkung des symbolischen Gedankens ist trotz
der späten Zeit unleugbar.
In diesem Zusammenhang, wenn
auch nur lose angegliedert, sollen noch
zwei Handschriften erwähnt werden:
Ars. 3338 und Rosenthal Cod. C. Beide
mögen in der Mitte des XIV. Jahrhun-
derts in einem nordfranzösisch beeinfluß-
ten Atelier von Paris entstanden sein.
Die Umrahmung der Schauseite mit den
schwerfälligen Dornblättern und den Me-
daillons mit den Köpfen lassen so etwas
vermuten. Dreiviertel des Blattes nimmt
eine große Miniatur ein, die ihrerseits
wiederum horizontal geteilt ist. Oben be-
findet sich links das Lager mit dem schla-
fenden Jüngling, anstoßend die Mauer
des Gartens, worin Oyseuse sichtbar ist,
unten nochmals die Mauer des Liebesgar-
tens, jedoch mit den Lasterbildern ge-
schmückt. Dangier hält, die Keule in der
Hand, Wache davor. Beide Handschriften
stehen in direkter Verwandtschaft mitein-
ander. Die Rosenthalsche jedoch ist qua-
litativ besser und auch im Gegensatz zur
Arsenalhandschrift gut erhalten.
Was geht aus diesen Gruppen
hervor? Am Ende des ersten Drit-
tels des XIV. Jahrhunderts beginnt
man in Paris die Handschriften des
Rosenromans zu illustrieren. Zuge-
wanderte nordfranzösische Künst-
ler werden die Anregung geboten haben, denn eine zuerst sklavische Benutzung nord-
französischer Vorbilder ist augenfällig. Erst allmählich treten selbständige Ideen an
ihre Stelle. Das symbolische Prinzip wird beibehalten. Die Qualität der Handschriften
läßt nach.
Durch Weglassung von Dangier ist aus Gruppe I eine weitere entstanden, die als Gruppe IV hier
Platz finden möge. Nicht weniger als 32 Handschriften sind zu nennen, wenn auch zumeist minderer
Qualität und deshalb summarisch zu behandeln. Als älteste wird man das Dijoner Exemplar, Ms. 526,
zu bezeichnen haben. Es gehört dem Ende des XIII. Jahrhunderts an und ist von einem picardischen
1 Auf dem Vorsatzblatt ist zu lesen: «Le Romant de la Rose. Est a Jehan, filz de roy de France, Duc de Berry
et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulingne et d'Auvergne. Flame!.> — Auf Fol. 160: «Ce livre est au Duc
de Berry. Jehan.*
4*
y tue feg» cn |<n <jW et mmert
^t- tfßtmafitc |k
Fig. 12. Luxuria: Paris, Bibliotheque Nationale, francais 146, fol. 12.
(Le Roman de Fauvel.)
27
Handschrift des Herzogs von Berry,1 hier einordnen. Sie enthält 46 Miniaturen von zum Teil hervor-
ragender Qualität und ist um 1400 in Paris entstanden. Der Faltenwurf und hauptsächlich die völlig
reine Art des Dornblattes schließen jeden Gedanken an die Niederlande aus; ist doch sogar der Rosen-
strauch hinter dem Bette des Liebenden eine graziös sich windende Dornblattranke. Dargestellt ist, wie
üblich, der Liebende auf seinem Lager unter blauer Decke. An seine Füße stößt die Mauer des Gartens.
Alle anderen Nebenfiguren sind weggefallen. Die Nachwirkung des symbolischen Gedankens ist trotz
der späten Zeit unleugbar.
In diesem Zusammenhang, wenn
auch nur lose angegliedert, sollen noch
zwei Handschriften erwähnt werden:
Ars. 3338 und Rosenthal Cod. C. Beide
mögen in der Mitte des XIV. Jahrhun-
derts in einem nordfranzösisch beeinfluß-
ten Atelier von Paris entstanden sein.
Die Umrahmung der Schauseite mit den
schwerfälligen Dornblättern und den Me-
daillons mit den Köpfen lassen so etwas
vermuten. Dreiviertel des Blattes nimmt
eine große Miniatur ein, die ihrerseits
wiederum horizontal geteilt ist. Oben be-
findet sich links das Lager mit dem schla-
fenden Jüngling, anstoßend die Mauer
des Gartens, worin Oyseuse sichtbar ist,
unten nochmals die Mauer des Liebesgar-
tens, jedoch mit den Lasterbildern ge-
schmückt. Dangier hält, die Keule in der
Hand, Wache davor. Beide Handschriften
stehen in direkter Verwandtschaft mitein-
ander. Die Rosenthalsche jedoch ist qua-
litativ besser und auch im Gegensatz zur
Arsenalhandschrift gut erhalten.
Was geht aus diesen Gruppen
hervor? Am Ende des ersten Drit-
tels des XIV. Jahrhunderts beginnt
man in Paris die Handschriften des
Rosenromans zu illustrieren. Zuge-
wanderte nordfranzösische Künst-
ler werden die Anregung geboten haben, denn eine zuerst sklavische Benutzung nord-
französischer Vorbilder ist augenfällig. Erst allmählich treten selbständige Ideen an
ihre Stelle. Das symbolische Prinzip wird beibehalten. Die Qualität der Handschriften
läßt nach.
Durch Weglassung von Dangier ist aus Gruppe I eine weitere entstanden, die als Gruppe IV hier
Platz finden möge. Nicht weniger als 32 Handschriften sind zu nennen, wenn auch zumeist minderer
Qualität und deshalb summarisch zu behandeln. Als älteste wird man das Dijoner Exemplar, Ms. 526,
zu bezeichnen haben. Es gehört dem Ende des XIII. Jahrhunderts an und ist von einem picardischen
1 Auf dem Vorsatzblatt ist zu lesen: «Le Romant de la Rose. Est a Jehan, filz de roy de France, Duc de Berry
et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulingne et d'Auvergne. Flame!.> — Auf Fol. 160: «Ce livre est au Duc
de Berry. Jehan.*
4*
y tue feg» cn |<n <jW et mmert
^t- tfßtmafitc |k
Fig. 12. Luxuria: Paris, Bibliotheque Nationale, francais 146, fol. 12.
(Le Roman de Fauvel.)