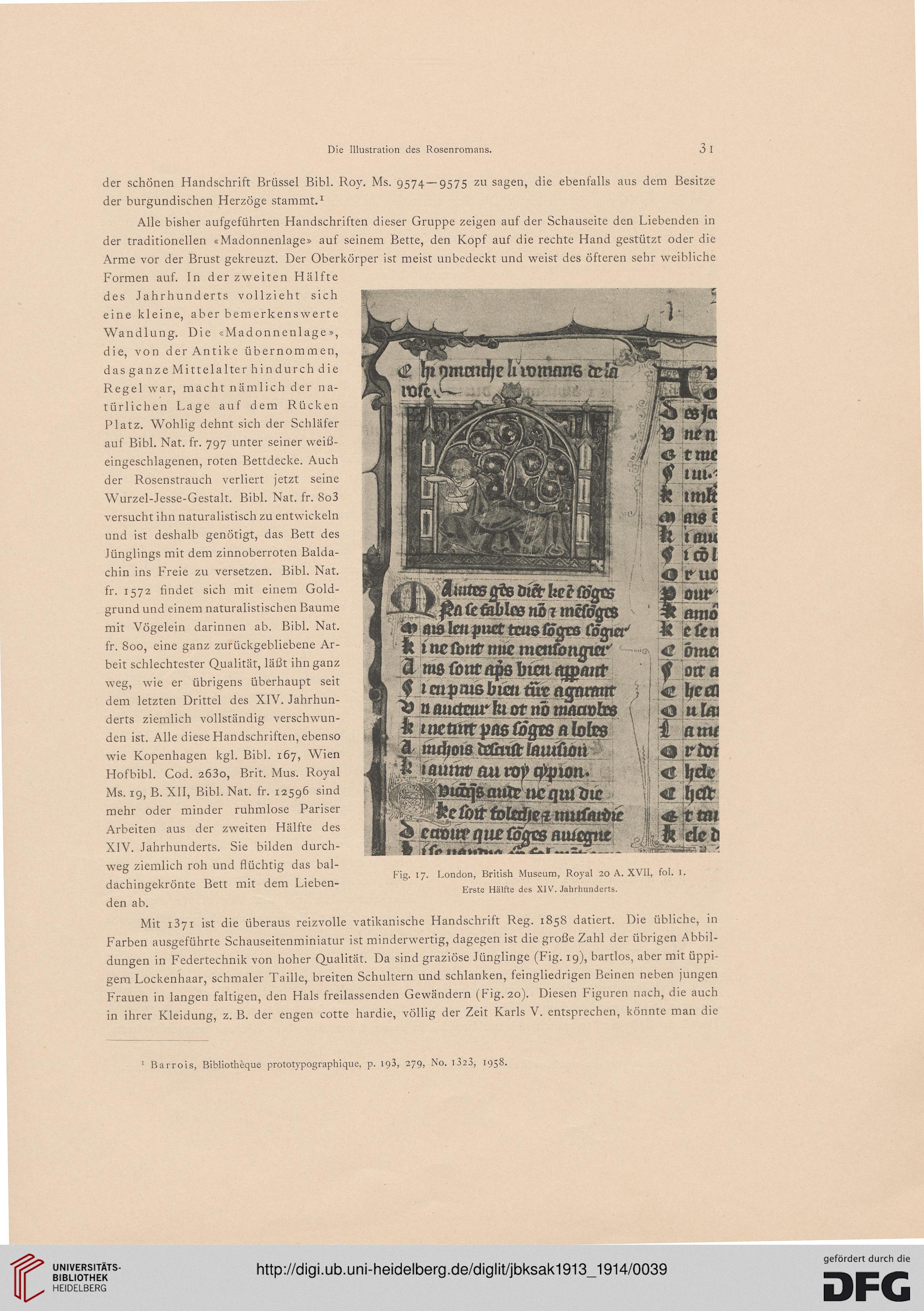Die Illustration des Rosenromans.
3i
Ms.
9574-9575
die ebenfalls aus dem Besitze
iümnns tcla
der schönen Handschrift Brüssel Bibl. Roy.
der burgundischen Herzöge stammt.1
Alle bisher aufgeführten Handschriften dieser Gruppe zeigen auf der Schauseite den Liebenden in
der traditionellen «Madonnenlage» auf seinem Bette, den Kopf auf die rechte Hand gestützt oder die
Arme vor der Brust gekreuzt. Der Oberkörper ist meist unbedeckt und weist des öfteren sehr weibliche
Formen auf. In der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts vollzieht sich
eine kleine, aber bemerkenswerte
Wandlung. Die «Madonnenlage»,
die, von der Antike übernommen,
dasganzeMittelalterhindurch die
Regel war, macht nämlich der na-
türlichen Lage auf dem Rücken
Platz. Wohlig dehnt sich der Schläfer
auf Bibl. Nat. fr. 797 unter seiner weiß-
eingeschlagenen, roten Bettdecke. Auch
der Rosenstrauch verliert jetzt seine
Wurzel-Jesse-Gestalt. Bibl. Nat. fr. 8o3
versucht ihn naturalistisch zu entwickeln
und ist deshalb genötigt, das Bett des
Jünglings mit dem zinnoberroten Balda-
chin ins Freie zu versetzen. Bibl. Nat.
fr. 1572 findet sich mit einem Gold-
grund und einem naturalistischen Baume
mit Vögelein darinnen ab. Bibl. Nat.
fr. 800, eine ganz zurückgebliebene Ar-
beit schlechtester Qualität, läßt ihn ganz
weg, wie er übrigens überhaupt seit
dem letzten Drittel des XIV. Jahrhun-
derts ziemlich vollständig verschwun-
den ist. Alle diese Handschriften, ebenso
wie Kopenhagen kgl. Bibl. 167, Wien
Hofbibl. Cod. 263o, Brit. Mus. Royal
Ms. 19, B. XII, Bibl. Nat. fr. 12596 sind
mehr oder minder ruhmlose Pariser
Arbeiten aus der zweiten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts. Sie bilden durch-
weg ziemlich roh und flüchtig das bal-
dachingekrönte Bett mit dem Lieben-
den ab.
Mit 1371 ist die überaus reizvolle vatikanische Handschrift Reg. 1858 datiert. Die übliche, in
Farben ausgeführte Schauseitenminiatur ist minderwertig, dagegen ist die große Zahl der übrigen Abbil-
dungen in Federtechnik von hoher Qualität. Da sind graziöse Jünglinge (Fig. 19), bartlos, aber mit üppi-
gem Lockenhaar, schmaler Taille, breiten Schultern und schlanken, feingliedrigen Beinen neben jungen
Frauen in langen faltigen, den Hals freilassenden Gewändern (Fig. 20). Diesen Figuren nach, die auch
in ihrer Kleidung, z. B. der engen cotte hardie, völlig der Zeit Karls V. entsprechen, könnte man die
jlro ruh mcfdgts
<& aifl kttpiict tm&CöQpB Cöguv
ft t ncfottt ttne mcnfongia*
ä ms fottr ($3 liica ecgattt
f imipw&bmi tuengnnmr
^ tt flttttair Fu ot tw tnmob»
kjnctmptts Cogts a lob»
a indwß tühittlmuüoii
9 /f^HAMlMA ^1--~<---L
Ö ttttf
# im«'
k imk
mmei
« tarn
f E*t
Oftn
out
ßmo
<? ome
f otra
«2 hecc
i attu
Fig. 17.
London, British Museum, Royal 20 A. XVII,
Erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts.
fol. I.
1 Barrois, Bibliothöque prototypographique, p. 193, 279, No. 1323, 1958.
3i
Ms.
9574-9575
die ebenfalls aus dem Besitze
iümnns tcla
der schönen Handschrift Brüssel Bibl. Roy.
der burgundischen Herzöge stammt.1
Alle bisher aufgeführten Handschriften dieser Gruppe zeigen auf der Schauseite den Liebenden in
der traditionellen «Madonnenlage» auf seinem Bette, den Kopf auf die rechte Hand gestützt oder die
Arme vor der Brust gekreuzt. Der Oberkörper ist meist unbedeckt und weist des öfteren sehr weibliche
Formen auf. In der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts vollzieht sich
eine kleine, aber bemerkenswerte
Wandlung. Die «Madonnenlage»,
die, von der Antike übernommen,
dasganzeMittelalterhindurch die
Regel war, macht nämlich der na-
türlichen Lage auf dem Rücken
Platz. Wohlig dehnt sich der Schläfer
auf Bibl. Nat. fr. 797 unter seiner weiß-
eingeschlagenen, roten Bettdecke. Auch
der Rosenstrauch verliert jetzt seine
Wurzel-Jesse-Gestalt. Bibl. Nat. fr. 8o3
versucht ihn naturalistisch zu entwickeln
und ist deshalb genötigt, das Bett des
Jünglings mit dem zinnoberroten Balda-
chin ins Freie zu versetzen. Bibl. Nat.
fr. 1572 findet sich mit einem Gold-
grund und einem naturalistischen Baume
mit Vögelein darinnen ab. Bibl. Nat.
fr. 800, eine ganz zurückgebliebene Ar-
beit schlechtester Qualität, läßt ihn ganz
weg, wie er übrigens überhaupt seit
dem letzten Drittel des XIV. Jahrhun-
derts ziemlich vollständig verschwun-
den ist. Alle diese Handschriften, ebenso
wie Kopenhagen kgl. Bibl. 167, Wien
Hofbibl. Cod. 263o, Brit. Mus. Royal
Ms. 19, B. XII, Bibl. Nat. fr. 12596 sind
mehr oder minder ruhmlose Pariser
Arbeiten aus der zweiten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts. Sie bilden durch-
weg ziemlich roh und flüchtig das bal-
dachingekrönte Bett mit dem Lieben-
den ab.
Mit 1371 ist die überaus reizvolle vatikanische Handschrift Reg. 1858 datiert. Die übliche, in
Farben ausgeführte Schauseitenminiatur ist minderwertig, dagegen ist die große Zahl der übrigen Abbil-
dungen in Federtechnik von hoher Qualität. Da sind graziöse Jünglinge (Fig. 19), bartlos, aber mit üppi-
gem Lockenhaar, schmaler Taille, breiten Schultern und schlanken, feingliedrigen Beinen neben jungen
Frauen in langen faltigen, den Hals freilassenden Gewändern (Fig. 20). Diesen Figuren nach, die auch
in ihrer Kleidung, z. B. der engen cotte hardie, völlig der Zeit Karls V. entsprechen, könnte man die
jlro ruh mcfdgts
<& aifl kttpiict tm&CöQpB Cöguv
ft t ncfottt ttne mcnfongia*
ä ms fottr ($3 liica ecgattt
f imipw&bmi tuengnnmr
^ tt flttttair Fu ot tw tnmob»
kjnctmptts Cogts a lob»
a indwß tühittlmuüoii
9 /f^HAMlMA ^1--~<---L
Ö ttttf
# im«'
k imk
mmei
« tarn
f E*t
Oftn
out
ßmo
<? ome
f otra
«2 hecc
i attu
Fig. 17.
London, British Museum, Royal 20 A. XVII,
Erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts.
fol. I.
1 Barrois, Bibliothöque prototypographique, p. 193, 279, No. 1323, 1958.