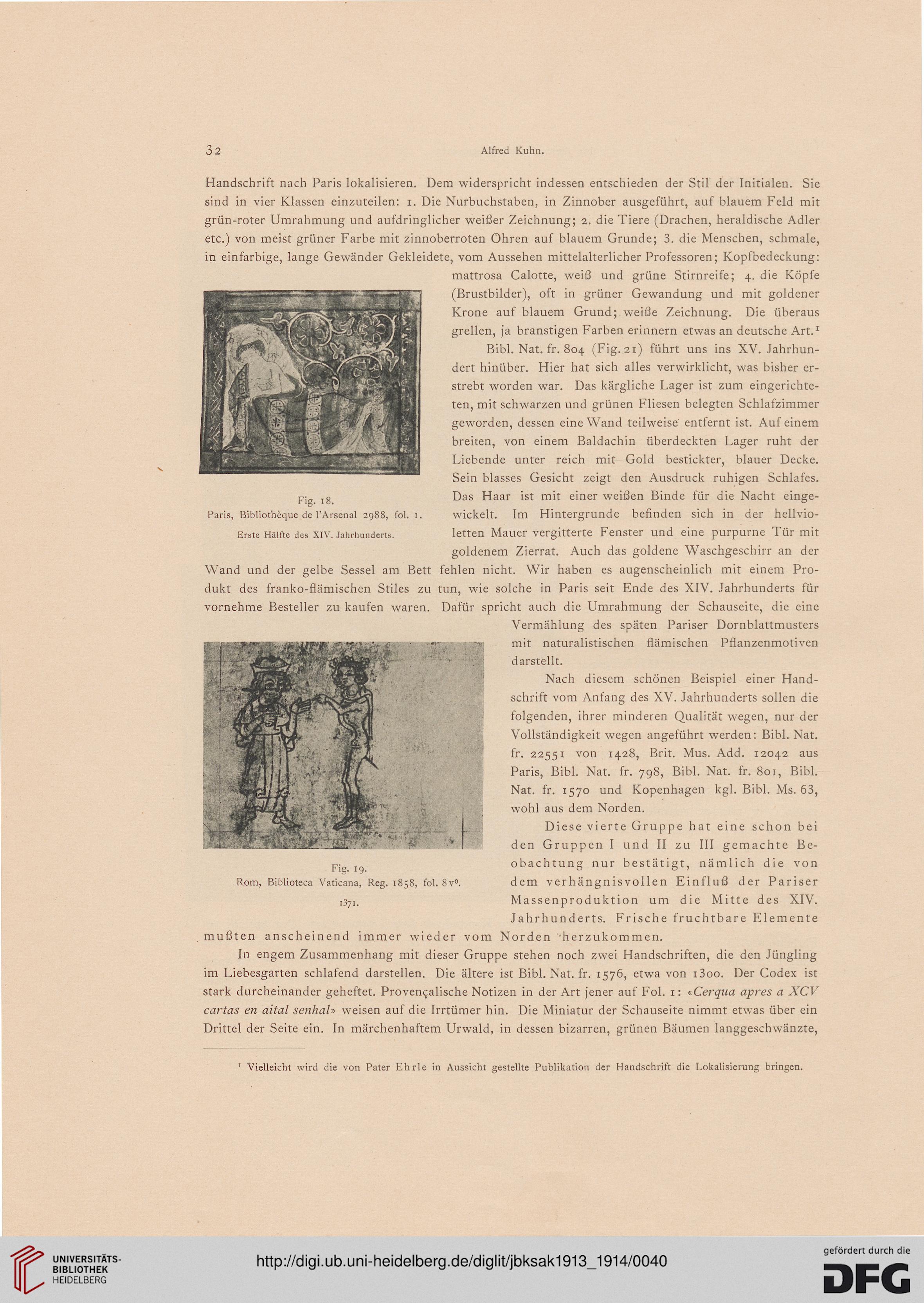32
Alfred Kuhn.
Fig. 18.
Paris, Bibliothöque de 1'Arsenal 2988, fol. 1.
Erste Hülfte des XIV. Jahrhunderts.
Handschrift nach Paris lokalisieren. Dem widerspricht indessen entschieden der Stil der Initialen. Sie
sind in vier Klassen einzuteilen: 1. Die Nurbuchstaben, in Zinnober ausgeführt, auf blauem Feld mit
grün-roter Umrahmung und aufdringlicher weißer Zeichnung; 2. die Tiere (Drachen, heraldische Adler
etc.) von meist grüner Farbe mit zinnoberroten Ohren auf blauem Grunde; 3. die Menschen, schmale,
in einfarbige, lange Gewänder Gekleidete, vom Aussehen mittelalterlicher Professoren; Kopfbedeckung:
mattrosa Calotte, weiß und grüne Stirnreife; 4. die Köpfe
(Brustbilder), oft in grüner Gewandung und mit goldener
Krone auf blauem Grund; weiße Zeichnung. Die überaus
grellen, ja branstigen Farben erinnern etwas an deutsche Art.1
Bibl. Nat. fr. 804 (Fig. 21) führt uns ins XV. Jahrhun-
dert hinüber. Hier hat sich alles verwirklicht, was bisher er-
strebt worden war. Das kärgliche Lager ist zum eingerichte-
ten, mit schwarzen und grünen Fliesen belegten Schlafzimmer
geworden, dessen eine Wand teilweise entfernt ist. Auf einem
breiten, von einem Baldachin überdeckten Lager ruht der
Liebende unter reich mit Gold bestickter, blauer Decke.
Sein blasses Gesicht zeigt den Ausdruck ruhigen Schlafes.
Das Haar ist mit einer weißen Binde für die Nacht einge-
wickelt. Im Hintergrunde befinden sich in der hellvio-
letten Mauer vergitterte Fenster und eine purpurne Tür mit
goldenem Zierrat. Auch das goldene Waschgeschirr an der
Wand und der gelbe Sessel am Bett fehlen nicht. Wir haben es augenscheinlich mit einem Pro-
dukt des franko-flämischen Stiles zu tun, wie solche in Paris seit Ende des XIV. Jahrhunderts für
vornehme Besteller zu kaufen waren. Dafür spricht auch die Umrahmung der Schauseite, die eine
Vermählung des späten Pariser Dornblattmusters
mit naturalistischen flämischen Pflanzenmotiven
darstellt.
Nach diesem schönen Beispiel einer Hand-
schrift vom Anfang des XV. Jahrhunderts sollen die
folgenden, ihrer minderen Qualität wegen, nur der
Vollständigkeit wegen angeführt werden: Bibl. Nat.
fr. 22551 von 1428, Brit. Mus. Add. 12042 aus
Paris, Bibl. Nat. fr. 798, Bibl. Nat. fr. 801, Bibl.
Nat. fr. 1570 und Kopenhagen kgl. Bibl. Ms. 63,
wohl aus dem Norden.
Diese vierte Gruppe hat eine schon bei
den Gruppen I und II zu III gemachte Be-
obachtung nur bestätigt, nämlich die von
dem verhängnisvollen Einfluß der Pariser
Massenproduktion um die Mitte des XIV.
Jahrhunderts. Frische fruchtbare Elemente
mußten anscheinend immer wieder vom Norden herzukommen.
In engem Zusammenhang mit dieser Gruppe stehen noch zwei Handschriften, die den Jüngling
im Liebesgarten schlafend darstellen. Die ältere ist Bibl. Nat. fr. 1576, etwa von i3oo. Der Codex ist
stark durcheinander geheftet. Provencalische Notizen in der Art jener auf Fol. 1: «Cerqua apres a XCV
cartas en aital senhal» weisen auf die Irrtümer hin. Die Miniatur der Schauseite nimmt etwas über ein
Drittel der Seite ein. In märchenhaftem Urwald, in dessen bizarren, grünen Bäumen langgeschwänzte,
Mg. ig.
Rom, Biblioteca Vaticana, Reg. 1858, fol. 8v°.
1371.
' Vielleicht wird die von Pater Ehrle in Aussicht gestellte Publikation der Handschrift die Lokalisierung bringen.
Alfred Kuhn.
Fig. 18.
Paris, Bibliothöque de 1'Arsenal 2988, fol. 1.
Erste Hülfte des XIV. Jahrhunderts.
Handschrift nach Paris lokalisieren. Dem widerspricht indessen entschieden der Stil der Initialen. Sie
sind in vier Klassen einzuteilen: 1. Die Nurbuchstaben, in Zinnober ausgeführt, auf blauem Feld mit
grün-roter Umrahmung und aufdringlicher weißer Zeichnung; 2. die Tiere (Drachen, heraldische Adler
etc.) von meist grüner Farbe mit zinnoberroten Ohren auf blauem Grunde; 3. die Menschen, schmale,
in einfarbige, lange Gewänder Gekleidete, vom Aussehen mittelalterlicher Professoren; Kopfbedeckung:
mattrosa Calotte, weiß und grüne Stirnreife; 4. die Köpfe
(Brustbilder), oft in grüner Gewandung und mit goldener
Krone auf blauem Grund; weiße Zeichnung. Die überaus
grellen, ja branstigen Farben erinnern etwas an deutsche Art.1
Bibl. Nat. fr. 804 (Fig. 21) führt uns ins XV. Jahrhun-
dert hinüber. Hier hat sich alles verwirklicht, was bisher er-
strebt worden war. Das kärgliche Lager ist zum eingerichte-
ten, mit schwarzen und grünen Fliesen belegten Schlafzimmer
geworden, dessen eine Wand teilweise entfernt ist. Auf einem
breiten, von einem Baldachin überdeckten Lager ruht der
Liebende unter reich mit Gold bestickter, blauer Decke.
Sein blasses Gesicht zeigt den Ausdruck ruhigen Schlafes.
Das Haar ist mit einer weißen Binde für die Nacht einge-
wickelt. Im Hintergrunde befinden sich in der hellvio-
letten Mauer vergitterte Fenster und eine purpurne Tür mit
goldenem Zierrat. Auch das goldene Waschgeschirr an der
Wand und der gelbe Sessel am Bett fehlen nicht. Wir haben es augenscheinlich mit einem Pro-
dukt des franko-flämischen Stiles zu tun, wie solche in Paris seit Ende des XIV. Jahrhunderts für
vornehme Besteller zu kaufen waren. Dafür spricht auch die Umrahmung der Schauseite, die eine
Vermählung des späten Pariser Dornblattmusters
mit naturalistischen flämischen Pflanzenmotiven
darstellt.
Nach diesem schönen Beispiel einer Hand-
schrift vom Anfang des XV. Jahrhunderts sollen die
folgenden, ihrer minderen Qualität wegen, nur der
Vollständigkeit wegen angeführt werden: Bibl. Nat.
fr. 22551 von 1428, Brit. Mus. Add. 12042 aus
Paris, Bibl. Nat. fr. 798, Bibl. Nat. fr. 801, Bibl.
Nat. fr. 1570 und Kopenhagen kgl. Bibl. Ms. 63,
wohl aus dem Norden.
Diese vierte Gruppe hat eine schon bei
den Gruppen I und II zu III gemachte Be-
obachtung nur bestätigt, nämlich die von
dem verhängnisvollen Einfluß der Pariser
Massenproduktion um die Mitte des XIV.
Jahrhunderts. Frische fruchtbare Elemente
mußten anscheinend immer wieder vom Norden herzukommen.
In engem Zusammenhang mit dieser Gruppe stehen noch zwei Handschriften, die den Jüngling
im Liebesgarten schlafend darstellen. Die ältere ist Bibl. Nat. fr. 1576, etwa von i3oo. Der Codex ist
stark durcheinander geheftet. Provencalische Notizen in der Art jener auf Fol. 1: «Cerqua apres a XCV
cartas en aital senhal» weisen auf die Irrtümer hin. Die Miniatur der Schauseite nimmt etwas über ein
Drittel der Seite ein. In märchenhaftem Urwald, in dessen bizarren, grünen Bäumen langgeschwänzte,
Mg. ig.
Rom, Biblioteca Vaticana, Reg. 1858, fol. 8v°.
1371.
' Vielleicht wird die von Pater Ehrle in Aussicht gestellte Publikation der Handschrift die Lokalisierung bringen.