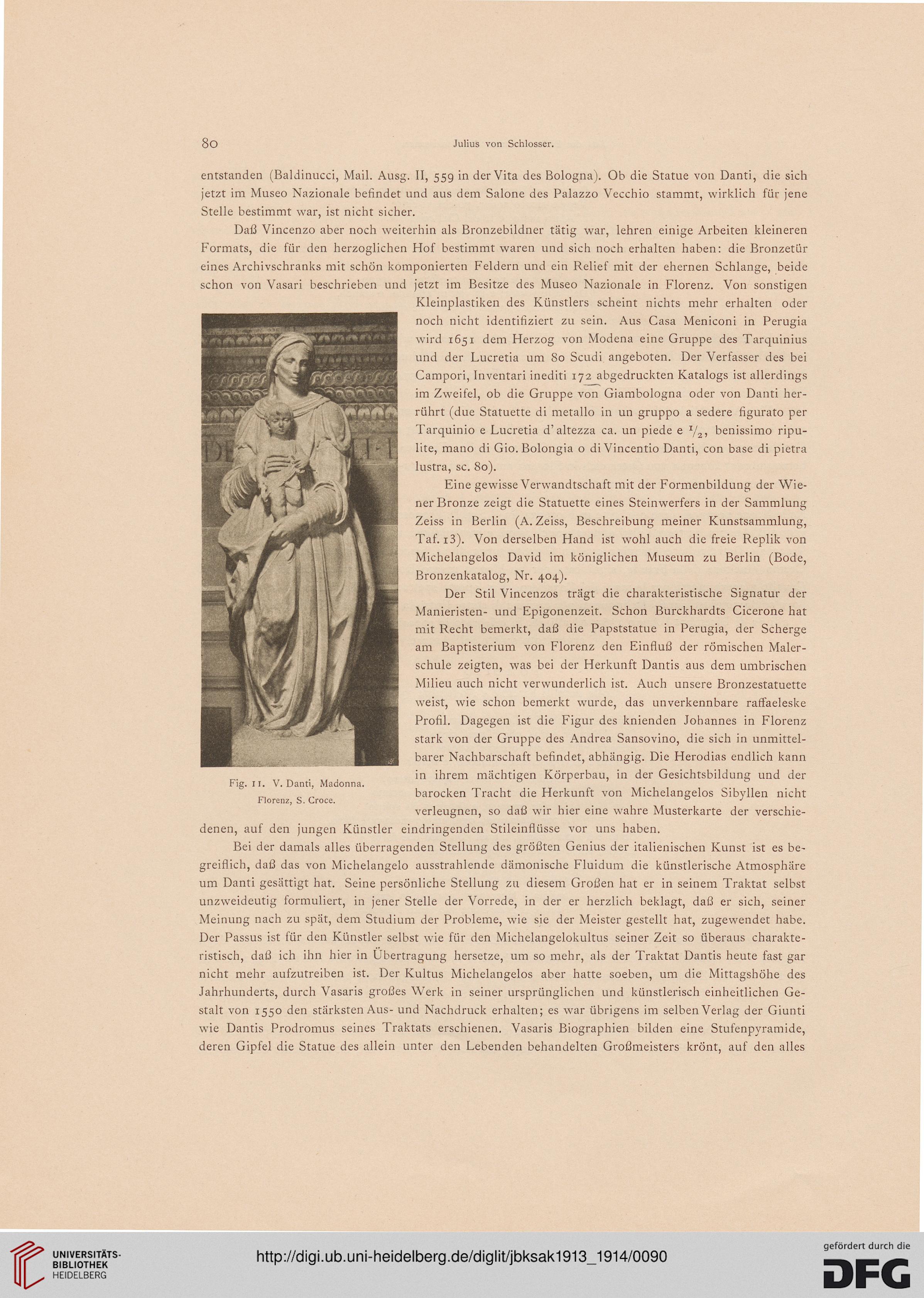8o
Julius von Schlosser.
entstanden (Baldinucci, Mail. Ausg. II, 559 in der Vita des Bologna). Ob die Statue von Danti, die sich
jetzt im Museo Nazionale befindet und aus dem Salone des Palazzo Vecchio stammt, wirklich für jene
Stelle bestimmt war, ist nicht sicher.
Daß Vincenzo aber noch weiterhin als Bronzebildner tätig war, lehren einige Arbeiten kleineren
Formats, die für den herzoglichen Hof bestimmt waren und sich noch erhalten haben: die Bronzetür
eines Archivschranks mit schön komponierten Feldern und ein Relief mit der ehernen Schlange, beide
schon von Vasari beschrieben und jetzt im Besitze des Museo Nazionale in Florenz. Von sonstigen
Kleinplastiken des Künstlers scheint nichts mehr erhalten oder
noch nicht identifiziert zu sein. Aus Casa Meniconi in Perugia
wird 1651 dem Herzog von Modena eine Gruppe des Tarquinius
und der Lucretia um 80 Scudi angeboten. Der Verfasser des bei
Campori, Inventari inediti 172 abgedruckten Katalogs ist allerdings
im Zweifel, ob die Gruppe von Giambologna oder von Danti her-
rührt (due Statuette di metallo in un gruppo a sedere figurato per
Tarquinio e Lucretia d'altezza ca. un piede e r/2, benissimo ripu-
lite, mano di Gio. Bolongia o diVincentio Danti, con base di pietra
lustra, sc. 80).
Eine gewisse Verwandtschaft mit der Formenbildung der Wie-
ner Bronze zeigt die Statuette eines Steinwerfers in der Sammlung
Zeiss in Berlin (A. Zeiss, Beschreibung meiner Kunstsammlung,
Taf. i3). Von derselben Hand ist wohl auch die freie Replik von
Michelangelos David im königlichen Museum zu Berlin (Bode,
Bronzenkatalog, Nr. 404).
Der Stil Vincenzos trägt die charakteristische Signatur der
Manieristen- und Epigonenzeit. Schon Burckhardts Cicerone hat
mit Recht bemerkt, daß die Papststatue in Perugia, der Scherge
am Baptisterium von Florenz den Einfluß der römischen Maler-
schule zeigten, was bei der Herkunft Dantis aus dem umbrischen
Milieu auch nicht verwunderlich ist. Auch unsere Bronzestatuette
weist, wie schon bemerkt wurde, das unverkennbare raffaeleske
Profil. Dagegen ist die Figur des knienden Johannes in Florenz
stark von der Gruppe des Andrea Sansovino, die sich in unmittel-
barer Nachbarschaft befindet, abhängig. Die Herodias endlich kann
in ihrem mächtigen Körperbau, in der Gesichtsbildung und der
Fig. 11. V. Danti, Madonna.
barocken Tracht die Herkunft von Michelangelos Sibyllen nicht
Florenz, S. Croce. J
verleugnen, so daß wir hier eine wahre Musterkarte der verschie-
denen, auf den jungen Künstler eindringenden Stileinflüsse vor uns haben.
Bei der damals alles überragenden Stellung des größten Genius der italienischen Kunst ist es be-
greiflich, daß das von Michelangelo ausstrahlende dämonische Fluidum die künstlerische Atmosphäre
um Danti gesättigt hat. Seine persönliche Stellung zu diesem Großen hat er in seinem Traktat selbst
unzweideutig formuliert, in jener Stelle der Vorrede, in der er herzlich beklagt, daß er sich, seiner
Meinung nach zu spät, dem Studium der Probleme, wie sie der Meister gestellt hat, zugewendet habe.
Der Passus ist für den Künstler selbst wie für den Michelangelokultus seiner Zeit so überaus charakte-
ristisch, daß ich ihn hier in Übertragung hersetze, um so mehr, als der Traktat Dantis heute fast gar
nicht mehr aufzutreiben ist. Der Kultus Michelangelos aber hatte soeben, um die Mittagshöhe des
Jahrhunderts, durch Vasaris großes Werk in seiner ursprünglichen und künstlerisch einheitlichen Ge-
stalt von 1550 den stärksten Aus- und Nachdruck erhalten; es war übrigens im selben Verlag der Giunti
wie Dantis Prodromus seines Traktats erschienen. Vasaris Biographien bilden eine Stufenpyramide,
deren Gipfel die Statue des allein unter den Lebenden behandelten Großmeisters krönt, auf den alles
Julius von Schlosser.
entstanden (Baldinucci, Mail. Ausg. II, 559 in der Vita des Bologna). Ob die Statue von Danti, die sich
jetzt im Museo Nazionale befindet und aus dem Salone des Palazzo Vecchio stammt, wirklich für jene
Stelle bestimmt war, ist nicht sicher.
Daß Vincenzo aber noch weiterhin als Bronzebildner tätig war, lehren einige Arbeiten kleineren
Formats, die für den herzoglichen Hof bestimmt waren und sich noch erhalten haben: die Bronzetür
eines Archivschranks mit schön komponierten Feldern und ein Relief mit der ehernen Schlange, beide
schon von Vasari beschrieben und jetzt im Besitze des Museo Nazionale in Florenz. Von sonstigen
Kleinplastiken des Künstlers scheint nichts mehr erhalten oder
noch nicht identifiziert zu sein. Aus Casa Meniconi in Perugia
wird 1651 dem Herzog von Modena eine Gruppe des Tarquinius
und der Lucretia um 80 Scudi angeboten. Der Verfasser des bei
Campori, Inventari inediti 172 abgedruckten Katalogs ist allerdings
im Zweifel, ob die Gruppe von Giambologna oder von Danti her-
rührt (due Statuette di metallo in un gruppo a sedere figurato per
Tarquinio e Lucretia d'altezza ca. un piede e r/2, benissimo ripu-
lite, mano di Gio. Bolongia o diVincentio Danti, con base di pietra
lustra, sc. 80).
Eine gewisse Verwandtschaft mit der Formenbildung der Wie-
ner Bronze zeigt die Statuette eines Steinwerfers in der Sammlung
Zeiss in Berlin (A. Zeiss, Beschreibung meiner Kunstsammlung,
Taf. i3). Von derselben Hand ist wohl auch die freie Replik von
Michelangelos David im königlichen Museum zu Berlin (Bode,
Bronzenkatalog, Nr. 404).
Der Stil Vincenzos trägt die charakteristische Signatur der
Manieristen- und Epigonenzeit. Schon Burckhardts Cicerone hat
mit Recht bemerkt, daß die Papststatue in Perugia, der Scherge
am Baptisterium von Florenz den Einfluß der römischen Maler-
schule zeigten, was bei der Herkunft Dantis aus dem umbrischen
Milieu auch nicht verwunderlich ist. Auch unsere Bronzestatuette
weist, wie schon bemerkt wurde, das unverkennbare raffaeleske
Profil. Dagegen ist die Figur des knienden Johannes in Florenz
stark von der Gruppe des Andrea Sansovino, die sich in unmittel-
barer Nachbarschaft befindet, abhängig. Die Herodias endlich kann
in ihrem mächtigen Körperbau, in der Gesichtsbildung und der
Fig. 11. V. Danti, Madonna.
barocken Tracht die Herkunft von Michelangelos Sibyllen nicht
Florenz, S. Croce. J
verleugnen, so daß wir hier eine wahre Musterkarte der verschie-
denen, auf den jungen Künstler eindringenden Stileinflüsse vor uns haben.
Bei der damals alles überragenden Stellung des größten Genius der italienischen Kunst ist es be-
greiflich, daß das von Michelangelo ausstrahlende dämonische Fluidum die künstlerische Atmosphäre
um Danti gesättigt hat. Seine persönliche Stellung zu diesem Großen hat er in seinem Traktat selbst
unzweideutig formuliert, in jener Stelle der Vorrede, in der er herzlich beklagt, daß er sich, seiner
Meinung nach zu spät, dem Studium der Probleme, wie sie der Meister gestellt hat, zugewendet habe.
Der Passus ist für den Künstler selbst wie für den Michelangelokultus seiner Zeit so überaus charakte-
ristisch, daß ich ihn hier in Übertragung hersetze, um so mehr, als der Traktat Dantis heute fast gar
nicht mehr aufzutreiben ist. Der Kultus Michelangelos aber hatte soeben, um die Mittagshöhe des
Jahrhunderts, durch Vasaris großes Werk in seiner ursprünglichen und künstlerisch einheitlichen Ge-
stalt von 1550 den stärksten Aus- und Nachdruck erhalten; es war übrigens im selben Verlag der Giunti
wie Dantis Prodromus seines Traktats erschienen. Vasaris Biographien bilden eine Stufenpyramide,
deren Gipfel die Statue des allein unter den Lebenden behandelten Großmeisters krönt, auf den alles