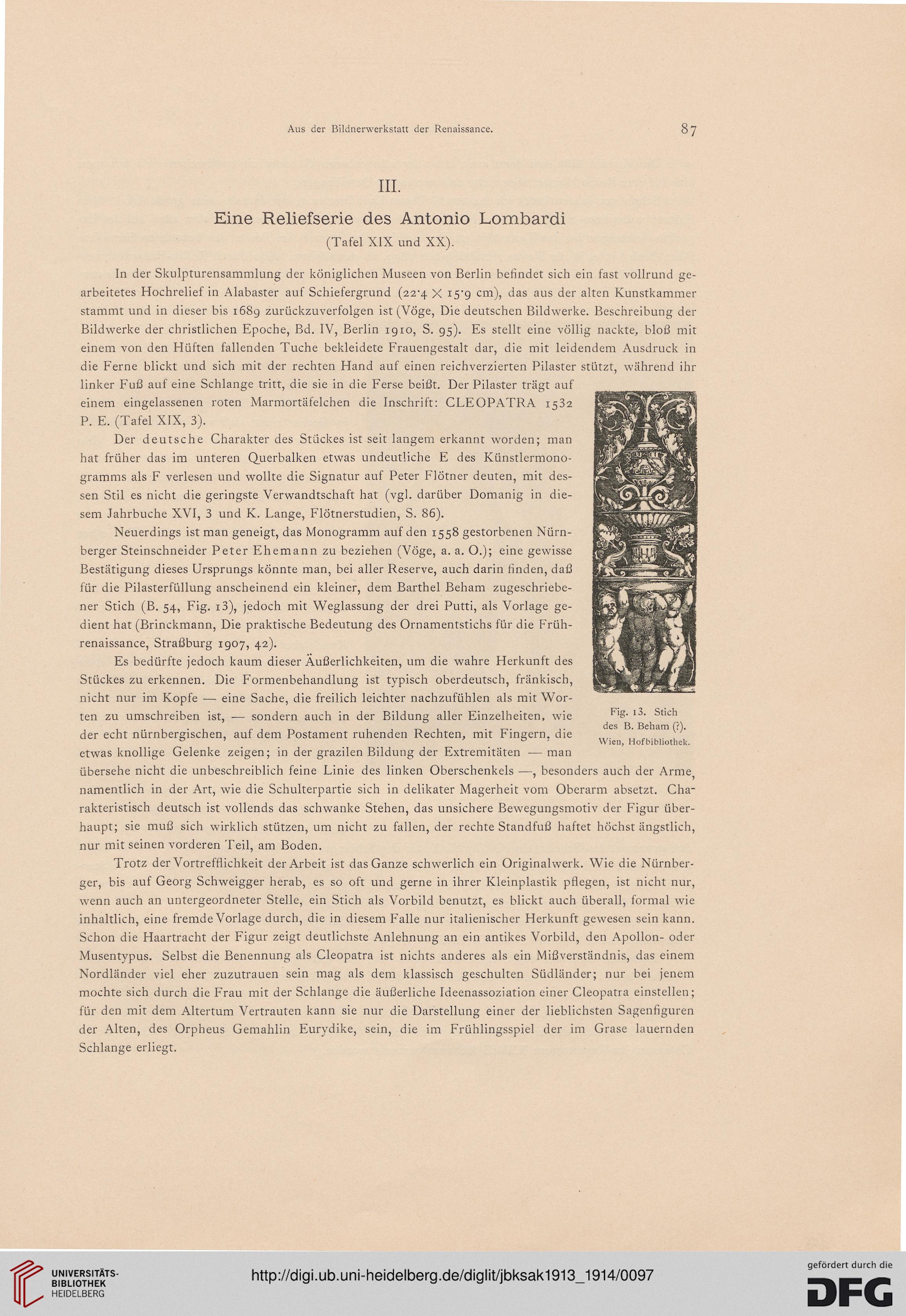Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance.
87
III.
Eine Reliefserie des Antonio Lombardi
(Tafel XIX und XX).
In der Skulpturensammlung der königlichen Museen von Berlin berindet sich ein fast vollrund ge-
arbeitetes Hochrelief in Alabaster auf Schiefergrund (22^4 X i5'9 cm), das aus der alten Kunstkammer
stammt und in dieser bis 1689 zurückzuverfolgen ist (Vöge, Die deutschen Bildwerke. Beschreibung der
Bildwerke der christlichen Epoche, Bd. IV, Berlin 1910, S. 95). Es stellt eine völlig nackte, bloß mit
einem von den Hüften fallenden Tuche bekleidete Frauengestalt dar, die mit leidendem Ausdruck in
die Ferne blickt und sich mit der rechten Hand auf einen reichverzierten Pilaster stützt, während ihr
linker Fuß auf eine Schlange tritt, die sie in die Ferse beißt. Der Pilaster trägt auf
einem eingelassenen roten Marmortäfelchen die Inschrift: CLEOPATRA 1532
P. E. (Tafel XIX, 3).
Der deutsche Charakter des Stückes ist seit langem erkannt worden; man
hat früher das im unteren Querbalken etwas undeutliche E des Künstlermono-
gramms als F verlesen und wollte die Signatur auf Peter Flötner deuten, mit des-
sen Stil es nicht die geringste Verwandtschaft hat (vgl. darüber Domanig in die-
sem Jahrbuche XVI, 3 und K. Lange, Flötnerstudien, S. 86).
Neuerdings ist man geneigt, das Monogramm auf den 1558 gestorbenen Nürn-
berger Steinschneider Peter Ehemann zu beziehen (Vöge, a. a. O.); eine gewisse
Bestätigung dieses Ursprungs könnte man, bei aller Reserve, auch darin finden, daß
für die Pilasterfüllung anscheinend ein kleiner, dem Barthel Beham zugeschriebe-
ner Stich (B. 54, Fig. i3), jedoch mit Weglassung der drei Putti, als Vorlage ge-
dient hat (Brinckmann, Die praktische Bedeutung des Ornamentstichs für die Früh-
renaissance, Straßburg 1907, 42).
Es bedürfte jedoch kaum dieser Äußerlichkeiten, um die wahre Herkunft des
Stückes zu erkennen. Die Formenbehandlung ist typisch oberdeutsch, fränkisch,
nicht nur im Kopfe — eine Sache, die freilich leichter nachzufühlen als mit Wor-
ten zu umschreiben ist, — sondern auch in der Bildung aller Einzelheiten, wie
der echt nürnbergischen, auf dem Postament ruhenden Rechten, mit Fingern, die
0 ' Wien, Hofbibliothek.
etwas knollige Gelenke zeigen; in der grazilen Bildung der Extremitäten —man
übersehe nicht die unbeschreiblich feine Linie des linken Oberschenkels —, besonders auch der Arme
namentlich in der Art, wie die Schulterpartie sich in delikater Magerheit vom Oberarm absetzt. Cha-
rakteristisch deutsch ist vollends das schwanke Stehen, das unsichere Bewegungsmotiv der Figur über-
haupt; sie muß sich wirklich stützen, um nicht zu fallen, der rechte Standfuß haftet höchst ängstlich,
nur mit seinen vorderen Teil, am Boden.
Trotz der Vortrefflichkeit der Arbeit ist das Ganze schwerlich ein Originalwerk. Wie die Nürnber-
ger, bis auf Georg Schweigger herab, es so oft und gerne in ihrer Kleinplastik pflegen, ist nicht nur,
wenn auch an untergeordneter Stelle, ein Stich als Vorbild benutzt, es blickt auch überall, formal wie
inhaltlich, eine fremde Vorlage durch, die in diesem Falle nur italienischer Herkunft gewesen sein kann.
Schon die Haartracht der Figur zeigt deutlichste Anlehnung an ein antikes Vorbild, den Apollon- oder
Musentypus. Selbst die Benennung als Cleopatra ist nichts anderes als ein Mißverständnis, das einem
Nordländer viel eher zuzutrauen sein mag als dem klassisch geschulten Südländer; nur bei jenem
mochte sich durch die Frau mit der Schlange die äußerliche Ideenassoziation einer Cleopatra einstellen;
für den mit dem Altertum Vertrauten kann sie nur die Darstellung einer der lieblichsten Sagenfiguren
der Alten, des Orpheus Gemahlin Eurydike, sein, die im Frühlingsspiel der im Grase lauernden
Schlange erliegt.
87
III.
Eine Reliefserie des Antonio Lombardi
(Tafel XIX und XX).
In der Skulpturensammlung der königlichen Museen von Berlin berindet sich ein fast vollrund ge-
arbeitetes Hochrelief in Alabaster auf Schiefergrund (22^4 X i5'9 cm), das aus der alten Kunstkammer
stammt und in dieser bis 1689 zurückzuverfolgen ist (Vöge, Die deutschen Bildwerke. Beschreibung der
Bildwerke der christlichen Epoche, Bd. IV, Berlin 1910, S. 95). Es stellt eine völlig nackte, bloß mit
einem von den Hüften fallenden Tuche bekleidete Frauengestalt dar, die mit leidendem Ausdruck in
die Ferne blickt und sich mit der rechten Hand auf einen reichverzierten Pilaster stützt, während ihr
linker Fuß auf eine Schlange tritt, die sie in die Ferse beißt. Der Pilaster trägt auf
einem eingelassenen roten Marmortäfelchen die Inschrift: CLEOPATRA 1532
P. E. (Tafel XIX, 3).
Der deutsche Charakter des Stückes ist seit langem erkannt worden; man
hat früher das im unteren Querbalken etwas undeutliche E des Künstlermono-
gramms als F verlesen und wollte die Signatur auf Peter Flötner deuten, mit des-
sen Stil es nicht die geringste Verwandtschaft hat (vgl. darüber Domanig in die-
sem Jahrbuche XVI, 3 und K. Lange, Flötnerstudien, S. 86).
Neuerdings ist man geneigt, das Monogramm auf den 1558 gestorbenen Nürn-
berger Steinschneider Peter Ehemann zu beziehen (Vöge, a. a. O.); eine gewisse
Bestätigung dieses Ursprungs könnte man, bei aller Reserve, auch darin finden, daß
für die Pilasterfüllung anscheinend ein kleiner, dem Barthel Beham zugeschriebe-
ner Stich (B. 54, Fig. i3), jedoch mit Weglassung der drei Putti, als Vorlage ge-
dient hat (Brinckmann, Die praktische Bedeutung des Ornamentstichs für die Früh-
renaissance, Straßburg 1907, 42).
Es bedürfte jedoch kaum dieser Äußerlichkeiten, um die wahre Herkunft des
Stückes zu erkennen. Die Formenbehandlung ist typisch oberdeutsch, fränkisch,
nicht nur im Kopfe — eine Sache, die freilich leichter nachzufühlen als mit Wor-
ten zu umschreiben ist, — sondern auch in der Bildung aller Einzelheiten, wie
der echt nürnbergischen, auf dem Postament ruhenden Rechten, mit Fingern, die
0 ' Wien, Hofbibliothek.
etwas knollige Gelenke zeigen; in der grazilen Bildung der Extremitäten —man
übersehe nicht die unbeschreiblich feine Linie des linken Oberschenkels —, besonders auch der Arme
namentlich in der Art, wie die Schulterpartie sich in delikater Magerheit vom Oberarm absetzt. Cha-
rakteristisch deutsch ist vollends das schwanke Stehen, das unsichere Bewegungsmotiv der Figur über-
haupt; sie muß sich wirklich stützen, um nicht zu fallen, der rechte Standfuß haftet höchst ängstlich,
nur mit seinen vorderen Teil, am Boden.
Trotz der Vortrefflichkeit der Arbeit ist das Ganze schwerlich ein Originalwerk. Wie die Nürnber-
ger, bis auf Georg Schweigger herab, es so oft und gerne in ihrer Kleinplastik pflegen, ist nicht nur,
wenn auch an untergeordneter Stelle, ein Stich als Vorbild benutzt, es blickt auch überall, formal wie
inhaltlich, eine fremde Vorlage durch, die in diesem Falle nur italienischer Herkunft gewesen sein kann.
Schon die Haartracht der Figur zeigt deutlichste Anlehnung an ein antikes Vorbild, den Apollon- oder
Musentypus. Selbst die Benennung als Cleopatra ist nichts anderes als ein Mißverständnis, das einem
Nordländer viel eher zuzutrauen sein mag als dem klassisch geschulten Südländer; nur bei jenem
mochte sich durch die Frau mit der Schlange die äußerliche Ideenassoziation einer Cleopatra einstellen;
für den mit dem Altertum Vertrauten kann sie nur die Darstellung einer der lieblichsten Sagenfiguren
der Alten, des Orpheus Gemahlin Eurydike, sein, die im Frühlingsspiel der im Grase lauernden
Schlange erliegt.