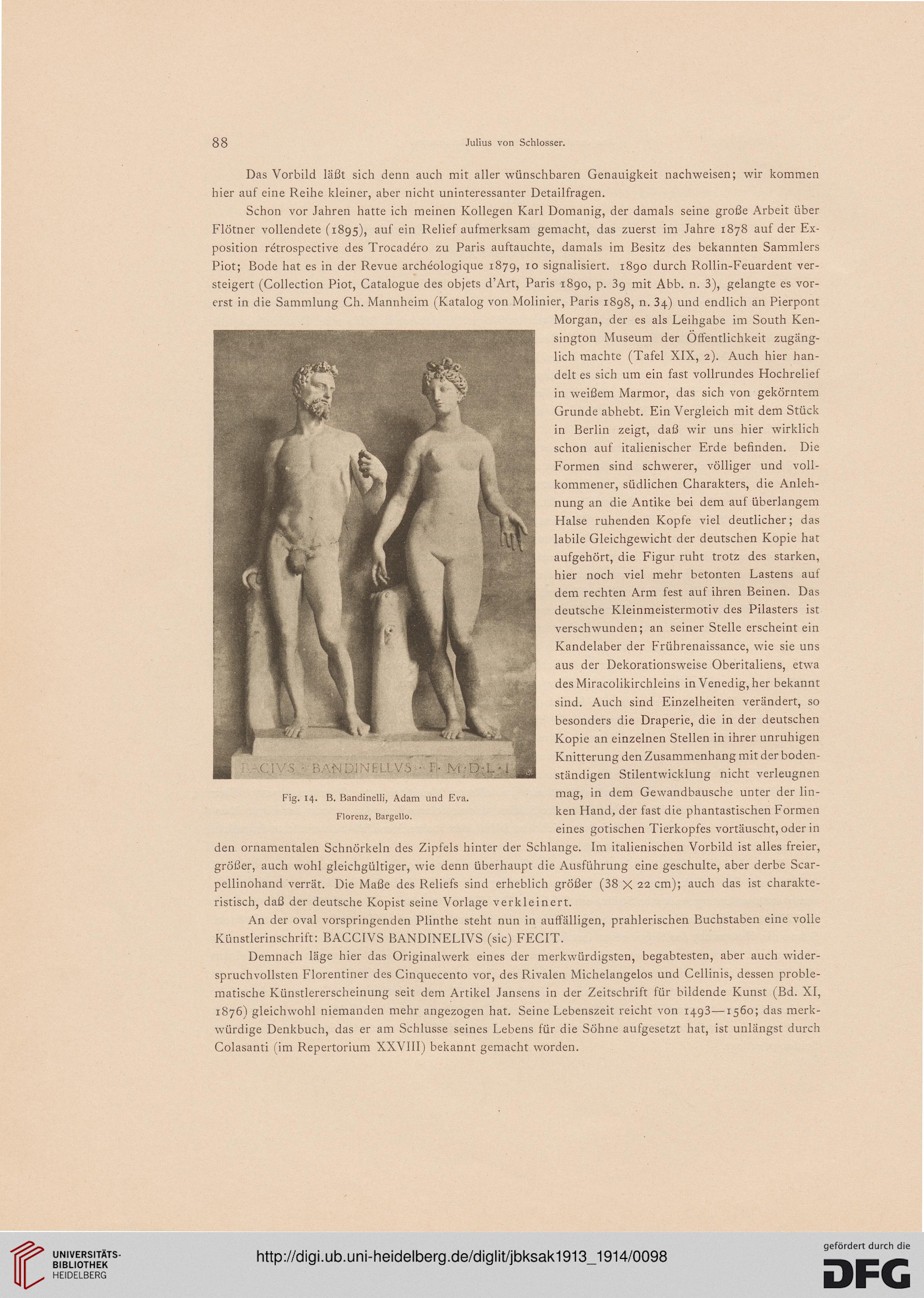88
Julius von Schlosser.
Das Vorbild läßt sich denn auch mit aller wünschbaren Genauigkeit nachweisen; wir kommen
hier auf eine Reihe kleiner, aber nicht uninteressanter Detailfragen.
Schon vor Jahren hatte ich meinen Kollegen Karl Domanig, der damals seine große Arbeit über
Flötner vollendete (1895), auf ein Relief aufmerksam gemacht, das zuerst im Jahre 1878 auf der Ex-
position retrospective des Trocadero zu Paris auftauchte, damals im Besitz des bekannten Sammlers
Piot; Bode hat es in der Revue archeologique 1879, 10 signalisiert. 1890 durch Rollin-Feuardent ver-
steigert (Collection Piot, Catalogue des objets d'Art, Paris 1890, p. 3g mit Abb. n. 3), gelangte es vor-
erst in die Sammlung Ch. Mannheim (Katalog von Molinier, Paris 1898, n. 34) und endlich an Pierpont
Morgan, der es als Leihgabe im South Ken-
sington Museum der Öffentlichkeit zugäng-
lich machte (Tafel XIX, 2). Auch hier han-
delt es sich um ein fast vollrundes Hochrelief
in weißem Marmor, das sich von gekörntem
Grunde abhebt. Ein Vergleich mit dem Stück
in Berlin zeigt, daß wir uns hier wirklich
schon auf italienischer Erde befinden. Die
Formen sind schwerer, völliger und voll-
kommener, südlichen Charakters, die Anleh-
nung an die Antike bei dem auf überlangem
Halse ruhenden Kopfe viel deutlicher; das
labile Gleichgewicht der deutschen Kopie hat
aufgehört, die Figur ruht trotz des starken,
hier noch viel mehr betonten Lastens auf
dem rechten Arm fest auf ihren Beinen. Das
deutsche Kleinmeistermotiv des Pilasters ist
verschwunden; an seiner Stelle erscheint ein
Kandelaber der Frührenaissance, wie sie uns
aus der Dekorationsweise Oberitaliens, etwa
des Miracolikirchleins in Venedig, her bekannt
sind. Auch sind Einzelheiten verändert, so
besonders die Draperie, die in der deutschen
Kopie an einzelnen Stellen in ihrer unruhigen
Knitterung den Zusammenhang mit der boden-
ständigen Stilentwicklung nicht verleugnen
mag, in dem Gewandbausche unter der lin-
ken Hand, der fast die phantastischen Formen
eines gotischen Tierkopfes vortäuscht, oder in
den ornamentalen Schnörkeln des Zipfels hinter der Schlange. Im italienischen Vorbild ist alles freier,
größer, auch wohl gleichgültiger, wie denn überhaupt die Ausführung eine geschulte, aber derbe Scar-
pellinohand verrät. Die Maße des Reliefs sind erheblich größer (38 X 22 cm); auch das ist charakte-
ristisch, daß der deutsche Kopist seine Vorlage verkleinert.
An der oval vorspringenden Plinthe steht nun in auffälligen, prahlerischen Buchstaben eine volle
Künstlerinschrift: BACCIVS BANDINELIVS (sie) FECIT.
Demnach läge hier das Originalwerk eines der merkwürdigsten, begabtesten, aber auch wider-
spruchvollsten Florentiner des Cinquecento vor, des Rivalen Michelangelos und Cellinis, dessen proble-
matische Künstlererscheinung seit dem Artikel Jansens in der Zeitschrift für bildende Kunst (Bd. XI,
1876) gleichwohl niemanden mehr angezogen hat. Seine Lebenszeit reicht von 1493—1560; das merk-
würdige Denkbuch, das er am Schlüsse seines Lebens für die Söhne aufgesetzt hat, ist unlängst durch
Colasanti (im Repertorium XXVIII) bekannt gemacht worden.
Fig. 14. B. Bandinclli, Adam und Eva.
Florenz, Bargello.
Julius von Schlosser.
Das Vorbild läßt sich denn auch mit aller wünschbaren Genauigkeit nachweisen; wir kommen
hier auf eine Reihe kleiner, aber nicht uninteressanter Detailfragen.
Schon vor Jahren hatte ich meinen Kollegen Karl Domanig, der damals seine große Arbeit über
Flötner vollendete (1895), auf ein Relief aufmerksam gemacht, das zuerst im Jahre 1878 auf der Ex-
position retrospective des Trocadero zu Paris auftauchte, damals im Besitz des bekannten Sammlers
Piot; Bode hat es in der Revue archeologique 1879, 10 signalisiert. 1890 durch Rollin-Feuardent ver-
steigert (Collection Piot, Catalogue des objets d'Art, Paris 1890, p. 3g mit Abb. n. 3), gelangte es vor-
erst in die Sammlung Ch. Mannheim (Katalog von Molinier, Paris 1898, n. 34) und endlich an Pierpont
Morgan, der es als Leihgabe im South Ken-
sington Museum der Öffentlichkeit zugäng-
lich machte (Tafel XIX, 2). Auch hier han-
delt es sich um ein fast vollrundes Hochrelief
in weißem Marmor, das sich von gekörntem
Grunde abhebt. Ein Vergleich mit dem Stück
in Berlin zeigt, daß wir uns hier wirklich
schon auf italienischer Erde befinden. Die
Formen sind schwerer, völliger und voll-
kommener, südlichen Charakters, die Anleh-
nung an die Antike bei dem auf überlangem
Halse ruhenden Kopfe viel deutlicher; das
labile Gleichgewicht der deutschen Kopie hat
aufgehört, die Figur ruht trotz des starken,
hier noch viel mehr betonten Lastens auf
dem rechten Arm fest auf ihren Beinen. Das
deutsche Kleinmeistermotiv des Pilasters ist
verschwunden; an seiner Stelle erscheint ein
Kandelaber der Frührenaissance, wie sie uns
aus der Dekorationsweise Oberitaliens, etwa
des Miracolikirchleins in Venedig, her bekannt
sind. Auch sind Einzelheiten verändert, so
besonders die Draperie, die in der deutschen
Kopie an einzelnen Stellen in ihrer unruhigen
Knitterung den Zusammenhang mit der boden-
ständigen Stilentwicklung nicht verleugnen
mag, in dem Gewandbausche unter der lin-
ken Hand, der fast die phantastischen Formen
eines gotischen Tierkopfes vortäuscht, oder in
den ornamentalen Schnörkeln des Zipfels hinter der Schlange. Im italienischen Vorbild ist alles freier,
größer, auch wohl gleichgültiger, wie denn überhaupt die Ausführung eine geschulte, aber derbe Scar-
pellinohand verrät. Die Maße des Reliefs sind erheblich größer (38 X 22 cm); auch das ist charakte-
ristisch, daß der deutsche Kopist seine Vorlage verkleinert.
An der oval vorspringenden Plinthe steht nun in auffälligen, prahlerischen Buchstaben eine volle
Künstlerinschrift: BACCIVS BANDINELIVS (sie) FECIT.
Demnach läge hier das Originalwerk eines der merkwürdigsten, begabtesten, aber auch wider-
spruchvollsten Florentiner des Cinquecento vor, des Rivalen Michelangelos und Cellinis, dessen proble-
matische Künstlererscheinung seit dem Artikel Jansens in der Zeitschrift für bildende Kunst (Bd. XI,
1876) gleichwohl niemanden mehr angezogen hat. Seine Lebenszeit reicht von 1493—1560; das merk-
würdige Denkbuch, das er am Schlüsse seines Lebens für die Söhne aufgesetzt hat, ist unlängst durch
Colasanti (im Repertorium XXVIII) bekannt gemacht worden.
Fig. 14. B. Bandinclli, Adam und Eva.
Florenz, Bargello.