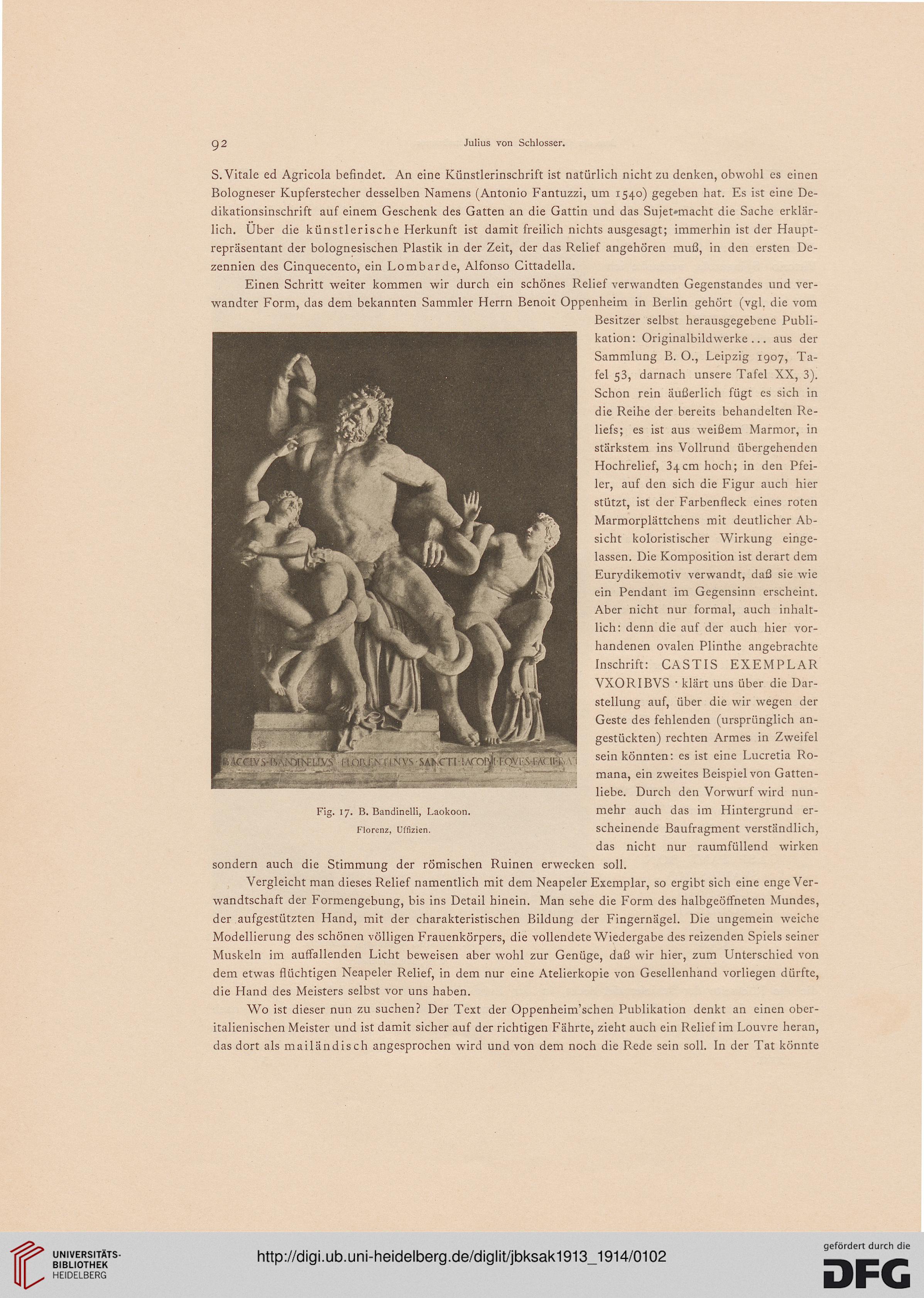g2
Julius von Schlosser.
S. Vitale ed Agricola befindet. An eine Künstlerinschrift ist natürlich nicht zu denken, obwohl es einen
Bologneser Kupferstecher desselben Namens (Antonio Fantuzzi, um 1540) gegeben hat. Es ist eine De-
dikationsinschrift auf einem Geschenk des Gatten an die Gattin und das Sujet»macht die Sache erklär-
lich. Uber die künstlerische Herkunft ist damit freilich nichts ausgesagt; immerhin ist der Haupt-
repräsentant der bolognesischen Plastik in der Zeit, der das Relief angehören muß, in den ersten De-
zennien des Cinquecento, ein Lombarde, Alfonso Cittadella.
Einen Schritt weiter kommen wir durch ein schönes Relief verwandten Gegenstandes und ver-
wandter Form, das dem bekannten Sammler Herrn Benoit Oppenheim in Berlin gehört (vgl. die vom
Besitzer selbst herausgegebene Publi-
kation: Originalbildwerke... aus der
Sammlung B. O., Leipzig 1907, Ta-
fel 53, darnach unsere Tafel XX, 3).
Schon rein äußerlich fügt es sich in
die Reihe der bereits behandelten Re-
liefs; es ist aus weißem Marmor, in
stärkstem ins Vollrund übergehenden
Hochrelief, 34cm hoch; in den Pfei-
ler, auf den sich die Figur auch hier
stützt, ist der Farbenfieck eines roten
Marmorplättchens mit deutlicher Ab-
sicht koloristischer Wirkung einge-
lassen. Die Komposition ist derart dem
Eurydikemotiv verwandt, daß sie wie
ein Pendant im Gegensinn erscheint.
Aber nicht nur formal, auch inhalt-
lich: denn die auf der auch hier vor-
handenen ovalen Plinthe angebrachte
Inschrift: CASTIS EXEMPLAR
VXORIBVS • klärt uns Über die Dar-
stellung auf, über die wir wegen der
Geste des fehlenden (ursprünglich an-
gestückten) rechten Armes in Zweifel
sein könnten: es ist eine Lucretia Ro-
mana, ein zweites Beispiel von Gatten-
liebe. Durch den Vorwurf wird nun-
mehr auch das im Hintergrund er-
scheinende Baufragment verständlich,
das nicht nur raumfüllend wirken
sondern auch die Stimmung der römischen Ruinen erwecken soll.
Vergleicht man dieses Relief namentlich mit dem Neapeler Exemplar, so ergibt sich eine enge Ver-
wandtschaft der Formengebung, bis ins Detail hinein. Man sehe die Form des halbgeöffneten Mundes,
der aufgestützten Hand, mit der charakteristischen Bildung der Fingernägel. Die ungemein weiche
Modellierung des schönen völligen Frauenkörpers, die vollendete Wiedergabe des reizenden Spiels seiner
Muskeln im auffallenden Licht beweisen aber wohl zur Genüge, daß wir hier, zum Unterschied von
dem etwas flüchtigen Neapeler Relief, in dem nur eine Atelierkopie von Gesellenhand vorliegen dürfte,
die Hand des Meisters selbst vor uns haben.
Wo ist dieser nun zu suchen? Der Text der Oppenheim'schen Publikation denkt an einen ober-
italienischen Meister und ist damit sicher auf der richtigen Fährte, zieht auch ein Relief im Louvre heran,
das dort als mailändisch angesprochen wird und von dem noch die Rede sein soll. In der Tat könnte
Fig. 17. B. Bandinelli, Laokoon.
Florenz, Offizien.
Julius von Schlosser.
S. Vitale ed Agricola befindet. An eine Künstlerinschrift ist natürlich nicht zu denken, obwohl es einen
Bologneser Kupferstecher desselben Namens (Antonio Fantuzzi, um 1540) gegeben hat. Es ist eine De-
dikationsinschrift auf einem Geschenk des Gatten an die Gattin und das Sujet»macht die Sache erklär-
lich. Uber die künstlerische Herkunft ist damit freilich nichts ausgesagt; immerhin ist der Haupt-
repräsentant der bolognesischen Plastik in der Zeit, der das Relief angehören muß, in den ersten De-
zennien des Cinquecento, ein Lombarde, Alfonso Cittadella.
Einen Schritt weiter kommen wir durch ein schönes Relief verwandten Gegenstandes und ver-
wandter Form, das dem bekannten Sammler Herrn Benoit Oppenheim in Berlin gehört (vgl. die vom
Besitzer selbst herausgegebene Publi-
kation: Originalbildwerke... aus der
Sammlung B. O., Leipzig 1907, Ta-
fel 53, darnach unsere Tafel XX, 3).
Schon rein äußerlich fügt es sich in
die Reihe der bereits behandelten Re-
liefs; es ist aus weißem Marmor, in
stärkstem ins Vollrund übergehenden
Hochrelief, 34cm hoch; in den Pfei-
ler, auf den sich die Figur auch hier
stützt, ist der Farbenfieck eines roten
Marmorplättchens mit deutlicher Ab-
sicht koloristischer Wirkung einge-
lassen. Die Komposition ist derart dem
Eurydikemotiv verwandt, daß sie wie
ein Pendant im Gegensinn erscheint.
Aber nicht nur formal, auch inhalt-
lich: denn die auf der auch hier vor-
handenen ovalen Plinthe angebrachte
Inschrift: CASTIS EXEMPLAR
VXORIBVS • klärt uns Über die Dar-
stellung auf, über die wir wegen der
Geste des fehlenden (ursprünglich an-
gestückten) rechten Armes in Zweifel
sein könnten: es ist eine Lucretia Ro-
mana, ein zweites Beispiel von Gatten-
liebe. Durch den Vorwurf wird nun-
mehr auch das im Hintergrund er-
scheinende Baufragment verständlich,
das nicht nur raumfüllend wirken
sondern auch die Stimmung der römischen Ruinen erwecken soll.
Vergleicht man dieses Relief namentlich mit dem Neapeler Exemplar, so ergibt sich eine enge Ver-
wandtschaft der Formengebung, bis ins Detail hinein. Man sehe die Form des halbgeöffneten Mundes,
der aufgestützten Hand, mit der charakteristischen Bildung der Fingernägel. Die ungemein weiche
Modellierung des schönen völligen Frauenkörpers, die vollendete Wiedergabe des reizenden Spiels seiner
Muskeln im auffallenden Licht beweisen aber wohl zur Genüge, daß wir hier, zum Unterschied von
dem etwas flüchtigen Neapeler Relief, in dem nur eine Atelierkopie von Gesellenhand vorliegen dürfte,
die Hand des Meisters selbst vor uns haben.
Wo ist dieser nun zu suchen? Der Text der Oppenheim'schen Publikation denkt an einen ober-
italienischen Meister und ist damit sicher auf der richtigen Fährte, zieht auch ein Relief im Louvre heran,
das dort als mailändisch angesprochen wird und von dem noch die Rede sein soll. In der Tat könnte
Fig. 17. B. Bandinelli, Laokoon.
Florenz, Offizien.