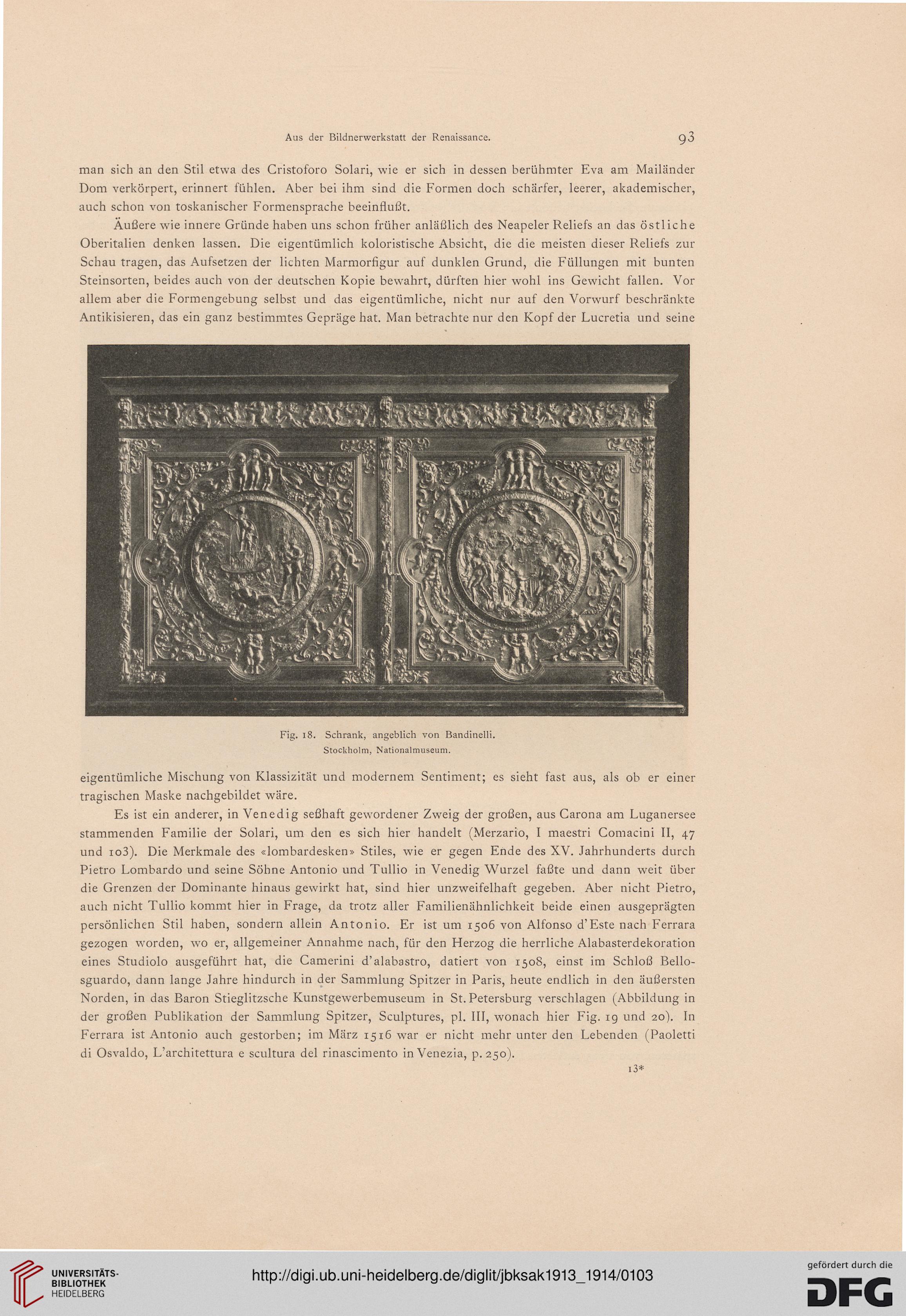Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance.
93
man sich an den Stil etwa des Cristoforo Solari, wie er sich in dessen berühmter Eva am Mailänder
Dom verkörpert, erinnert fühlen. Aber bei ihm sind die Formen doch schärfer, leerer, akademischer,
auch schon von toskanischer Formensprache beeinflußt.
Außere wie innere Gründe haben uns schon früher anläßlich des Neapeler Reliefs an das östliche
Oberitalien denken lassen. Die eigentümlich koloristische Absicht, die die meisten dieser Reliefs zur
Schau tragen, das Aufsetzen der lichten Marmorfigur auf dunklen Grund, die Füllungen mit bunten
Steinsorten, beides auch von der deutschen Kopie bewahrt, dürften hier wohl ins Gewicht fallen. Vor
allem aber die Formengebung selbst und das eigentümliche, nicht nur auf den Vorwurf beschränkte
Antikisieren, das ein ganz bestimmtes Gepräge hat. Man betrachte nur den Kopf der Lucretia und seine
Fig. 18. Schrank, angeblich von Bandinelli.
Stockholm, Nationalmuseum.
eigentümliche Mischung von Klassizität und modernem Sentiment; es sieht fast aus, als ob er einer
tragischen Maske nachgebildet wäre.
Es ist ein anderer, in Venedig seßhaft gewordener Zweig der großen, aus Carona am Luganersee
stammenden Familie der Solari, um den es sich hier handelt (Merzario, I maestri Comacini II, 47
und io3). Die Merkmale des «lombardesken» Stiles, wie er gegen Ende des XV. Jahrhunderts durch
Pietro Lombardo und seine Söhne Antonio und Tullio in Venedig Wurzel faßte und dann weit über
die Grenzen der Dominante hinaus gewirkt hat, sind hier unzweifelhaft gegeben. Aber nicht Pietro,
auch nicht Tullio kommt hier in Frage, da trotz aller Familienähnlichkeit beide einen ausgeprägten
persönlichen Stil haben, sondern allein Antonio. Er ist um 1506 von Alfonso d'Este nach Ferrara
gezogen worden, wo er, allgemeiner Annahme nach, für den Herzog die herrliche Alabasterdekoration
eines Studiolo ausgeführt hat, die Camerini d'alabastro, datiert von 1508, einst im Schloß Bello-
sguardo, dann lange Jahre hindurch in der Sammlung Spitzer in Paris, heute endlich in den äußersten
Norden, in das Baron Stieglitzsche Kunstgewerbemuseum in St. Petersburg verschlagen (Abbildung in
der großen Publikation der Sammlung Spitzer, Sculptures, pl. III, wonach hier Fig. 19 und 20). In
Ferrara ist Antonio auch gestorben; im März 1516 war er nicht mehr unter den Lebenden (Paoletti
di Osvaldo, L'architettura e scultura del rinascimento inVenezia, p. 250).
i3*
93
man sich an den Stil etwa des Cristoforo Solari, wie er sich in dessen berühmter Eva am Mailänder
Dom verkörpert, erinnert fühlen. Aber bei ihm sind die Formen doch schärfer, leerer, akademischer,
auch schon von toskanischer Formensprache beeinflußt.
Außere wie innere Gründe haben uns schon früher anläßlich des Neapeler Reliefs an das östliche
Oberitalien denken lassen. Die eigentümlich koloristische Absicht, die die meisten dieser Reliefs zur
Schau tragen, das Aufsetzen der lichten Marmorfigur auf dunklen Grund, die Füllungen mit bunten
Steinsorten, beides auch von der deutschen Kopie bewahrt, dürften hier wohl ins Gewicht fallen. Vor
allem aber die Formengebung selbst und das eigentümliche, nicht nur auf den Vorwurf beschränkte
Antikisieren, das ein ganz bestimmtes Gepräge hat. Man betrachte nur den Kopf der Lucretia und seine
Fig. 18. Schrank, angeblich von Bandinelli.
Stockholm, Nationalmuseum.
eigentümliche Mischung von Klassizität und modernem Sentiment; es sieht fast aus, als ob er einer
tragischen Maske nachgebildet wäre.
Es ist ein anderer, in Venedig seßhaft gewordener Zweig der großen, aus Carona am Luganersee
stammenden Familie der Solari, um den es sich hier handelt (Merzario, I maestri Comacini II, 47
und io3). Die Merkmale des «lombardesken» Stiles, wie er gegen Ende des XV. Jahrhunderts durch
Pietro Lombardo und seine Söhne Antonio und Tullio in Venedig Wurzel faßte und dann weit über
die Grenzen der Dominante hinaus gewirkt hat, sind hier unzweifelhaft gegeben. Aber nicht Pietro,
auch nicht Tullio kommt hier in Frage, da trotz aller Familienähnlichkeit beide einen ausgeprägten
persönlichen Stil haben, sondern allein Antonio. Er ist um 1506 von Alfonso d'Este nach Ferrara
gezogen worden, wo er, allgemeiner Annahme nach, für den Herzog die herrliche Alabasterdekoration
eines Studiolo ausgeführt hat, die Camerini d'alabastro, datiert von 1508, einst im Schloß Bello-
sguardo, dann lange Jahre hindurch in der Sammlung Spitzer in Paris, heute endlich in den äußersten
Norden, in das Baron Stieglitzsche Kunstgewerbemuseum in St. Petersburg verschlagen (Abbildung in
der großen Publikation der Sammlung Spitzer, Sculptures, pl. III, wonach hier Fig. 19 und 20). In
Ferrara ist Antonio auch gestorben; im März 1516 war er nicht mehr unter den Lebenden (Paoletti
di Osvaldo, L'architettura e scultura del rinascimento inVenezia, p. 250).
i3*