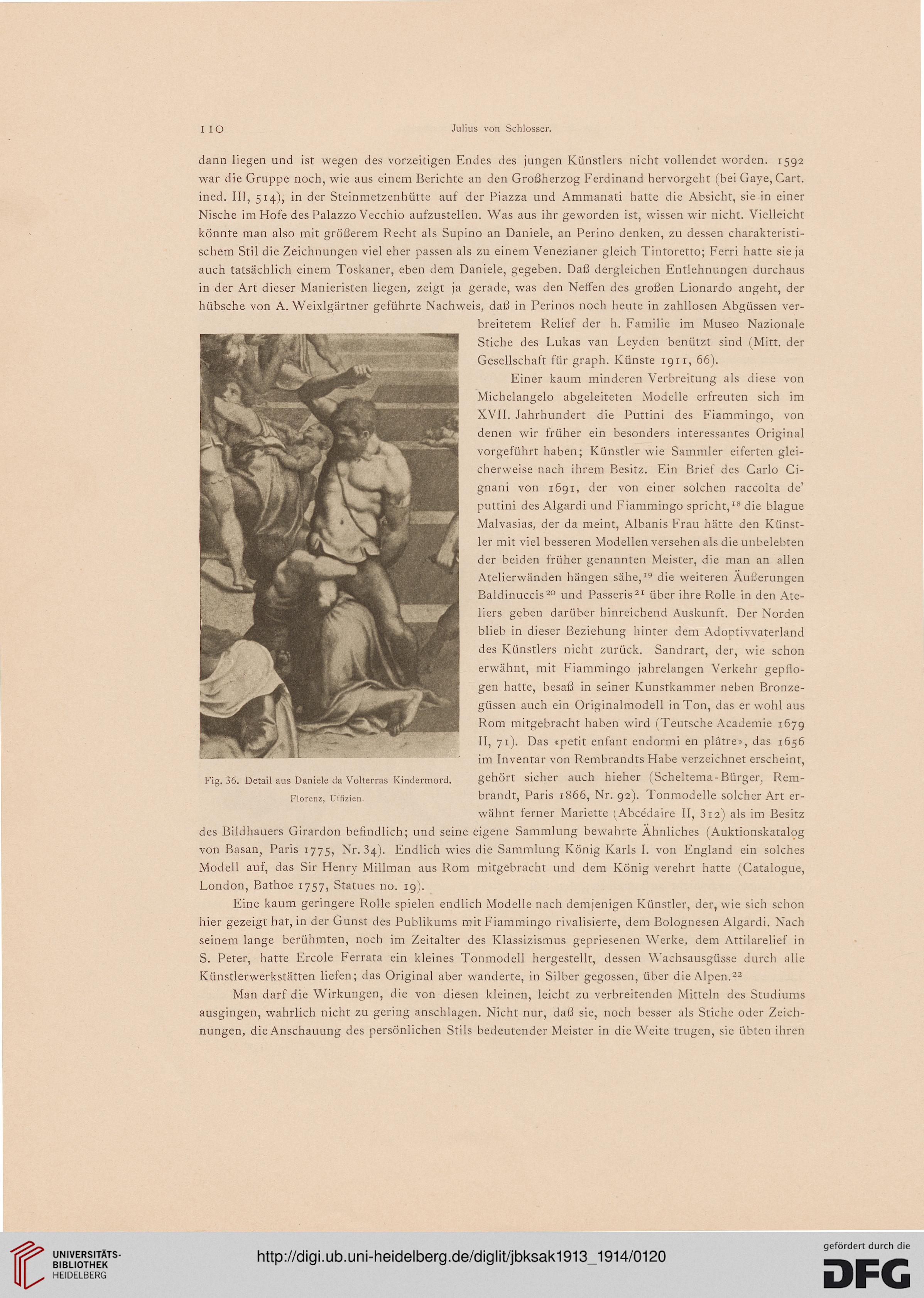I IO
Julius von Schlosser.
dann liegen und ist wegen des vorzeitigen Endes des jungen Künstlers nicht vollendet worden. 1592
war die Gruppe noch, wie aus einem Berichte an den Großherzog Ferdinand hervorgeht (bei Gaye, Cart.
ined. III, 514), in der Steinmetzenhütte auf der Piazza und Ammanati hatte die Absicht, sie in einer
Nische im Hofe des Palazzo Vecchio aufzustellen. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Vielleicht
könnte man also mit größerem Recht als Supino an Daniele, an Perino denken, zu dessen charakteristi-
schem Stil die Zeichnungen viel eher passen als zu einem Venezianer gleich Tintoretto; Ferri hatte sie ja
auch tatsächlich einem Toskaner, eben dem Daniele, gegeben. Daß dergleichen Entlehnungen durchaus
in der Art dieser Manieristen liegen, zeigt ja gerade, was den Neffen des großen Lionardo angeht, der
hübsche von A. Weixlgärtner geführte Nachweis, daß in Perinos noch heute in zahllosen Abgüssen ver-
breitetem Relief der h. Familie im Museo Nazionale
Stiche des Lukas van Leyden benützt sind (Mitt. der
Gesellschaft für graph. Künste 1911, 66).
Einer kaum minderen Verbreitung als diese von
Michelangelo abgeleiteten Modelle erfreuten sich im
XVII. Jahrhundert die Puttini des Fiammingo, von
denen wir früher ein besonders interessantes Original
vorgeführt haben; Künstler wie Sammler eiferten glei-
cherweise nach ihrem Besitz. Ein Brief des Carlo Ci-
gnani von 1691, der von einer solchen raccolta de'
puttini des Algardi und Fiammingo spricht,18 die blague
Malvasias, der da meint, Albanis Frau hätte den Künst-
ler mit viel besseren Modellen versehen als die unbelebten
der beiden früher genannten Meister, die man an allen
Atelierwänden hängen sähe,19 die weiteren Äußerungen
Baldinuccis20 und Passeris21 über ihre Rolle in den Ate-
liers geben darüber hinreichend Auskunft. Der Norden
blieb in dieser Beziehung hinter dem Adoptivvaterland
des Künstlers nicht zurück. Sandrart, der, wie schon
erwähnt, mit Fiammingo jahrelangen Verkehr gepflo-
gen hatte, besaß in seiner Kunstkammer neben Bronze-
güssen auch ein Originalmodell in Ton, das er wohl aus
Rom mitgebracht haben wird (Teutsche Academie 1679
II, 71). Das «petit enfant endormi en plärre», das r656
im Inventar von Rembrandts Habe verzeichnet erscheint,
Fig. 36. Detail aus Daniele da Volterras Kindermord. gehört sicher auch hieher (Scheltema-Bürger, Rem-
Fiorenz, uuizicu. brandt, Paris 1866, Nr. 92). Tonmodelle solcher Art er-
wähnt ferner Mariette (Abcedaire II, 312) als im Besitz
des Bildhauers Girardon befindlich; und seine eigene Sammlung bewahrte Ahnliches (Auktionskatalog
von Basan, Paris 1775, Nr. 34). Endlich wies die Sammlung König Karls I. von England ein solches
Modell auf, das Sir Henry Millman aus Rom mitgebracht und dem König verehrt hatte (Catalogue,
London, Bathoe 1757, Statues 110. 19).
Eine kaum geringere Rolle spielen endlich Modelle nach demjenigen Künstler, der, wie sich schon
hier gezeigt hat, in der Gunst des Publikums mit Fiammingo rivalisierte, dem Bolognesen Algardi. Nach
seinem lange berühmten, noch im Zeitalter des Klassizismus gepriesenen Werke, dem Attilarelief in
S. Peter, hatte Ercole Ferrata ein kleines Tonmodell hergestellt, dessen Wachsausgüsse durch alle
Künstlerwerkstätten liefen; das Original aber wanderte, in Silber gegossen, über die Alpen.22
Man darf die Wirkungen, die von diesen kleinen, leicht zu verbreitenden Mitteln des Studiums
ausgingen, wahrlich nicht zu gering anschlagen. Nicht nur, daß sie, noch besser als Stiche oder Zeich-
nungen, die Anschauung des persönlichen Stils bedeutender Meister in die Weite trugen, sie übten ihren
Julius von Schlosser.
dann liegen und ist wegen des vorzeitigen Endes des jungen Künstlers nicht vollendet worden. 1592
war die Gruppe noch, wie aus einem Berichte an den Großherzog Ferdinand hervorgeht (bei Gaye, Cart.
ined. III, 514), in der Steinmetzenhütte auf der Piazza und Ammanati hatte die Absicht, sie in einer
Nische im Hofe des Palazzo Vecchio aufzustellen. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Vielleicht
könnte man also mit größerem Recht als Supino an Daniele, an Perino denken, zu dessen charakteristi-
schem Stil die Zeichnungen viel eher passen als zu einem Venezianer gleich Tintoretto; Ferri hatte sie ja
auch tatsächlich einem Toskaner, eben dem Daniele, gegeben. Daß dergleichen Entlehnungen durchaus
in der Art dieser Manieristen liegen, zeigt ja gerade, was den Neffen des großen Lionardo angeht, der
hübsche von A. Weixlgärtner geführte Nachweis, daß in Perinos noch heute in zahllosen Abgüssen ver-
breitetem Relief der h. Familie im Museo Nazionale
Stiche des Lukas van Leyden benützt sind (Mitt. der
Gesellschaft für graph. Künste 1911, 66).
Einer kaum minderen Verbreitung als diese von
Michelangelo abgeleiteten Modelle erfreuten sich im
XVII. Jahrhundert die Puttini des Fiammingo, von
denen wir früher ein besonders interessantes Original
vorgeführt haben; Künstler wie Sammler eiferten glei-
cherweise nach ihrem Besitz. Ein Brief des Carlo Ci-
gnani von 1691, der von einer solchen raccolta de'
puttini des Algardi und Fiammingo spricht,18 die blague
Malvasias, der da meint, Albanis Frau hätte den Künst-
ler mit viel besseren Modellen versehen als die unbelebten
der beiden früher genannten Meister, die man an allen
Atelierwänden hängen sähe,19 die weiteren Äußerungen
Baldinuccis20 und Passeris21 über ihre Rolle in den Ate-
liers geben darüber hinreichend Auskunft. Der Norden
blieb in dieser Beziehung hinter dem Adoptivvaterland
des Künstlers nicht zurück. Sandrart, der, wie schon
erwähnt, mit Fiammingo jahrelangen Verkehr gepflo-
gen hatte, besaß in seiner Kunstkammer neben Bronze-
güssen auch ein Originalmodell in Ton, das er wohl aus
Rom mitgebracht haben wird (Teutsche Academie 1679
II, 71). Das «petit enfant endormi en plärre», das r656
im Inventar von Rembrandts Habe verzeichnet erscheint,
Fig. 36. Detail aus Daniele da Volterras Kindermord. gehört sicher auch hieher (Scheltema-Bürger, Rem-
Fiorenz, uuizicu. brandt, Paris 1866, Nr. 92). Tonmodelle solcher Art er-
wähnt ferner Mariette (Abcedaire II, 312) als im Besitz
des Bildhauers Girardon befindlich; und seine eigene Sammlung bewahrte Ahnliches (Auktionskatalog
von Basan, Paris 1775, Nr. 34). Endlich wies die Sammlung König Karls I. von England ein solches
Modell auf, das Sir Henry Millman aus Rom mitgebracht und dem König verehrt hatte (Catalogue,
London, Bathoe 1757, Statues 110. 19).
Eine kaum geringere Rolle spielen endlich Modelle nach demjenigen Künstler, der, wie sich schon
hier gezeigt hat, in der Gunst des Publikums mit Fiammingo rivalisierte, dem Bolognesen Algardi. Nach
seinem lange berühmten, noch im Zeitalter des Klassizismus gepriesenen Werke, dem Attilarelief in
S. Peter, hatte Ercole Ferrata ein kleines Tonmodell hergestellt, dessen Wachsausgüsse durch alle
Künstlerwerkstätten liefen; das Original aber wanderte, in Silber gegossen, über die Alpen.22
Man darf die Wirkungen, die von diesen kleinen, leicht zu verbreitenden Mitteln des Studiums
ausgingen, wahrlich nicht zu gering anschlagen. Nicht nur, daß sie, noch besser als Stiche oder Zeich-
nungen, die Anschauung des persönlichen Stils bedeutender Meister in die Weite trugen, sie übten ihren