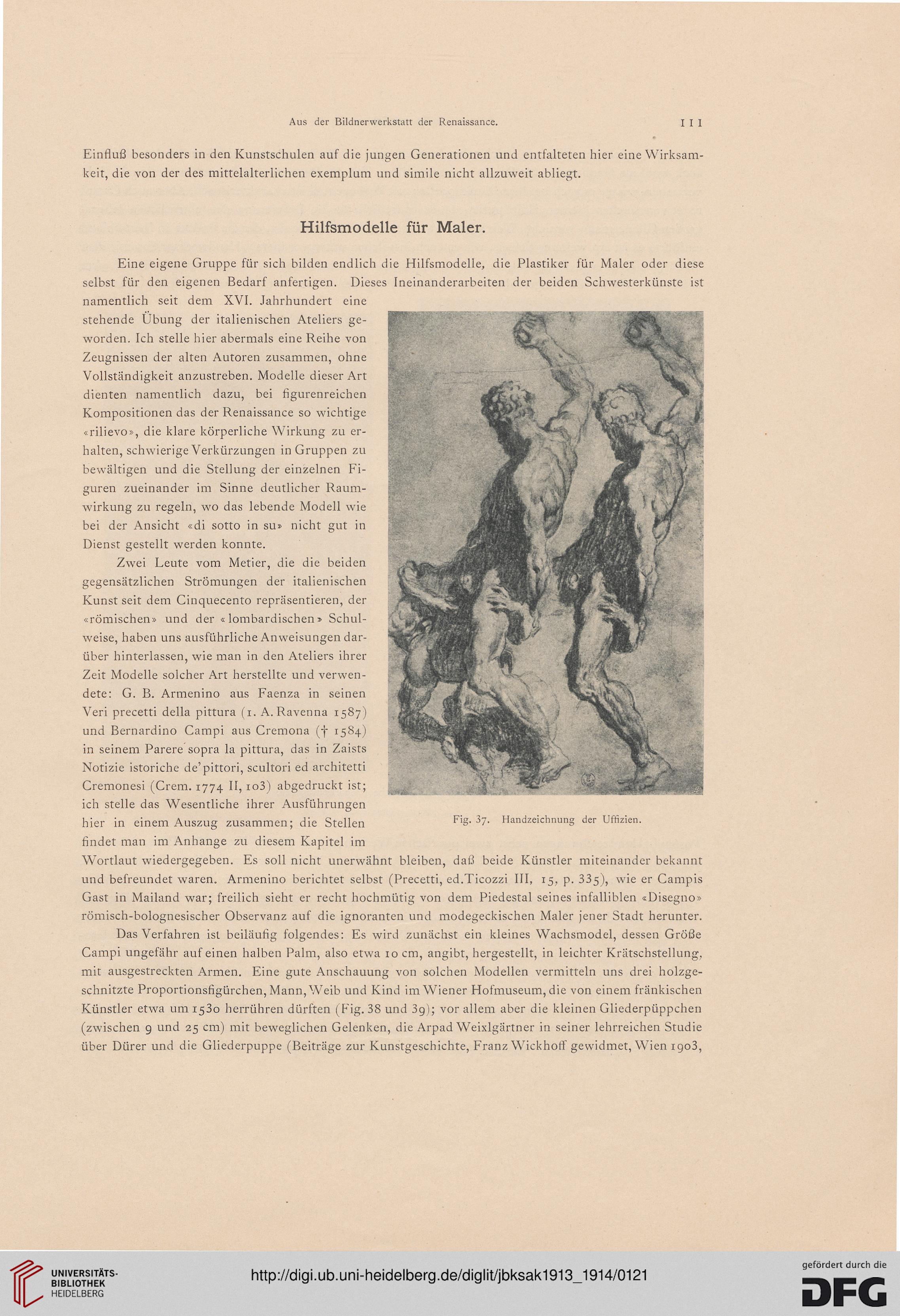Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance. III
Einfluß besonders in den Kunstschulen auf die jungen Generationen und entfalteten hier eine Wirksam-
keit, die von der des mittelalterlichen exemplum und simile nicht allzuweit abliegt.
Hilfsmodelle für Maler.
Eine eigene Gruppe für sich bilden endlich die Hilfsmodelle, die Plastiker für Maler oder diese
selbst für den eigenen Bedarf anfertigen. Dieses Ineinanderarbeiten der beiden Schwesterkünste ist
namentlich seit dem XVI. Jahrhundert eine
stehende Übung der italienischen Ateliers ge-
worden. Ich stelle hier abermals eine Reihe von
Zeugnissen der alten Autoren zusammen, ohne
Vollständigkeit anzustreben. Modelle dieser Art
dienten namentlich dazu, bei figurenreichen
Kompositionen das der Renaissance so wichtige
«rilievo», die klare körperliche Wirkung zu er-
halten, schwierige Verkürzungen in Gruppen zu
bewältigen und die Stellung der einzelnen Fi-
guren zueinander im Sinne deutlicher Raum-
wirkung zu regeln, wo das lebende Modell wie
bei der Ansicht «di sotto in su» nicht gut in
Dienst gestellt werden konnte.
Zwei Leute vom Metier, die die beiden
gegensätzlichen Strömungen der italienischen
Kunst seit dem Cinquecento repräsentieren, der
«römischen» und der « lombardischen > Schul-
weise, haben uns ausführliche Anweisungen dar-
über hinterlassen, wie man in den Ateliers ihrer
Zeit Modelle solcher Art herstellte und verwen-
dete: G. B. Armenino aus Faenza in seinen
Veri precetti della pittura (i. A. Ravenna 1587)
und Bernardino Campi aus Cremona (f 1584)
in seinem Parere sopra la pittura, das in Zaists
Notizie istoriche de'pittori, scultori ed architetti
Cremonesi (Crem. 1774 II, io3) abgedruckt ist;
ich stelle das Wesentliche ihrer Ausführungen
hier in einem Auszug zusammen; die Stellen
findet man im Anhange zu diesem Kapitel im
Wortlaut wiedergegeben. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß beide Künstler miteinander bekannt
und befreundet waren. Armenino berichtet selbst (Precetti, ed.Ticozzi III, 15, p. 335), wie er Campis
Gast in Mailand war; freilich sieht er recht hochmütig von dem Piedestal seines infalliblen «Disegno»
römisch-bolognesischer Observanz auf die ignoranten und modegeckischen Maler jener Stadt herunter.
Das Verfahren ist beiläufig folgendes: Es wird zunächst ein kleines Wachsmodel, dessen Größe
Campi ungefähr auf einen halben Palm, also etwa 10 cm, angibt, hergestellt, in leichter Krätschstellung,
mit ausgestreckten Armen. Eine gute Anschauung von solchen Modellen vermitteln uns drei holzge-
schnitzte Proportionsfigürchen, Mann, Weib und Kind im Wiener Hofmuseum, die von einem fränkischen
Künstler etwa um 1530 herrühren dürften (Fig. 38 und 3g); vor allem aber die kleinen Gliederpüppchen
(zwischen 9 und 25 cm) mit beweglichen Gelenken, die Arpad Weixlgärtner in seiner lehrreichen Studie
über Dürer und die Gliederpuppe (Beiträge zur Kunstgeschichte, Franz Wickhoff gewidmet, Wien igo3,
Fig. 37. Handzeichnung der Ultizien.
Einfluß besonders in den Kunstschulen auf die jungen Generationen und entfalteten hier eine Wirksam-
keit, die von der des mittelalterlichen exemplum und simile nicht allzuweit abliegt.
Hilfsmodelle für Maler.
Eine eigene Gruppe für sich bilden endlich die Hilfsmodelle, die Plastiker für Maler oder diese
selbst für den eigenen Bedarf anfertigen. Dieses Ineinanderarbeiten der beiden Schwesterkünste ist
namentlich seit dem XVI. Jahrhundert eine
stehende Übung der italienischen Ateliers ge-
worden. Ich stelle hier abermals eine Reihe von
Zeugnissen der alten Autoren zusammen, ohne
Vollständigkeit anzustreben. Modelle dieser Art
dienten namentlich dazu, bei figurenreichen
Kompositionen das der Renaissance so wichtige
«rilievo», die klare körperliche Wirkung zu er-
halten, schwierige Verkürzungen in Gruppen zu
bewältigen und die Stellung der einzelnen Fi-
guren zueinander im Sinne deutlicher Raum-
wirkung zu regeln, wo das lebende Modell wie
bei der Ansicht «di sotto in su» nicht gut in
Dienst gestellt werden konnte.
Zwei Leute vom Metier, die die beiden
gegensätzlichen Strömungen der italienischen
Kunst seit dem Cinquecento repräsentieren, der
«römischen» und der « lombardischen > Schul-
weise, haben uns ausführliche Anweisungen dar-
über hinterlassen, wie man in den Ateliers ihrer
Zeit Modelle solcher Art herstellte und verwen-
dete: G. B. Armenino aus Faenza in seinen
Veri precetti della pittura (i. A. Ravenna 1587)
und Bernardino Campi aus Cremona (f 1584)
in seinem Parere sopra la pittura, das in Zaists
Notizie istoriche de'pittori, scultori ed architetti
Cremonesi (Crem. 1774 II, io3) abgedruckt ist;
ich stelle das Wesentliche ihrer Ausführungen
hier in einem Auszug zusammen; die Stellen
findet man im Anhange zu diesem Kapitel im
Wortlaut wiedergegeben. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß beide Künstler miteinander bekannt
und befreundet waren. Armenino berichtet selbst (Precetti, ed.Ticozzi III, 15, p. 335), wie er Campis
Gast in Mailand war; freilich sieht er recht hochmütig von dem Piedestal seines infalliblen «Disegno»
römisch-bolognesischer Observanz auf die ignoranten und modegeckischen Maler jener Stadt herunter.
Das Verfahren ist beiläufig folgendes: Es wird zunächst ein kleines Wachsmodel, dessen Größe
Campi ungefähr auf einen halben Palm, also etwa 10 cm, angibt, hergestellt, in leichter Krätschstellung,
mit ausgestreckten Armen. Eine gute Anschauung von solchen Modellen vermitteln uns drei holzge-
schnitzte Proportionsfigürchen, Mann, Weib und Kind im Wiener Hofmuseum, die von einem fränkischen
Künstler etwa um 1530 herrühren dürften (Fig. 38 und 3g); vor allem aber die kleinen Gliederpüppchen
(zwischen 9 und 25 cm) mit beweglichen Gelenken, die Arpad Weixlgärtner in seiner lehrreichen Studie
über Dürer und die Gliederpuppe (Beiträge zur Kunstgeschichte, Franz Wickhoff gewidmet, Wien igo3,
Fig. 37. Handzeichnung der Ultizien.