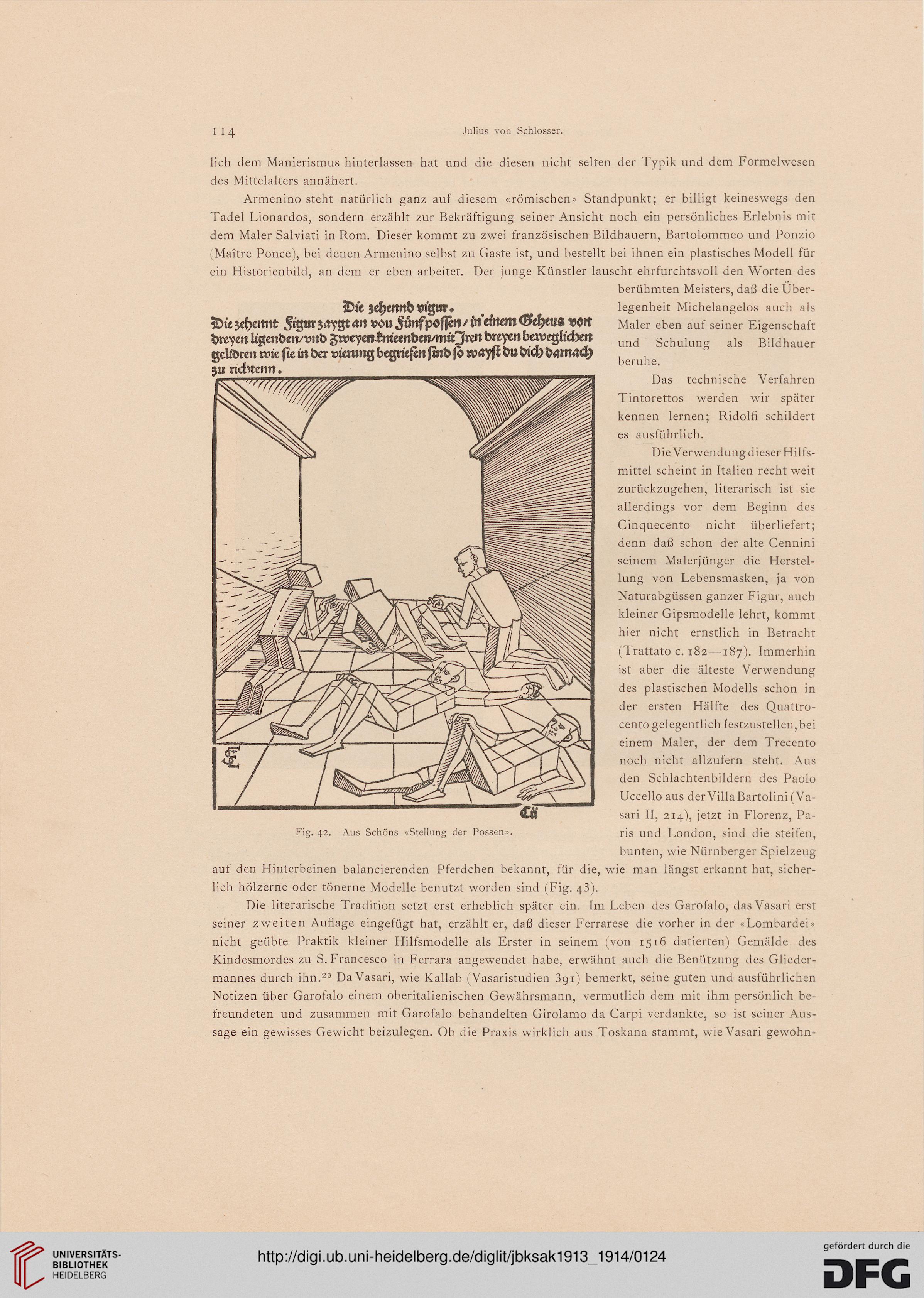Julius von Schlosser.
lieh dem Manierismus hinterlassen hat und die diesen nicht selten der Typik und dem Formelwesen
des Mittelalters annähert.
Armenino steht natürlich ganz auf diesem «römischen» Standpunkt; er billigt keineswegs den
Tadel Lionardos, sondern erzählt zur Bekräftigung seiner Ansicht noch ein persönliches Erlebnis mit
dem Maler Salviati in Rom. Dieser kommt zu zwei französischen Bildhauern, Bartolommeo und Ponzio
i Mattre Ponce), bei denen Armenino selbst zu Gaste ist, und bestellt bei ihnen ein plastisches Modell für
ein Historienbild, an dem er eben arbeitet. Der junge Künstler lauscht ehrfurchtsvoll den Worten des
berühmten Meisters, daß die Uber-
jDl'e JC^ertttbtrigur. legenheit Michelangelos auch als
er eben auf seiner Eigenschaft
fcreyen U9mUnmtt>ivccymhxian^muy^txcymb^U<^ und Schul als Bildhauer
gelforen rote fie tn &er tnmmg begriefeit Jinb fo rody|t OU PW oamaa) b h e
5U nefrtemt._
Das technische Verfahren
Tintorettos werden wir später
kennen lernen; Ridolfi schildert
es ausführlich.
Die Verwendungdieser Hilfs-
mittel scheint in Italien recht weit
zurückzugehen, literarisch ist sie
allerdings vor dem Beginn des
Cinquecento nicht überliefert;
denn daß schon der alte Cennini
seinem Malerjünger die Herstel-
lung von Lebensmasken, ja von
Naturabgüssen ganzer Figur, auch
kleiner Gipsmodelle lehrt, kommt
hier nicht ernstlich in Betracht
(Trattato c. 182—187). Immerhin
ist aber die älteste Verwendung
des plastischen Modells schon in
der ersten Hälfte des Quattro-
cento gelegentlich festzustellen, bei
einem Maler, der dem Trecento
noch nicht allzufern steht. Aus
den Schlachtenbildern des Paolo
Uccello aus der Villa Bartolini (Va-
sari II, 214), jetzt in Florenz, Pa-
ris und London, sind die steifen,
bunten, wie Nürnberger Spielzeug
auf den Hinterbeinen balancierenden Pferdchen bekannt, für die, wie man längst erkannt hat, sicher-
lich hölzerne oder tönerne Modelle benutzt worden sind (Fig. 43).
Die literarische Tradition setzt erst erheblich später ein. Im Leben des Garofalo, dasVasari erst
seiner zweiten Auflage eingefügt hat, erzählt er, daß dieser Ferrarese die vorher in der «Lombardei»
nicht geübte Praktik kleiner Hilfsmodelle als Erster in seinem (von 1516 datierten) Gemälde des
Kindesmordes zu S. Francesco in Ferrara angewendet habe, erwähnt auch die Benützung des Glieder-
mannes durch ihn.23 Da Vasari, wie Kailab (Vasaristudien 3gi) bemerkt, seine guten und ausführlichen
Notizen über Garofalo einem oberitalienischen Gewährsmann, vermutlich dem mit ihm persönlich be-
freundeten und zusammen mit Garofalo behandelten Girolamo da Carpi verdankte, so ist seiner Aus-
sage ein gewisses Gewicht beizulegen. Ob die Praxis wirklich aus Toskana stammt, wie Vasari gewohn-
Fig. 42. Aus Schöns «Stellung der Possen».
lieh dem Manierismus hinterlassen hat und die diesen nicht selten der Typik und dem Formelwesen
des Mittelalters annähert.
Armenino steht natürlich ganz auf diesem «römischen» Standpunkt; er billigt keineswegs den
Tadel Lionardos, sondern erzählt zur Bekräftigung seiner Ansicht noch ein persönliches Erlebnis mit
dem Maler Salviati in Rom. Dieser kommt zu zwei französischen Bildhauern, Bartolommeo und Ponzio
i Mattre Ponce), bei denen Armenino selbst zu Gaste ist, und bestellt bei ihnen ein plastisches Modell für
ein Historienbild, an dem er eben arbeitet. Der junge Künstler lauscht ehrfurchtsvoll den Worten des
berühmten Meisters, daß die Uber-
jDl'e JC^ertttbtrigur. legenheit Michelangelos auch als
er eben auf seiner Eigenschaft
fcreyen U9mUnmtt>ivccymhxian^muy^txcymb^U<^ und Schul als Bildhauer
gelforen rote fie tn &er tnmmg begriefeit Jinb fo rody|t OU PW oamaa) b h e
5U nefrtemt._
Das technische Verfahren
Tintorettos werden wir später
kennen lernen; Ridolfi schildert
es ausführlich.
Die Verwendungdieser Hilfs-
mittel scheint in Italien recht weit
zurückzugehen, literarisch ist sie
allerdings vor dem Beginn des
Cinquecento nicht überliefert;
denn daß schon der alte Cennini
seinem Malerjünger die Herstel-
lung von Lebensmasken, ja von
Naturabgüssen ganzer Figur, auch
kleiner Gipsmodelle lehrt, kommt
hier nicht ernstlich in Betracht
(Trattato c. 182—187). Immerhin
ist aber die älteste Verwendung
des plastischen Modells schon in
der ersten Hälfte des Quattro-
cento gelegentlich festzustellen, bei
einem Maler, der dem Trecento
noch nicht allzufern steht. Aus
den Schlachtenbildern des Paolo
Uccello aus der Villa Bartolini (Va-
sari II, 214), jetzt in Florenz, Pa-
ris und London, sind die steifen,
bunten, wie Nürnberger Spielzeug
auf den Hinterbeinen balancierenden Pferdchen bekannt, für die, wie man längst erkannt hat, sicher-
lich hölzerne oder tönerne Modelle benutzt worden sind (Fig. 43).
Die literarische Tradition setzt erst erheblich später ein. Im Leben des Garofalo, dasVasari erst
seiner zweiten Auflage eingefügt hat, erzählt er, daß dieser Ferrarese die vorher in der «Lombardei»
nicht geübte Praktik kleiner Hilfsmodelle als Erster in seinem (von 1516 datierten) Gemälde des
Kindesmordes zu S. Francesco in Ferrara angewendet habe, erwähnt auch die Benützung des Glieder-
mannes durch ihn.23 Da Vasari, wie Kailab (Vasaristudien 3gi) bemerkt, seine guten und ausführlichen
Notizen über Garofalo einem oberitalienischen Gewährsmann, vermutlich dem mit ihm persönlich be-
freundeten und zusammen mit Garofalo behandelten Girolamo da Carpi verdankte, so ist seiner Aus-
sage ein gewisses Gewicht beizulegen. Ob die Praxis wirklich aus Toskana stammt, wie Vasari gewohn-
Fig. 42. Aus Schöns «Stellung der Possen».