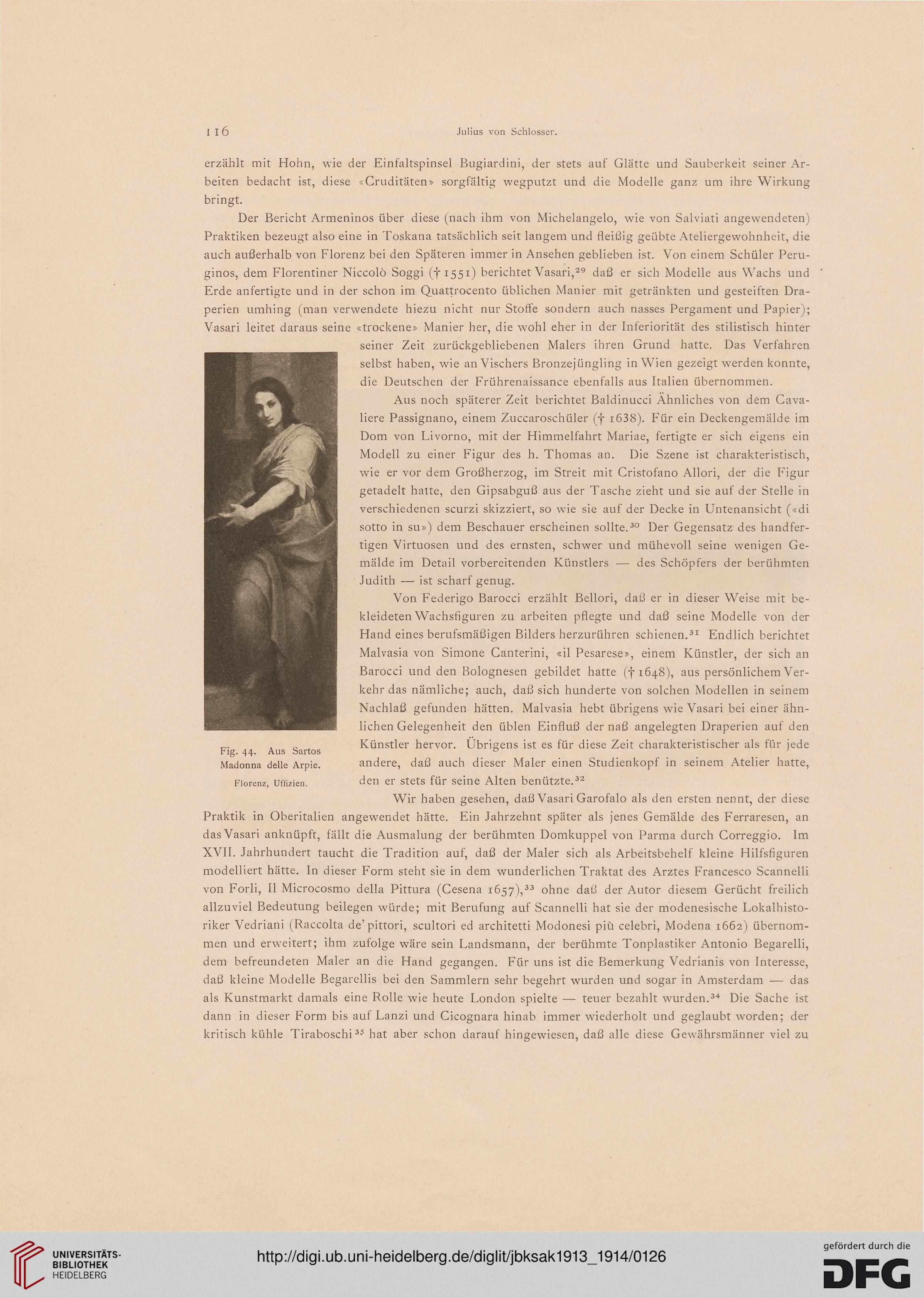Julius von Schlosser.
erzählt mit Hohn, wie der Einfaltspinsel Bugiardini, der stets auf Glätte und Sauberkeit seiner Ar-
beiten bedacht ist, diese «Cruditäten» sorgfältig wegputzt und die Modelle ganz um ihre Wirkung
bringt.
Der Bericht Armeninos über diese (nach ihm von Michelangelo, wie von Salviati angewendeten)
Praktiken bezeugt also eine in Toskana tatsächlich seit langem und fleißig geübte Ateliergewohnheit, die
auch außerhalb von Florenz bei den Späteren immer in Ansehen geblieben ist. Von einem Schüler Peru-
ginos, dem Florentiner Niccolö Soggi (f 1551) berichtet Vasari,29 daß er sich Modelle aus Wachs und
Erde anfertigte und in der schon im Quattrocento üblichen Manier mit getränkten und gesteiften Dra-
perien umhing (man verwendete hiezu nicht nur Stoffe sondern auch nasses Pergament und Papier);
Vasari leitet daraus seine «trockene» Manier her, die wohl eher in der Inferiorität des stilistisch hinter
seiner Zeit zurückgebliebenen Malers ihren Grund hatte. Das Verfahren
selbst haben, wie an Vischers Bronzejüngling in Wien gezeigt werden konnte,
die Deutschen der Frührenaissance ebenfalls aus Italien übernommen.
Aus noch späterer Zeit berichtet Baldinucci Ahnliches von dem Cava-
liere Passignano, einem Zuccaroschüler (f i638). Für ein Deckengemälde im
Dom von Livorno, mit der Himmelfahrt Mariae, fertigte er sich eigens ein
Modell zu einer Figur des h. Thomas an. Die Szene ist charakteristisch,
wie er vor dem Großherzog, im Streit mit Cristofano Allori,
der die Figur
getadelt hatte, den Gipsabguß aus der Tasche zieht und sie auf der Stelle in
verschiedenen scurzi skizziert, so wie sie auf der Decke in Untenansicht («di
sotto in su») dem Beschauer erscheinen sollte.30 Der Gegensatz des handfer-
tigen Virtuosen und des ernsten, schwer und mühevoll seine wenigen Ge-
mälde im Detail vorbereitenden Künstlers — des Schöpfers der berühmten
Judith — ist scharf genug.
Von Federigo Barocci erzählt Bellori, daß er in dieser Weise mit be-
kleideten Wachsfiguren zu arbeiten pflegte und daß seine Modelle von der
Hand eines berufsmäßigen Bilders herzurühren schienen.31 Endlich berichtet
Malvasia von Simone Canterini, «il Pesarese», einem Künstler, der sich an
Barocci und den Bolognesen gebildet hatte (f 1648), aus persönlichem Ver-
kehr das nämliche; auch, daß sich hunderte von solchen Modellen in seinem
Nachlaß gefunden hätten. Malvasia hebt übrigens wie Vasari bei einer ähn-
lichen Gelegenheit den üblen Einfluß der naß angelegten Draperien auf den
Künstler hervor. Übrigens ist es für diese Zeit charakteristischer als für jede
andere, daß auch dieser Maler einen Studienkopf in seinem Atelier hatte,
den er stets für seine Alten benützte.32
Wir haben gesehen, daß Vasari Garofalo als den ersten nennt, der diese
Praktik in Oberitalien angewendet hätte. Ein Jahrzehnt später als jenes Gemälde des Ferraresen, an
das Vasari anknüpft, fällt die Ausmalung der berühmten Domkuppel von Parma durch Correggio. Im
XVII. Jahrhundert taucht die Tradition auf, daß der Maler sich als Arbeitsbehelf kleine Hilfsfiguren
modelliert hätte. In dieser Form steht sie in dem wunderlichen Traktat des Arztes Francesco Scanneiii
von Forli, II Microcosmo della Pittura (Cesena 1657),33 ohne daß der Autor diesem Gerücht freilich
allzuviel Bedeutung beilegen würde; mit Berufung auf Scanneiii hat sie der modenesische Lokalhisto-
riker Vedriani (Raccolta de'pittori, scultori ed architetti Modonesi piü celebri, Modena 1662) übernom-
men und erweitert; ihm zufolge wäre sein Landsmann, der berühmte Tonplastiker Antonio Begarelli,
dem befreundeten Maler an die Hand gegangen. Für uns ist die Bemerkung Vedrianis von Interesse,
daß kleine Modelle Begarellis bei den Sammlern sehr begehrt wurden und sogar in Amsterdam — das
als Kunstmarkt damals eine Rolle wie heute London spielte — teuer bezahlt wurden.34 Die Sache ist
dann in dieser Form bis auf Lanzi und Cicognara hinab immer wiederholt und geglaubt worden; der
kritisch kühle Tiraboschi35 hat aber schon darauf hingewiesen, daß alle diese Gewährsmänner viel zu
Fig. 44. Aus Sartos
Madonna delle Arpie.
Florenz, Uffizien.
erzählt mit Hohn, wie der Einfaltspinsel Bugiardini, der stets auf Glätte und Sauberkeit seiner Ar-
beiten bedacht ist, diese «Cruditäten» sorgfältig wegputzt und die Modelle ganz um ihre Wirkung
bringt.
Der Bericht Armeninos über diese (nach ihm von Michelangelo, wie von Salviati angewendeten)
Praktiken bezeugt also eine in Toskana tatsächlich seit langem und fleißig geübte Ateliergewohnheit, die
auch außerhalb von Florenz bei den Späteren immer in Ansehen geblieben ist. Von einem Schüler Peru-
ginos, dem Florentiner Niccolö Soggi (f 1551) berichtet Vasari,29 daß er sich Modelle aus Wachs und
Erde anfertigte und in der schon im Quattrocento üblichen Manier mit getränkten und gesteiften Dra-
perien umhing (man verwendete hiezu nicht nur Stoffe sondern auch nasses Pergament und Papier);
Vasari leitet daraus seine «trockene» Manier her, die wohl eher in der Inferiorität des stilistisch hinter
seiner Zeit zurückgebliebenen Malers ihren Grund hatte. Das Verfahren
selbst haben, wie an Vischers Bronzejüngling in Wien gezeigt werden konnte,
die Deutschen der Frührenaissance ebenfalls aus Italien übernommen.
Aus noch späterer Zeit berichtet Baldinucci Ahnliches von dem Cava-
liere Passignano, einem Zuccaroschüler (f i638). Für ein Deckengemälde im
Dom von Livorno, mit der Himmelfahrt Mariae, fertigte er sich eigens ein
Modell zu einer Figur des h. Thomas an. Die Szene ist charakteristisch,
wie er vor dem Großherzog, im Streit mit Cristofano Allori,
der die Figur
getadelt hatte, den Gipsabguß aus der Tasche zieht und sie auf der Stelle in
verschiedenen scurzi skizziert, so wie sie auf der Decke in Untenansicht («di
sotto in su») dem Beschauer erscheinen sollte.30 Der Gegensatz des handfer-
tigen Virtuosen und des ernsten, schwer und mühevoll seine wenigen Ge-
mälde im Detail vorbereitenden Künstlers — des Schöpfers der berühmten
Judith — ist scharf genug.
Von Federigo Barocci erzählt Bellori, daß er in dieser Weise mit be-
kleideten Wachsfiguren zu arbeiten pflegte und daß seine Modelle von der
Hand eines berufsmäßigen Bilders herzurühren schienen.31 Endlich berichtet
Malvasia von Simone Canterini, «il Pesarese», einem Künstler, der sich an
Barocci und den Bolognesen gebildet hatte (f 1648), aus persönlichem Ver-
kehr das nämliche; auch, daß sich hunderte von solchen Modellen in seinem
Nachlaß gefunden hätten. Malvasia hebt übrigens wie Vasari bei einer ähn-
lichen Gelegenheit den üblen Einfluß der naß angelegten Draperien auf den
Künstler hervor. Übrigens ist es für diese Zeit charakteristischer als für jede
andere, daß auch dieser Maler einen Studienkopf in seinem Atelier hatte,
den er stets für seine Alten benützte.32
Wir haben gesehen, daß Vasari Garofalo als den ersten nennt, der diese
Praktik in Oberitalien angewendet hätte. Ein Jahrzehnt später als jenes Gemälde des Ferraresen, an
das Vasari anknüpft, fällt die Ausmalung der berühmten Domkuppel von Parma durch Correggio. Im
XVII. Jahrhundert taucht die Tradition auf, daß der Maler sich als Arbeitsbehelf kleine Hilfsfiguren
modelliert hätte. In dieser Form steht sie in dem wunderlichen Traktat des Arztes Francesco Scanneiii
von Forli, II Microcosmo della Pittura (Cesena 1657),33 ohne daß der Autor diesem Gerücht freilich
allzuviel Bedeutung beilegen würde; mit Berufung auf Scanneiii hat sie der modenesische Lokalhisto-
riker Vedriani (Raccolta de'pittori, scultori ed architetti Modonesi piü celebri, Modena 1662) übernom-
men und erweitert; ihm zufolge wäre sein Landsmann, der berühmte Tonplastiker Antonio Begarelli,
dem befreundeten Maler an die Hand gegangen. Für uns ist die Bemerkung Vedrianis von Interesse,
daß kleine Modelle Begarellis bei den Sammlern sehr begehrt wurden und sogar in Amsterdam — das
als Kunstmarkt damals eine Rolle wie heute London spielte — teuer bezahlt wurden.34 Die Sache ist
dann in dieser Form bis auf Lanzi und Cicognara hinab immer wiederholt und geglaubt worden; der
kritisch kühle Tiraboschi35 hat aber schon darauf hingewiesen, daß alle diese Gewährsmänner viel zu
Fig. 44. Aus Sartos
Madonna delle Arpie.
Florenz, Uffizien.