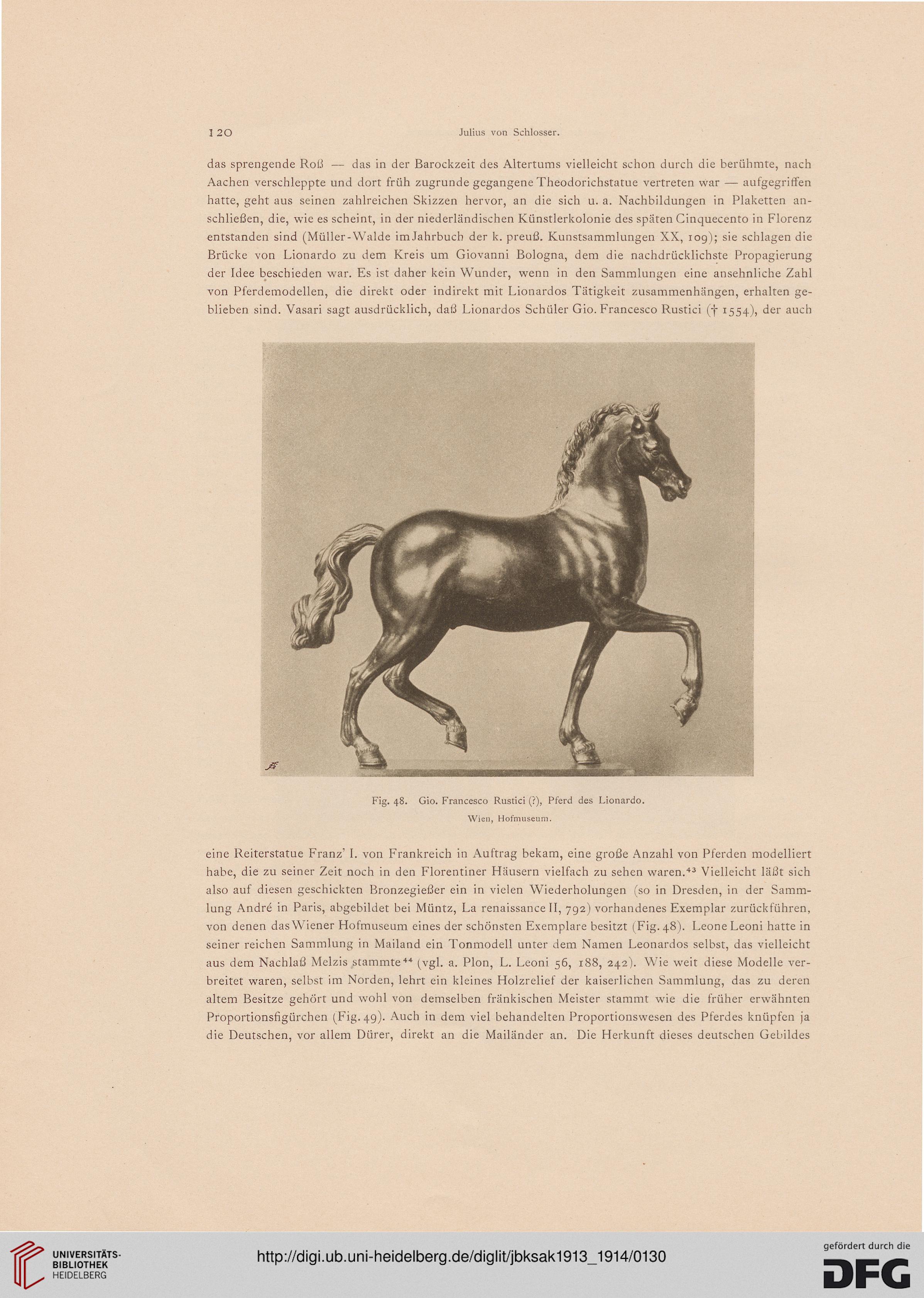1 20
Julius von Schlosser.
das sprengende Roß — das in der Barockzeit des Altertums vielleicht schon durch die berühmte, nach
Aachen verschleppte und dort früh zugrunde gegangene Theodorichstatue vertreten war — aufgegriffen
hatte, geht aus seinen zahlreichen Skizzen hervor, an die sich u. a. Nachbildungen in Plaketten an-
schließen, die, wie es scheint, in der niederländischen Künstlerkolonie des späten Cinquecento in Florenz
entstanden sind (Müller-Walde imJahrbucb der k. preuß. Kunstsammlungen XX, 109); sie schlagen die
Brücke von Lionardo zu dem Kreis um Giovanni Bologna, dem die nachdrücklichste Propagierung
der Idee beschieden war. Es ist daher kein Wunder, wenn in den Sammlungen eine ansehnliche Zahl
von Pferdemodellen, die direkt oder indirekt mit Lionardos Tätigkeit zusammenhängen, erhalten ge-
blieben sind. Vasari sagt ausdrücklich, daß Lionardos Schüler Gio. Francesco Rustici (f 1554), der auch
Fig. 48. Gio. Francesco Rustici (?), Pferd des Lionardo.
Wien, Hofmuseum.
eine Reiterstatue Franz' I. von Frankreich in Auftrag bekam, eine große Anzahl von Pferden modelliert
habe, die zu seiner Zeit noch in den Florentiner Häusern vielfach zu sehen waren.43 Vielleicht läßt sich
also auf diesen geschickten Bronzegießer ein in vielen Wiederholungen (so in Dresden, in der Samm-
lung Andre in Paris, abgebildet bei Müntz, La renaissance II, 792) vorhandenes Exemplar zurückführen,
von denen das Wiener Hofmuseum eines der schönsten Exemplare besitzt (Fig. 48). Leone Leoni hatte in
seiner reichen Sammlung in Mailand ein Tonmodell unter dem Namen Leonardos selbst, das vielleicht
aus dem Nachlaß Melzis stammte44 [vgl. a. Plön, L. Leoni 56, 188, 242). Wie weit diese Modelle ver-
breitet waren, selbst im Norden, lehrt ein kleines Holzrelief der kaiserlichen Sammlung, das zu deren
altem Besitze gehört und wohl von demselben fränkischen Meister stammt wie die früher erwähnten
Proportionsfigürchen (Fig. 49). Auch in dem viel behandelten Proportionswesen des Pferdes knüpfen ja
die Deutschen, vor allem Dürer, direkt an die Mailänder an. Die Herkunft dieses deutschen Gebildes
Julius von Schlosser.
das sprengende Roß — das in der Barockzeit des Altertums vielleicht schon durch die berühmte, nach
Aachen verschleppte und dort früh zugrunde gegangene Theodorichstatue vertreten war — aufgegriffen
hatte, geht aus seinen zahlreichen Skizzen hervor, an die sich u. a. Nachbildungen in Plaketten an-
schließen, die, wie es scheint, in der niederländischen Künstlerkolonie des späten Cinquecento in Florenz
entstanden sind (Müller-Walde imJahrbucb der k. preuß. Kunstsammlungen XX, 109); sie schlagen die
Brücke von Lionardo zu dem Kreis um Giovanni Bologna, dem die nachdrücklichste Propagierung
der Idee beschieden war. Es ist daher kein Wunder, wenn in den Sammlungen eine ansehnliche Zahl
von Pferdemodellen, die direkt oder indirekt mit Lionardos Tätigkeit zusammenhängen, erhalten ge-
blieben sind. Vasari sagt ausdrücklich, daß Lionardos Schüler Gio. Francesco Rustici (f 1554), der auch
Fig. 48. Gio. Francesco Rustici (?), Pferd des Lionardo.
Wien, Hofmuseum.
eine Reiterstatue Franz' I. von Frankreich in Auftrag bekam, eine große Anzahl von Pferden modelliert
habe, die zu seiner Zeit noch in den Florentiner Häusern vielfach zu sehen waren.43 Vielleicht läßt sich
also auf diesen geschickten Bronzegießer ein in vielen Wiederholungen (so in Dresden, in der Samm-
lung Andre in Paris, abgebildet bei Müntz, La renaissance II, 792) vorhandenes Exemplar zurückführen,
von denen das Wiener Hofmuseum eines der schönsten Exemplare besitzt (Fig. 48). Leone Leoni hatte in
seiner reichen Sammlung in Mailand ein Tonmodell unter dem Namen Leonardos selbst, das vielleicht
aus dem Nachlaß Melzis stammte44 [vgl. a. Plön, L. Leoni 56, 188, 242). Wie weit diese Modelle ver-
breitet waren, selbst im Norden, lehrt ein kleines Holzrelief der kaiserlichen Sammlung, das zu deren
altem Besitze gehört und wohl von demselben fränkischen Meister stammt wie die früher erwähnten
Proportionsfigürchen (Fig. 49). Auch in dem viel behandelten Proportionswesen des Pferdes knüpfen ja
die Deutschen, vor allem Dürer, direkt an die Mailänder an. Die Herkunft dieses deutschen Gebildes