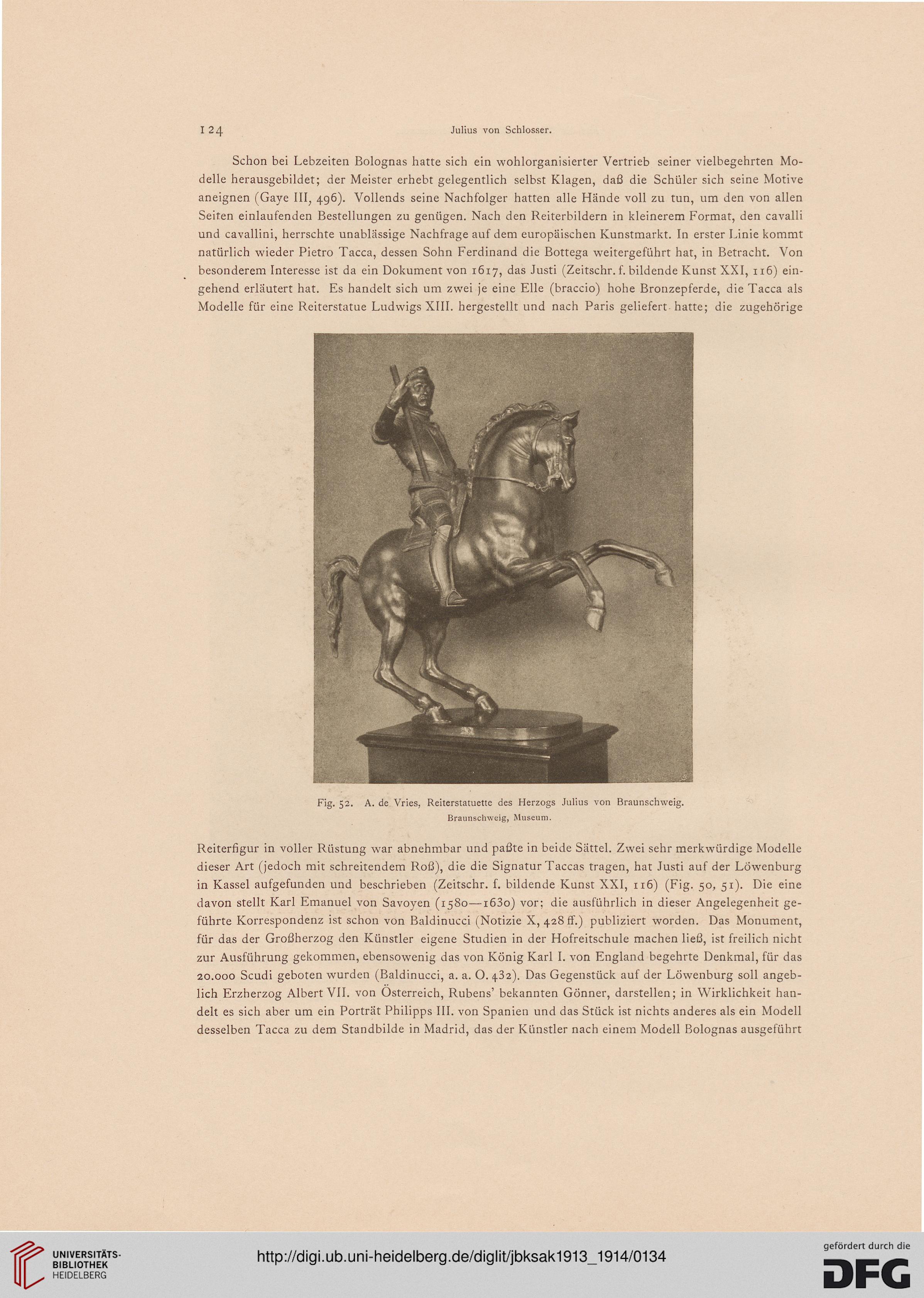Julius von Schlosser.
Schon bei Lebzeiten Bolognas hatte sich ein wohlorganisierter Vertrieb seiner vielbegehrten Mo-
delle herausgebildet; der Meister erhebt gelegentlich selbst Klagen, daß die Schüler sich seine Motive
aneignen (Gaye III, 496). Vollends seine Nachfolger hatten alle Hände voll zu tun, um den von allen
Seiten einlaufenden Bestellungen zu genügen. Nach den Reiterbildern in kleinerem Format, den cavalli
und cavallini, herrschte unablässige Nachfrage auf dem europäischen Kunstmarkt. In erster Linie kommt
natürlich wieder Pietro Tacca, dessen Sohn Ferdinand die Bottega weitergeführt hat, in Betracht. Von
besonderem Interesse ist da ein Dokument von 1617, das Justi (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) ein-
gehend erläutert hat. Es handelt sich um zwei je eine Elle (braccio) hohe Bronzepferde, die Tacca als
Modelle für eine Reiterstatue Ludwigs XIII. hergestellt und nach Paris geliefert hatte; die zugehörige
Fig. 52. A. de Vries, Reiterstatuettc des Herzogs Julius von Braunschweig.
Braunschweig, Museum.
Reiterfigur in voller Rüstung war abnehmbar und paßte in beide Sättel. Zwei sehr merkwürdige Modelle
dieser Art (jedoch mit schreitendem Roß), die die Signatur Taccas tragen, hat Justi auf der Löwenburg
in Kassel aufgefunden und beschrieben (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) (Fig. 50, 51). Die eine
davon stellt Karl Emanuel von Savoyen (1580—i63o) vor; die ausführlich in dieser Angelegenheit ge-
führte Korrespondenz ist schon von Baldinucci (Notizie X, 428 ff.) publiziert worden. Das Monument,
für das der Großherzog den Künstler eigene Studien in der Hofreitschule machen ließ, ist freilich nicht
zur Ausführung gekommen, ebensowenig das von König Karl I. von England begehrte Denkmal, für das
20.000 Scudi geboten wurden (Baldinucci, a. a. O. 432). Das Gegenstück auf der Löwenburg soll angeb-
lich Erzherzog Albert VII. von Osterreich, Rubens' bekannten Gönner, darstellen; in Wirklichkeit han-
delt es sich aber um ein Porträt Philipps III. von Spanien und das Stück ist nichts anderes als ein Modell
desselben Tacca zu dem Standbilde in Madrid, das der Künstler nach einem Modell Bolognas ausgeführt
Schon bei Lebzeiten Bolognas hatte sich ein wohlorganisierter Vertrieb seiner vielbegehrten Mo-
delle herausgebildet; der Meister erhebt gelegentlich selbst Klagen, daß die Schüler sich seine Motive
aneignen (Gaye III, 496). Vollends seine Nachfolger hatten alle Hände voll zu tun, um den von allen
Seiten einlaufenden Bestellungen zu genügen. Nach den Reiterbildern in kleinerem Format, den cavalli
und cavallini, herrschte unablässige Nachfrage auf dem europäischen Kunstmarkt. In erster Linie kommt
natürlich wieder Pietro Tacca, dessen Sohn Ferdinand die Bottega weitergeführt hat, in Betracht. Von
besonderem Interesse ist da ein Dokument von 1617, das Justi (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) ein-
gehend erläutert hat. Es handelt sich um zwei je eine Elle (braccio) hohe Bronzepferde, die Tacca als
Modelle für eine Reiterstatue Ludwigs XIII. hergestellt und nach Paris geliefert hatte; die zugehörige
Fig. 52. A. de Vries, Reiterstatuettc des Herzogs Julius von Braunschweig.
Braunschweig, Museum.
Reiterfigur in voller Rüstung war abnehmbar und paßte in beide Sättel. Zwei sehr merkwürdige Modelle
dieser Art (jedoch mit schreitendem Roß), die die Signatur Taccas tragen, hat Justi auf der Löwenburg
in Kassel aufgefunden und beschrieben (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) (Fig. 50, 51). Die eine
davon stellt Karl Emanuel von Savoyen (1580—i63o) vor; die ausführlich in dieser Angelegenheit ge-
führte Korrespondenz ist schon von Baldinucci (Notizie X, 428 ff.) publiziert worden. Das Monument,
für das der Großherzog den Künstler eigene Studien in der Hofreitschule machen ließ, ist freilich nicht
zur Ausführung gekommen, ebensowenig das von König Karl I. von England begehrte Denkmal, für das
20.000 Scudi geboten wurden (Baldinucci, a. a. O. 432). Das Gegenstück auf der Löwenburg soll angeb-
lich Erzherzog Albert VII. von Osterreich, Rubens' bekannten Gönner, darstellen; in Wirklichkeit han-
delt es sich aber um ein Porträt Philipps III. von Spanien und das Stück ist nichts anderes als ein Modell
desselben Tacca zu dem Standbilde in Madrid, das der Künstler nach einem Modell Bolognas ausgeführt