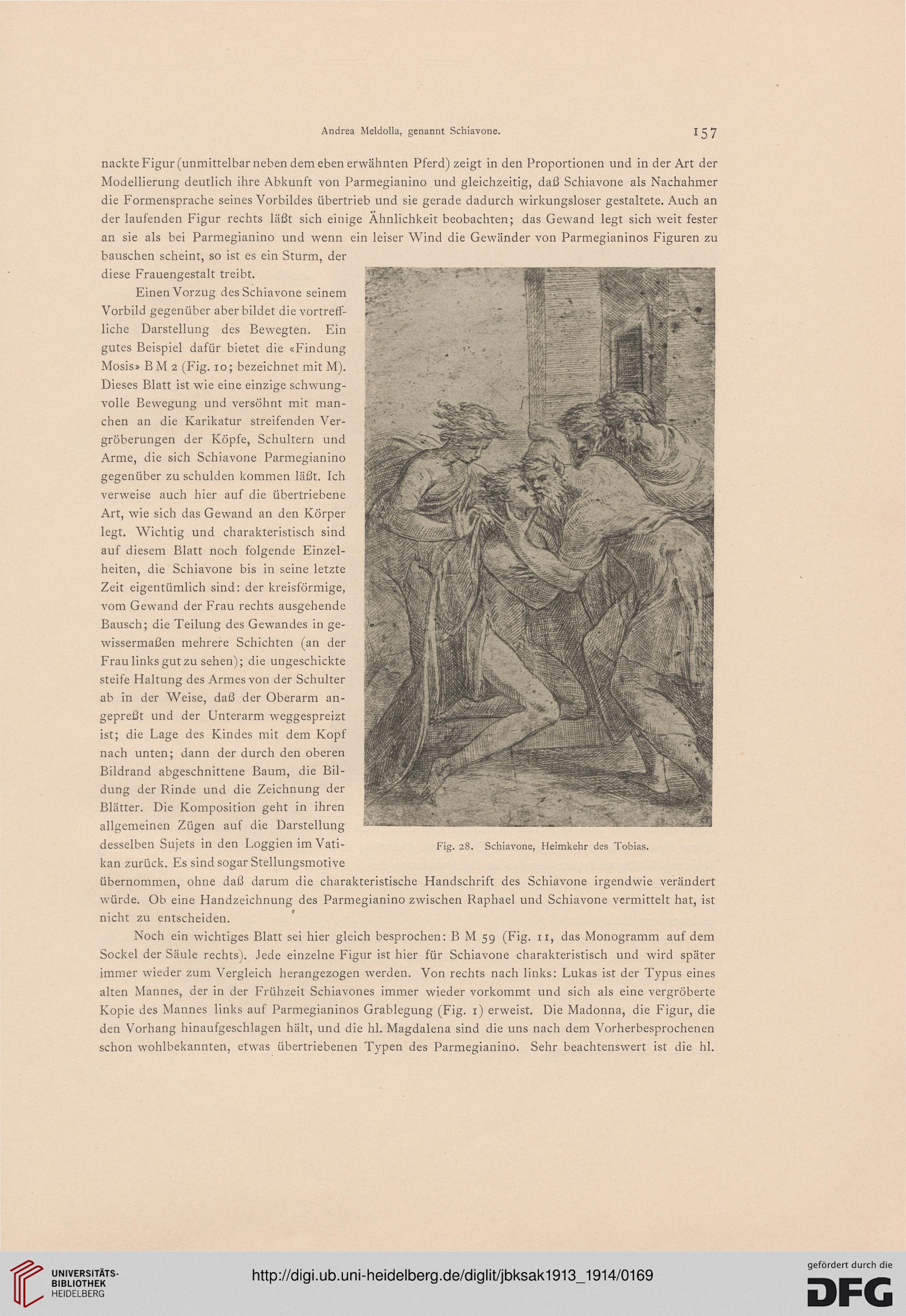Andrea Meldolla, genannt Schiavone.
157
nackte Figur (unmittelbar neben dem eben erwähnten Pferd) zeigt in den Proportionen und in der Art der
Modellierung deutlich ihre Abkunft von Parmegianino und gleichzeitig, daß Schiavone als Nachahmer
die Formensprache seines Vorbildes übertrieb und sie gerade dadurch wirkungsloser gestaltete. Auch an
der laufenden Figur rechts läßt sich einige Ähnlichkeit beobachten; das Gewand legt sich weit fester
an sie als bei Parmegianino und wenn ein leiser Wind die Gewänder von Parmegianinos Figuren zu
bauschen scheint, so ist es ein Sturm, der
diese Frauengestalt treibt.
Einen Vorzug des Schiavone seinem
Vorbild gegenüber aber bildet die vortreff-
liche Darstellung des Bewegten. Ein
gutes Beispiel dafür bietet die «Findung
Mosis» B M 2 (Fig. 10; bezeichnet mit M).
Dieses Blatt ist wie eine einzige schwung-
volle Bewegung und versöhnt mit man-
chen an die Karikatur streifenden Ver-
gröberungen der Köpfe, Schultern und
Arme, die sich Schiavone Parmegianino
gegenüber zu schulden kommen läßt. Ich
verweise auch hier auf die übertriebene
Art, wie sich das Gewand an den Körper
legt. Wichtig und charakteristisch sind
auf diesem Blatt noch folgende Einzel-
heiten, die Schiavone bis in seine letzte
Zeit eigentümlich sind: der kreisförmige,
vom Gewand der Frau rechts ausgehende
Bausch; die Teilung des Gewandes in ge-
wissermaßen mehrere Schichten (an der
Frau links gut zu sehen); die ungeschickte
steife Haltung des Armes von der Schulter
ab in der Weise, daß der Oberarm an-
gepreßt und der Unterarm weggespreizt
ist; die Lage des Kindes mit dem Kopf
nach unten; dann der durch den oberen
Bildrand abgeschnittene Baum, die Bil-
dung der Rinde und die Zeichnung der
Blätter. Die Komposition geht in ihren
allgemeinen Zügen auf die Darstellung
desselben Sujets in den Loggien im Vati-
kan zurück. Es sind sogar Stellungsmotive
übernommen, ohne daß darum die charakteristische Handschrift des Schiavone irgendwie verändert
würde. Ob eine Handzeichnung des Parmegianino zwischen Raphael und Schiavone vermittelt hat, ist
nicht zu entscheiden.
Noch ein wichtiges Blatt sei hier gleich besprochen: B M 59 (Fig. 11, das Monogramm auf dem
Sockel der Säule rechts). Jede einzelne Figur ist hier für Schiavone charakteristisch und wird später
immer wieder zum Vergleich herangezogen werden. Von rechts nach links: Lukas ist der Typus eines
alten Mannes, der in der Frühzeit Schiavones immer wieder vorkommt und sich als eine vergröberte
Kopie des Mannes links auf Parmegianinos Grablegung (Fig. 1) erweist. Die Madonna, die Figur, die
den Vorhang hinaufgeschlagen hält, und die hl. Magdalena sind die uns nach dem Vorherbesprochenen
schon wohlbekannten, etwas übertriebenen Typen des Parmegianino. Sehr beachtenswert ist die hl.
Fig. 28. Schiavone, Heimkehr des Tobias.
157
nackte Figur (unmittelbar neben dem eben erwähnten Pferd) zeigt in den Proportionen und in der Art der
Modellierung deutlich ihre Abkunft von Parmegianino und gleichzeitig, daß Schiavone als Nachahmer
die Formensprache seines Vorbildes übertrieb und sie gerade dadurch wirkungsloser gestaltete. Auch an
der laufenden Figur rechts läßt sich einige Ähnlichkeit beobachten; das Gewand legt sich weit fester
an sie als bei Parmegianino und wenn ein leiser Wind die Gewänder von Parmegianinos Figuren zu
bauschen scheint, so ist es ein Sturm, der
diese Frauengestalt treibt.
Einen Vorzug des Schiavone seinem
Vorbild gegenüber aber bildet die vortreff-
liche Darstellung des Bewegten. Ein
gutes Beispiel dafür bietet die «Findung
Mosis» B M 2 (Fig. 10; bezeichnet mit M).
Dieses Blatt ist wie eine einzige schwung-
volle Bewegung und versöhnt mit man-
chen an die Karikatur streifenden Ver-
gröberungen der Köpfe, Schultern und
Arme, die sich Schiavone Parmegianino
gegenüber zu schulden kommen läßt. Ich
verweise auch hier auf die übertriebene
Art, wie sich das Gewand an den Körper
legt. Wichtig und charakteristisch sind
auf diesem Blatt noch folgende Einzel-
heiten, die Schiavone bis in seine letzte
Zeit eigentümlich sind: der kreisförmige,
vom Gewand der Frau rechts ausgehende
Bausch; die Teilung des Gewandes in ge-
wissermaßen mehrere Schichten (an der
Frau links gut zu sehen); die ungeschickte
steife Haltung des Armes von der Schulter
ab in der Weise, daß der Oberarm an-
gepreßt und der Unterarm weggespreizt
ist; die Lage des Kindes mit dem Kopf
nach unten; dann der durch den oberen
Bildrand abgeschnittene Baum, die Bil-
dung der Rinde und die Zeichnung der
Blätter. Die Komposition geht in ihren
allgemeinen Zügen auf die Darstellung
desselben Sujets in den Loggien im Vati-
kan zurück. Es sind sogar Stellungsmotive
übernommen, ohne daß darum die charakteristische Handschrift des Schiavone irgendwie verändert
würde. Ob eine Handzeichnung des Parmegianino zwischen Raphael und Schiavone vermittelt hat, ist
nicht zu entscheiden.
Noch ein wichtiges Blatt sei hier gleich besprochen: B M 59 (Fig. 11, das Monogramm auf dem
Sockel der Säule rechts). Jede einzelne Figur ist hier für Schiavone charakteristisch und wird später
immer wieder zum Vergleich herangezogen werden. Von rechts nach links: Lukas ist der Typus eines
alten Mannes, der in der Frühzeit Schiavones immer wieder vorkommt und sich als eine vergröberte
Kopie des Mannes links auf Parmegianinos Grablegung (Fig. 1) erweist. Die Madonna, die Figur, die
den Vorhang hinaufgeschlagen hält, und die hl. Magdalena sind die uns nach dem Vorherbesprochenen
schon wohlbekannten, etwas übertriebenen Typen des Parmegianino. Sehr beachtenswert ist die hl.
Fig. 28. Schiavone, Heimkehr des Tobias.