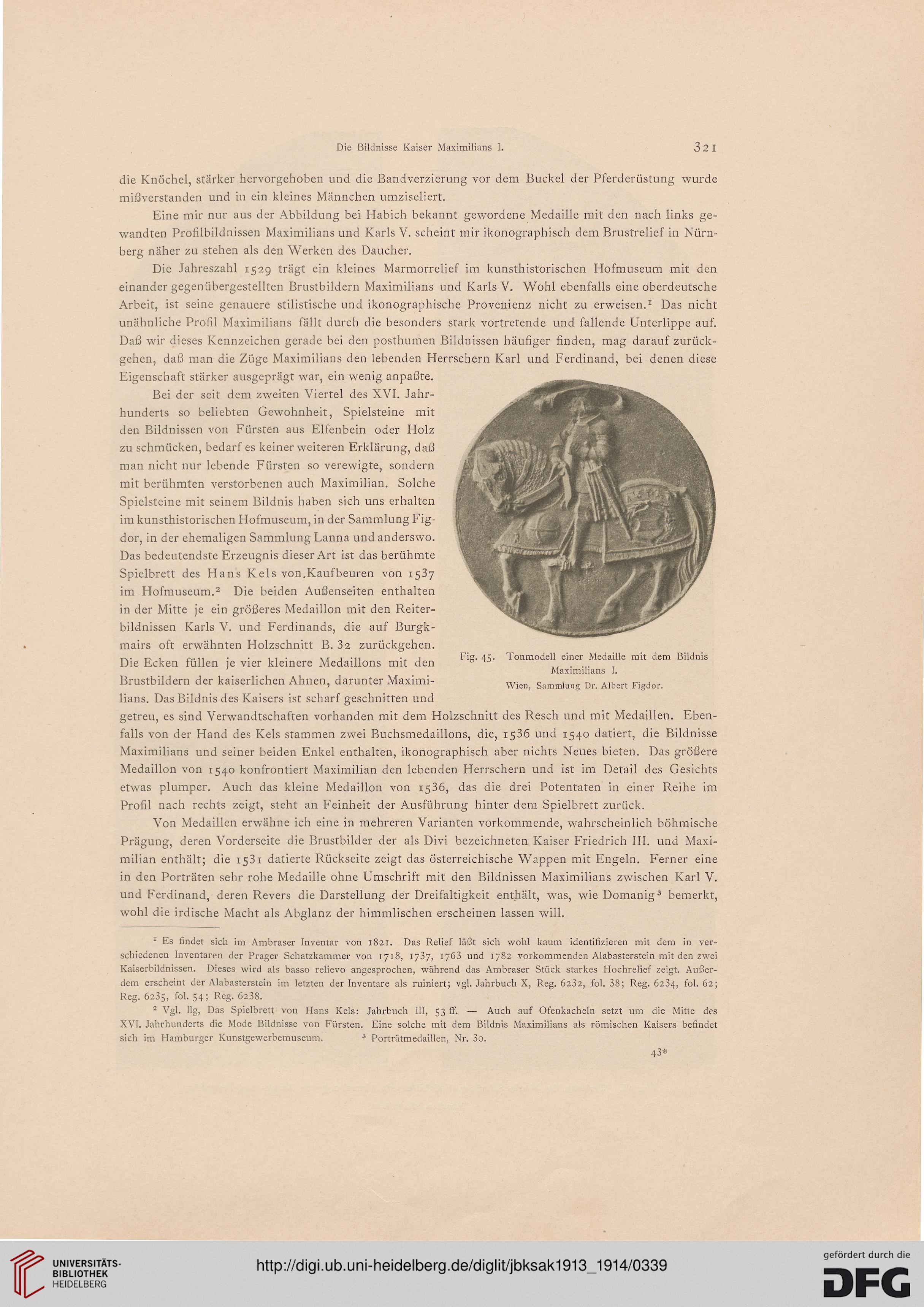Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.
321
die Knöchel, stärker hervorgehoben und die Bandverzierung vor dem Buckel der Pferderüstung wurde
mißverstanden und in ein kleines Männchen umziseliert.
Eine mir nur aus der Abbildung bei Habich bekannt gewordene Medaille mit den nach links ge-
wandten Profilbildnissen Maximilians und Karls V. scheint mir ikonographisch dem Brustrelief in Nürn-
berg näher zu stehen als den Werken des Daucher.
Die Jahreszahl 1529 trägt ein kleines Marmorrelief im kunsthistorischen Hofmuseum mit den
einander gegenübergestellten Brustbildern Maximilians und Karls V. Wohl ebenfalls eine oberdeutsche
Arbeit, ist seine genauere stilistische und ikonographische Provenienz nicht zu erweisen.1 Das nicht
unähnliche Profil Maximilians fällt durch die besonders stark vortretende und fallende Unterlippe auf.
Daß wir dieses Kennzeichen gerade bei den posthumen Bildnissen häufiger finden, mag darauf zurück-
gehen, daß man die Züge Maximilians den lebenden Herrschern Karl und Ferdinand, bei denen diese
Eigenschaft stärker ausgeprägt war, ein wenig anpaßte.
Bei der seit dem zweiten Viertel des XVI. Jahr-
hunderts so beliebten Gewohnheit, Spielsteine mit
den Bildnissen von Fürsten aus Elfenbein oder Holz
zu schmücken, bedarf es keiner weiteren Erklärung, daß
man nicht nur lebende Fürsten so verewigte, sondern
mit berühmten verstorbenen auch Maximilian. Solche
Spielsteine mit seinem Bildnis haben sich uns erhalten
im kunsthistorischen Hofmuseum, in der Sammlung Fig-
dor, in der ehemaligen Sammlung Lanna und anderswo.
Das bedeutendste Erzeugnis dieser Art ist das berühmte
Spielbrett des Hans Kels von.Kaufbeuren von 1537
im Hofmuseum.2 Die beiden Außenseiten enthalten
in der Mitte je ein größeres Medaillon mit den Reiter-
bildnissen Karls V. und Ferdinands, die auf Burgk-
mairs oft erwähnten Holzschnitt B. 32 zurückgehen.
Fig. 45. Tonmodell einer Medaille mit dem Bildnis
Maximilians I.
Wien, Sammlang Dr. Albert Figdor.
Die Ecken füllen je vier kleinere Medaillons mit den
Brustbildern der kaiserlichen Ahnen, darunter Maximi-
lians. Das Bildnis des Kaisers ist scharf geschnitten und
getreu, es sind Verwandtschaften vorhanden mit dem Holzschnitt des Resch und mit Medaillen. Eben-
falls von der Hand des Kels stammen zwei Buchsmedaillons, die, 1536 und 1540 datiert, die Bildnisse
Maximilians und seiner beiden Enkel enthalten, ikonographisch aber nichts Neues bieten. Das größere
Medaillon von 1540 konfrontiert Maximilian den lebenden Herrschern und ist im Detail des Gesichts
etwas plumper. Auch das kleine Medaillon von 1536, das die drei Potentaten in einer Reihe im
Profil nach rechts zeigt, steht an Feinheit der Ausführung hinter dem Spielbrett zurück.
Von Medaillen erwähne ich eine in mehreren Varianten vorkommende, wahrscheinlich böhmische
Prägung, deren Vorderseite die Brustbilder der als Divi bezeichneten Kaiser Friedrich III. und Maxi-
milian enthält; die 1531 datierte Rückseite zeigt das österreichische Wappen mit Engeln. Ferner eine
in den Porträten sehr rohe Medaille ohne Umschrift mit den Bildnissen Maximilians zwischen Karl V.
und Ferdinand, deren Revers die Darstellung der Dreifaltigkeit enthält, was, wie Domanig3 bemerkt,
wohl die irdische Macht als Abglanz der himmlischen erscheinen lassen will.
1 Es findet sich im Ambraser Inventar von 1821. Das Relief läßt sich wohl kaum identifizieren mit dem in ver-
schiedenen Inventaren der Prager Schatzkammer von 1718, 1737, 1763 und 1782 vorkommenden Alabasterstein mit den zwei
Kaiserbildnissen. Dieses wird als basso relievo angesprochen, während das Ambraser Stück starkes Hochrelief zeigt. Außer-
dem erscheint der Alabasterstein im letzten der Inventare als ruiniert; vgl. Jahrbuch X, Reg. 6232, fol. 38; Reg. 6234, fol. 62;
Reg. 6235, fol. 54; Reg. 6238.
2 Vgl. Ilg, Das Spielbrett von Hans Kels: Jahrbuch III, 53 ff. — Auch auf Ofenkacheln setzt um die Mitte des
XVI. Jahrhunderts die Mode Bildnisse von Fürsten. Eine solche mit dem Bildnis Maximilians als römischen Kaisers befindet
sich im Hamburger Kunstgewerbemuseum. 3 Porträtmedaillen, Nr. 3o.
43*
321
die Knöchel, stärker hervorgehoben und die Bandverzierung vor dem Buckel der Pferderüstung wurde
mißverstanden und in ein kleines Männchen umziseliert.
Eine mir nur aus der Abbildung bei Habich bekannt gewordene Medaille mit den nach links ge-
wandten Profilbildnissen Maximilians und Karls V. scheint mir ikonographisch dem Brustrelief in Nürn-
berg näher zu stehen als den Werken des Daucher.
Die Jahreszahl 1529 trägt ein kleines Marmorrelief im kunsthistorischen Hofmuseum mit den
einander gegenübergestellten Brustbildern Maximilians und Karls V. Wohl ebenfalls eine oberdeutsche
Arbeit, ist seine genauere stilistische und ikonographische Provenienz nicht zu erweisen.1 Das nicht
unähnliche Profil Maximilians fällt durch die besonders stark vortretende und fallende Unterlippe auf.
Daß wir dieses Kennzeichen gerade bei den posthumen Bildnissen häufiger finden, mag darauf zurück-
gehen, daß man die Züge Maximilians den lebenden Herrschern Karl und Ferdinand, bei denen diese
Eigenschaft stärker ausgeprägt war, ein wenig anpaßte.
Bei der seit dem zweiten Viertel des XVI. Jahr-
hunderts so beliebten Gewohnheit, Spielsteine mit
den Bildnissen von Fürsten aus Elfenbein oder Holz
zu schmücken, bedarf es keiner weiteren Erklärung, daß
man nicht nur lebende Fürsten so verewigte, sondern
mit berühmten verstorbenen auch Maximilian. Solche
Spielsteine mit seinem Bildnis haben sich uns erhalten
im kunsthistorischen Hofmuseum, in der Sammlung Fig-
dor, in der ehemaligen Sammlung Lanna und anderswo.
Das bedeutendste Erzeugnis dieser Art ist das berühmte
Spielbrett des Hans Kels von.Kaufbeuren von 1537
im Hofmuseum.2 Die beiden Außenseiten enthalten
in der Mitte je ein größeres Medaillon mit den Reiter-
bildnissen Karls V. und Ferdinands, die auf Burgk-
mairs oft erwähnten Holzschnitt B. 32 zurückgehen.
Fig. 45. Tonmodell einer Medaille mit dem Bildnis
Maximilians I.
Wien, Sammlang Dr. Albert Figdor.
Die Ecken füllen je vier kleinere Medaillons mit den
Brustbildern der kaiserlichen Ahnen, darunter Maximi-
lians. Das Bildnis des Kaisers ist scharf geschnitten und
getreu, es sind Verwandtschaften vorhanden mit dem Holzschnitt des Resch und mit Medaillen. Eben-
falls von der Hand des Kels stammen zwei Buchsmedaillons, die, 1536 und 1540 datiert, die Bildnisse
Maximilians und seiner beiden Enkel enthalten, ikonographisch aber nichts Neues bieten. Das größere
Medaillon von 1540 konfrontiert Maximilian den lebenden Herrschern und ist im Detail des Gesichts
etwas plumper. Auch das kleine Medaillon von 1536, das die drei Potentaten in einer Reihe im
Profil nach rechts zeigt, steht an Feinheit der Ausführung hinter dem Spielbrett zurück.
Von Medaillen erwähne ich eine in mehreren Varianten vorkommende, wahrscheinlich böhmische
Prägung, deren Vorderseite die Brustbilder der als Divi bezeichneten Kaiser Friedrich III. und Maxi-
milian enthält; die 1531 datierte Rückseite zeigt das österreichische Wappen mit Engeln. Ferner eine
in den Porträten sehr rohe Medaille ohne Umschrift mit den Bildnissen Maximilians zwischen Karl V.
und Ferdinand, deren Revers die Darstellung der Dreifaltigkeit enthält, was, wie Domanig3 bemerkt,
wohl die irdische Macht als Abglanz der himmlischen erscheinen lassen will.
1 Es findet sich im Ambraser Inventar von 1821. Das Relief läßt sich wohl kaum identifizieren mit dem in ver-
schiedenen Inventaren der Prager Schatzkammer von 1718, 1737, 1763 und 1782 vorkommenden Alabasterstein mit den zwei
Kaiserbildnissen. Dieses wird als basso relievo angesprochen, während das Ambraser Stück starkes Hochrelief zeigt. Außer-
dem erscheint der Alabasterstein im letzten der Inventare als ruiniert; vgl. Jahrbuch X, Reg. 6232, fol. 38; Reg. 6234, fol. 62;
Reg. 6235, fol. 54; Reg. 6238.
2 Vgl. Ilg, Das Spielbrett von Hans Kels: Jahrbuch III, 53 ff. — Auch auf Ofenkacheln setzt um die Mitte des
XVI. Jahrhunderts die Mode Bildnisse von Fürsten. Eine solche mit dem Bildnis Maximilians als römischen Kaisers befindet
sich im Hamburger Kunstgewerbemuseum. 3 Porträtmedaillen, Nr. 3o.
43*