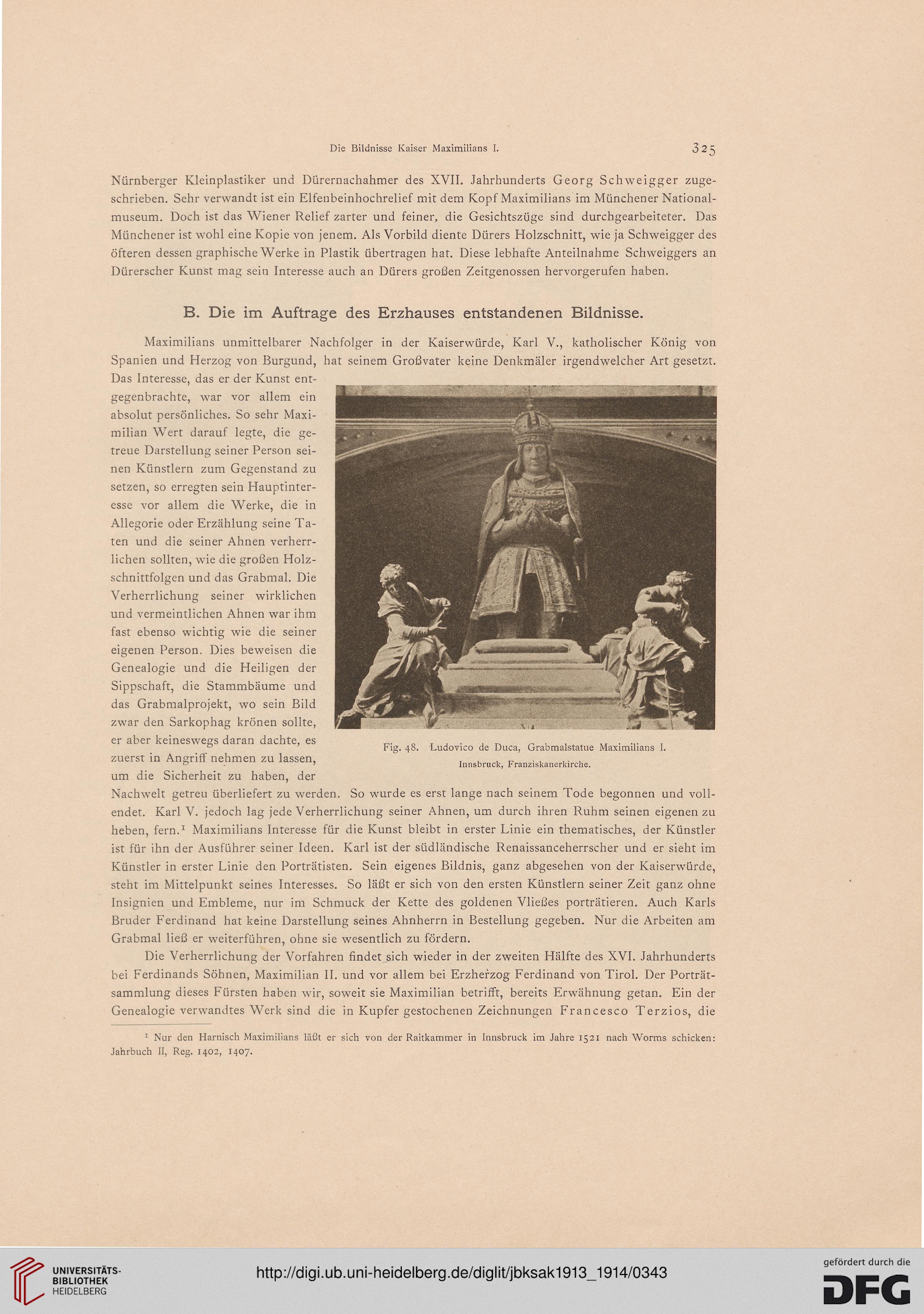Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.
325
Nürnberger Kleinplastiker und Dürernachahmer des XVII. Jahrhunderts Georg Schweigger zuge-
schrieben. Sehr verwandt ist ein Elfenbeinhochrelief mit dem Kopf Maximilians im Münchener National-
museum. Doch ist das Wiener Relief zarter und feiner, die Gesichtszüge sind durchgearbeiteter. Das
Münchener ist wohl eine Kopie von jenem. Als Vorbild diente Dürers Holzschnitt, wie ja Schweigger des
öfteren dessen graphische Werke in Plastik übertragen hat. Diese lebhafte Anteilnahme Schweiggers an
Dürerscher Kunst mag sein Interesse auch an Dürers großen Zeitgenossen hervorgerufen haben.
B. Die im Auftrage des Erzhauses entstandenen Bildnisse.
Maximilians unmittelbarer Nachfolger in der Kaiserwürde, Karl V., katholischer König von
Spanien und Herzog von Burgund, hat seinem Großvater keine Denkmäler irgendwelcher Art gesetzt.
Das Interesse, das er der Kunst ent-
gegenbrachte, war vor allem ein
absolut persönliches. So sehr Maxi-
milian Wert darauf legte, die ge-
treue Darstellung seiner Person sei-
nen Künstlern zum Gegenstand zu
setzen, so erregten sein Hauptinter-
esse vor allem die Werke, die in
Allegorie oder Erzählung seine Ta-
ten und die seiner Ahnen verherr-
lichen sollten, wie die großen Holz-
schnittfolgen und das Grabmal. Die
Verherrlichung seiner wirklichen
und vermeintlichen Ahnen war ihm
fast ebenso wichtig wie die seiner
eigenen Person. Dies beweisen die
Genealogie und die Heiligen der
Sippschaft, die Stammbäume und
das Grabmalprojekt, wo sein Bild
zwar den Sarkophag krönen sollte,
er aber keineswegs daran dachte, es
zuerst in Angriff nehmen zu lassen,
um die Sicherheit zu haben, der
Nachwelt getreu überliefert zu werden. So wurde es erst lange nach seinem Tode begonnen und voll-
endet. Karl V. jedoch lag jede Verherrlichung seiner Ahnen, um durch ihren Ruhm seinen eigenen zu
heben, fern.1 Maximilians Interesse für die Kunst bleibt in erster Linie ein thematisches, der Künstler
ist für ihn der Ausführer seiner Ideen. Karl ist der südländische Renaissanceherrscher und er sieht im
Künstler in erster Linie den Porträtisten. Sein eigenes Bildnis, ganz abgesehen von der Kaiserwürde,
steht im Mittelpunkt seines Interesses. So läßt er sich von den ersten Künstlern seiner Zeit ganz ohne
Insignien und Embleme, nur im Schmuck der Kette des goldenen Vließes porträtieren. Auch Karls
Bruder Ferdinand hat keine Darstellung seines Ahnherrn in Bestellung gegeben. Nur die Arbeiten am
Grabmal ließ er weiterführen, ohne sie wesentlich zu fördern.
Die Verherrlichung der Vorfahren findet sich wieder in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts
bei Ferdinands Söhnen, Maximilian II. und vor allem bei Erzherzog Ferdinand von Tirol. Der Porträt-
sammlung dieses Fürsten haben wir, soweit sie Maximilian betrifft, bereits Erwähnung getan. Ein der
Genealogie verwandtes Werk sind die in Kupfer gestochenen Zeichnungen Francesco Terzios, die
1 Nur den Harnisch Maximilians läßt er sich von der Raitkammer in Innsbruck im Jahre 1521 nach Worms schicken:
Jahrbuch II, Reg. 1402, 1407.
Fig. 48. Ludovico de Duca, Grabmalstatue Maximilians I.
Innsbruck, Franziskanerkirche.
325
Nürnberger Kleinplastiker und Dürernachahmer des XVII. Jahrhunderts Georg Schweigger zuge-
schrieben. Sehr verwandt ist ein Elfenbeinhochrelief mit dem Kopf Maximilians im Münchener National-
museum. Doch ist das Wiener Relief zarter und feiner, die Gesichtszüge sind durchgearbeiteter. Das
Münchener ist wohl eine Kopie von jenem. Als Vorbild diente Dürers Holzschnitt, wie ja Schweigger des
öfteren dessen graphische Werke in Plastik übertragen hat. Diese lebhafte Anteilnahme Schweiggers an
Dürerscher Kunst mag sein Interesse auch an Dürers großen Zeitgenossen hervorgerufen haben.
B. Die im Auftrage des Erzhauses entstandenen Bildnisse.
Maximilians unmittelbarer Nachfolger in der Kaiserwürde, Karl V., katholischer König von
Spanien und Herzog von Burgund, hat seinem Großvater keine Denkmäler irgendwelcher Art gesetzt.
Das Interesse, das er der Kunst ent-
gegenbrachte, war vor allem ein
absolut persönliches. So sehr Maxi-
milian Wert darauf legte, die ge-
treue Darstellung seiner Person sei-
nen Künstlern zum Gegenstand zu
setzen, so erregten sein Hauptinter-
esse vor allem die Werke, die in
Allegorie oder Erzählung seine Ta-
ten und die seiner Ahnen verherr-
lichen sollten, wie die großen Holz-
schnittfolgen und das Grabmal. Die
Verherrlichung seiner wirklichen
und vermeintlichen Ahnen war ihm
fast ebenso wichtig wie die seiner
eigenen Person. Dies beweisen die
Genealogie und die Heiligen der
Sippschaft, die Stammbäume und
das Grabmalprojekt, wo sein Bild
zwar den Sarkophag krönen sollte,
er aber keineswegs daran dachte, es
zuerst in Angriff nehmen zu lassen,
um die Sicherheit zu haben, der
Nachwelt getreu überliefert zu werden. So wurde es erst lange nach seinem Tode begonnen und voll-
endet. Karl V. jedoch lag jede Verherrlichung seiner Ahnen, um durch ihren Ruhm seinen eigenen zu
heben, fern.1 Maximilians Interesse für die Kunst bleibt in erster Linie ein thematisches, der Künstler
ist für ihn der Ausführer seiner Ideen. Karl ist der südländische Renaissanceherrscher und er sieht im
Künstler in erster Linie den Porträtisten. Sein eigenes Bildnis, ganz abgesehen von der Kaiserwürde,
steht im Mittelpunkt seines Interesses. So läßt er sich von den ersten Künstlern seiner Zeit ganz ohne
Insignien und Embleme, nur im Schmuck der Kette des goldenen Vließes porträtieren. Auch Karls
Bruder Ferdinand hat keine Darstellung seines Ahnherrn in Bestellung gegeben. Nur die Arbeiten am
Grabmal ließ er weiterführen, ohne sie wesentlich zu fördern.
Die Verherrlichung der Vorfahren findet sich wieder in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts
bei Ferdinands Söhnen, Maximilian II. und vor allem bei Erzherzog Ferdinand von Tirol. Der Porträt-
sammlung dieses Fürsten haben wir, soweit sie Maximilian betrifft, bereits Erwähnung getan. Ein der
Genealogie verwandtes Werk sind die in Kupfer gestochenen Zeichnungen Francesco Terzios, die
1 Nur den Harnisch Maximilians läßt er sich von der Raitkammer in Innsbruck im Jahre 1521 nach Worms schicken:
Jahrbuch II, Reg. 1402, 1407.
Fig. 48. Ludovico de Duca, Grabmalstatue Maximilians I.
Innsbruck, Franziskanerkirche.