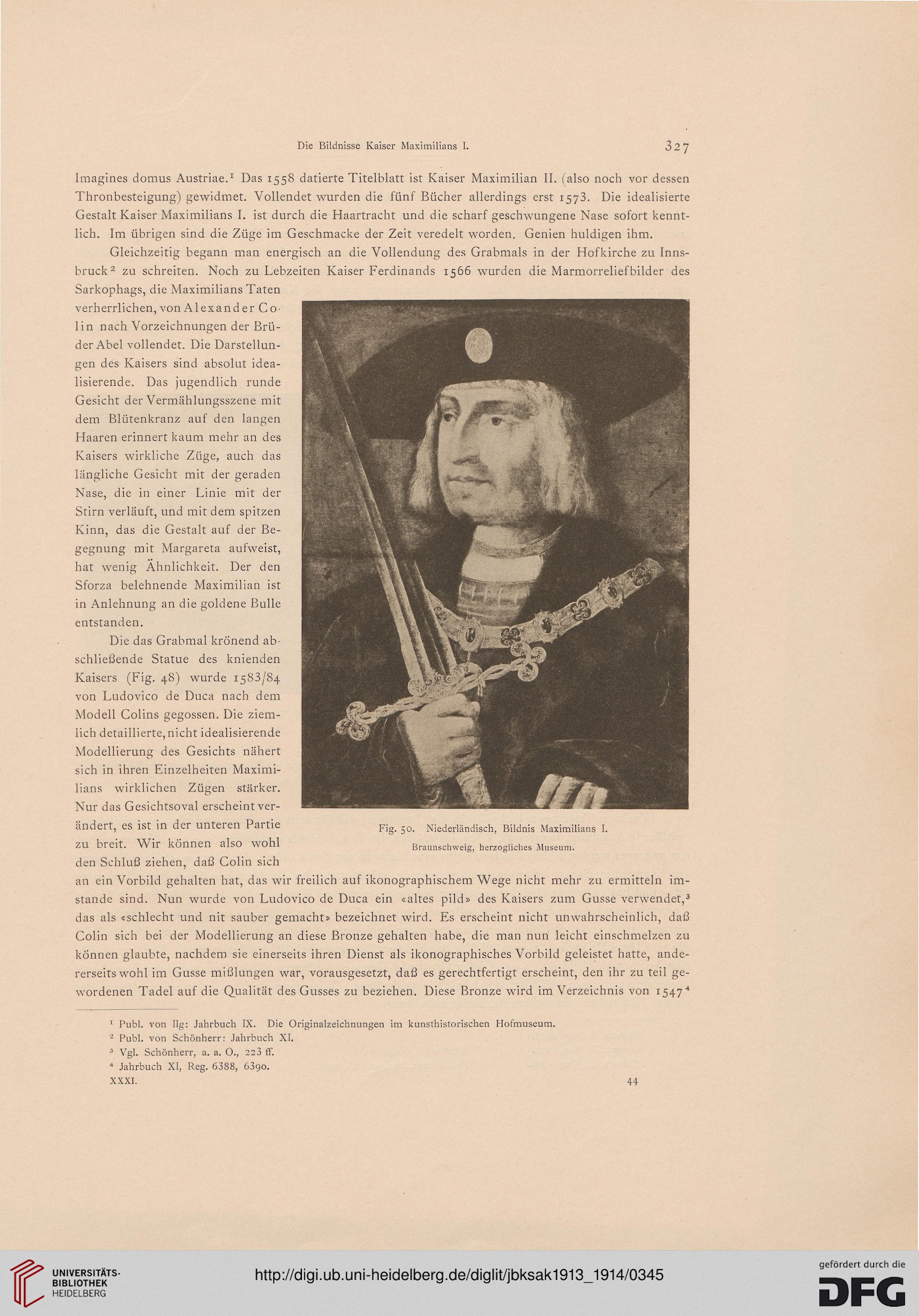Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.
327
Imagines domus Austriae.1 Das 1558 datierte Titelblatt ist Kaiser Maximilian II. (also noch vor dessen
Thronbesteigung) gewidmet. Vollendet wurden die fünf Bücher allerdings erst 1573. Die idealisierte
Gestalt Kaiser Maximilians I. ist durch die Haartracht und die scharf geschwungene Nase sofort kennt-
lich. Im übrigen sind die Züge im Geschmacke der Zeit veredelt worden. Genien huldigen ihm.
Gleichzeitig begann man energisch an die Vollendung des Grabmals in der Hofkirche zu Inns-
bruck2 zu schreiten. Noch zu Lebzeiten Kaiser Ferdinands 1566 wurden die Marmorreliefbilder des
Sarkophags, die Maximilians Taten
verherrlichen, von Alexander Co-
lin nach Vorzeichnungen der Brü-
der Abel vollendet. Die Darstellun-
gen des Kaisers sind absolut idea-
lisierende. Das jugendlich runde
Gesicht der Vermählungsszene mit
dem Blütenkranz auf den langen
Haaren erinnert kaum mehr an des
Kaisers wirkliche Züge, auch das
längliche Gesicht mit der geraden
Nase, die in einer Linie mit der
Stirn verläuft, und mit dem spitzen
Kinn, das die Gestalt auf der Be-
gegnung mit Margareta aufweist,
hat wenig Ähnlichkeit. Der den
Sforza belehnende Maximilian ist
in Anlehnung an die goldene Bulle
entstanden.
Die das Grabmal krönend ab-
schließende Statue des knienden
Kaisers (Fig. 48) wurde 1583/84
von Ludovico de Duca nach dem
Modell Colins gegossen. Die ziem-
lich detaillierte,nicht idealisierende
Modellierung des Gesichts nähert
sich in ihren Einzelheiten Maximi-
lians wirklichen Zügen stärker.
Nur das Gesichtsoval erscheint ver-
ändert, es ist in der unteren Partie
zu breit. Wir können also wohl
den Schluß ziehen, daß Colin sich
an ein Vorbild gehalten hat, das wir freilich auf ikonographischem Wege nicht mehr zu ermitteln im-
stande sind. Nun wurde von Ludovico de Duca ein «altes pild» des Kaisers zum Gusse verwendet,3
das als «schlecht und nit sauber gemacht» bezeichnet wird. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß
Colin sich bei der Modellierung an diese Bronze gehalten habe, die man nun leicht einschmelzen zu
können glaubte, nachdem sie einerseits ihren Dienst als ikonographisches Vorbild geleistet hatte, ande-
rerseits wohl im Gusse mißlungen war, vorausgesetzt, daß es gerechtfertigt erscheint, den ihr zu teil ge-
wordenen Tadel auf die Qualität des Gusses zu beziehen. Diese Bronze wird im Verzeichnis von 1547 4
Fig.
o. Niederländisch, Bildnis Maximilians I.
Braunschweig, herzogliches Museum.
1 Publ. von Ilg: Jahrbuch IX. Die Originalzeichnungen im kunsthistorischen Hofmuseum.
2 Publ. von Schönherr: Jahrbuch XI.
3 Vgl. Schönherr, a. a. O., 223 ff.
4 Jahrbuch XI, Reg. 6388, 6390.
XXXI.
44
327
Imagines domus Austriae.1 Das 1558 datierte Titelblatt ist Kaiser Maximilian II. (also noch vor dessen
Thronbesteigung) gewidmet. Vollendet wurden die fünf Bücher allerdings erst 1573. Die idealisierte
Gestalt Kaiser Maximilians I. ist durch die Haartracht und die scharf geschwungene Nase sofort kennt-
lich. Im übrigen sind die Züge im Geschmacke der Zeit veredelt worden. Genien huldigen ihm.
Gleichzeitig begann man energisch an die Vollendung des Grabmals in der Hofkirche zu Inns-
bruck2 zu schreiten. Noch zu Lebzeiten Kaiser Ferdinands 1566 wurden die Marmorreliefbilder des
Sarkophags, die Maximilians Taten
verherrlichen, von Alexander Co-
lin nach Vorzeichnungen der Brü-
der Abel vollendet. Die Darstellun-
gen des Kaisers sind absolut idea-
lisierende. Das jugendlich runde
Gesicht der Vermählungsszene mit
dem Blütenkranz auf den langen
Haaren erinnert kaum mehr an des
Kaisers wirkliche Züge, auch das
längliche Gesicht mit der geraden
Nase, die in einer Linie mit der
Stirn verläuft, und mit dem spitzen
Kinn, das die Gestalt auf der Be-
gegnung mit Margareta aufweist,
hat wenig Ähnlichkeit. Der den
Sforza belehnende Maximilian ist
in Anlehnung an die goldene Bulle
entstanden.
Die das Grabmal krönend ab-
schließende Statue des knienden
Kaisers (Fig. 48) wurde 1583/84
von Ludovico de Duca nach dem
Modell Colins gegossen. Die ziem-
lich detaillierte,nicht idealisierende
Modellierung des Gesichts nähert
sich in ihren Einzelheiten Maximi-
lians wirklichen Zügen stärker.
Nur das Gesichtsoval erscheint ver-
ändert, es ist in der unteren Partie
zu breit. Wir können also wohl
den Schluß ziehen, daß Colin sich
an ein Vorbild gehalten hat, das wir freilich auf ikonographischem Wege nicht mehr zu ermitteln im-
stande sind. Nun wurde von Ludovico de Duca ein «altes pild» des Kaisers zum Gusse verwendet,3
das als «schlecht und nit sauber gemacht» bezeichnet wird. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß
Colin sich bei der Modellierung an diese Bronze gehalten habe, die man nun leicht einschmelzen zu
können glaubte, nachdem sie einerseits ihren Dienst als ikonographisches Vorbild geleistet hatte, ande-
rerseits wohl im Gusse mißlungen war, vorausgesetzt, daß es gerechtfertigt erscheint, den ihr zu teil ge-
wordenen Tadel auf die Qualität des Gusses zu beziehen. Diese Bronze wird im Verzeichnis von 1547 4
Fig.
o. Niederländisch, Bildnis Maximilians I.
Braunschweig, herzogliches Museum.
1 Publ. von Ilg: Jahrbuch IX. Die Originalzeichnungen im kunsthistorischen Hofmuseum.
2 Publ. von Schönherr: Jahrbuch XI.
3 Vgl. Schönherr, a. a. O., 223 ff.
4 Jahrbuch XI, Reg. 6388, 6390.
XXXI.
44