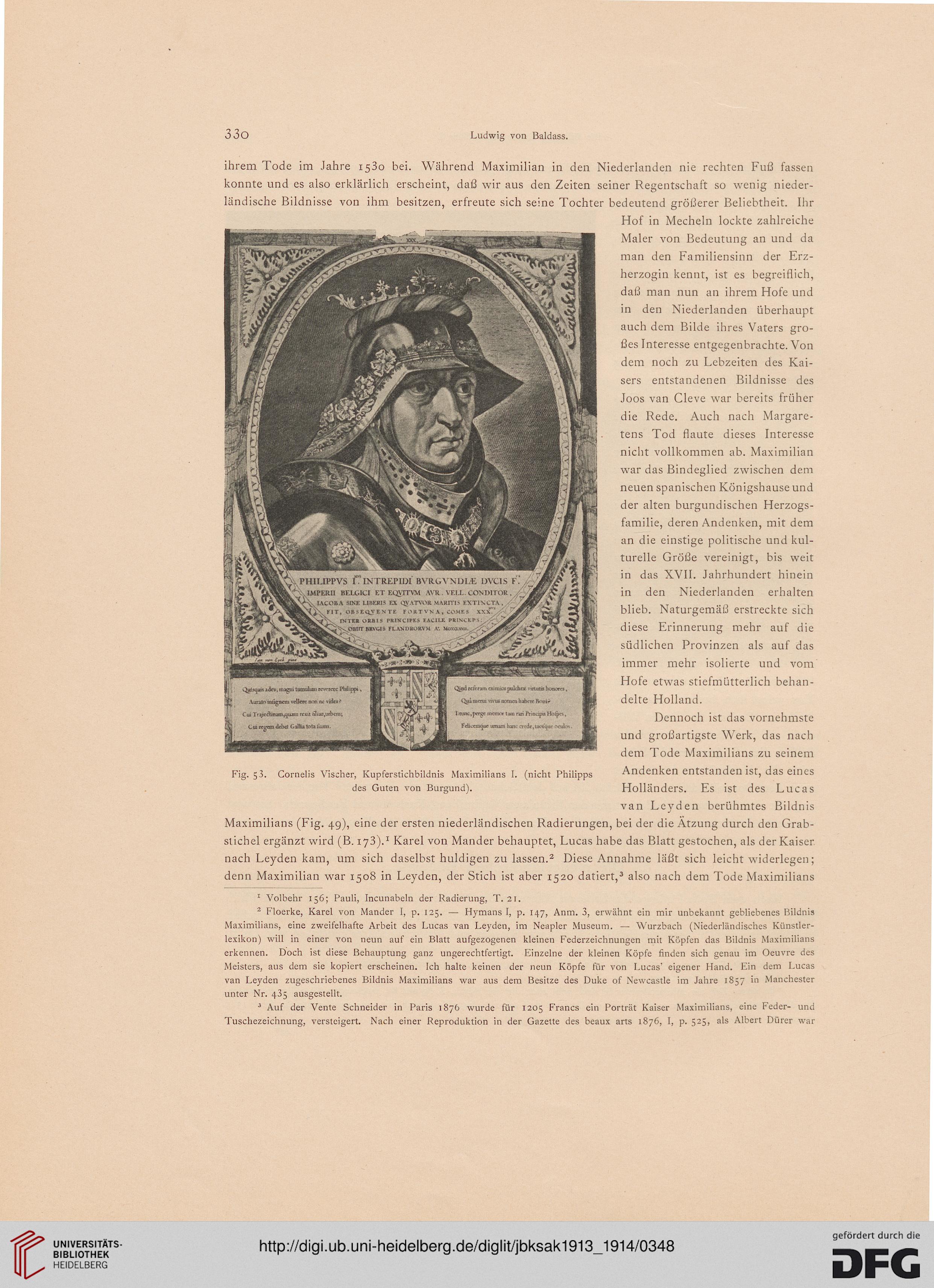33o
Ludwig von Baldass.
ihrem Tode im Jahre 1530 bei. Während Maximilian in den Niederlanden nie rechten Fuß fassen
konnte und es also erklärlich erscheint, daß wir aus den Zeiten seiner Regentschaft so wenig nieder-
ländische Bildnisse von ihm besitzen, erfreute sich seine Tochter bedeutend größerer Beliebtheit. Ihr
Hof in Mecheln lockte zahlreiche
Maler von Bedeutung an und da
man den Familiensinn der Erz-
herzogin kennt, ist es begreiflich,
daß man nun an ihrem Hofe und
in den Niederlanden überhaupt
auch dem Bilde ihres Vaters gro-
ßes Interesse entgegenbrachte. Von
dem noch zu Lebzeiten des Kai-
sers entstandenen Bildnisse des
Joos van Cleve war bereits früher
die Rede. Auch nach Margare-
tens Tod flaute dieses Interesse
nicht vollkommen ab. Maximilian
war das Bindeglied zwischen dem
neuen spanischen Königshause und
der alten burgundischen Herzogs-
familie, deren Andenken, mit dem
an die einstige politische und kul-
turelle Größe vereinigt, bis weit
in das XVII. Jahrhundert hinein
in den Niederlanden erhalten
blieb. Naturgemäß erstreckte sich
diese Erinnerung mehr auf die
südlichen Provinzen als auf das
immer mehr isolierte und vom
Hofe etwas stiefmütterlich behan-
delte Holland.
Dennoch ist das vornehmste
und großartigste Werk, das nach
dem Tode Maximilians zu seinem
Andenken entstanden ist, das eines
Holländers. Es ist des Lucas
van Leyden berühmtes Bildnis
Maximilians (Fig. 49), eine der ersten niederländischen Radierungen, bei der die Ätzung durch den Grab-
stichel ergänzt wird (B. 173).1 Karel von Mander behauptet, Lucas habe das Blatt gestochen, als der Kaiser
nach Leyden kam, um sich daselbst huldigen zu lassen.2 Diese Annahme läßt sich leicht widerlegen;
denn Maximilian war 1508 in Leyden, der Stich ist aber 1520 datiert,3 also nach dem Tode Maximilians
1 Volbehr 156; Pauli, Incunabcln der Radierung, T. 21.
2 Floerke, Karel von Mander [, p. 125. — Hymans I, p. 147, Anm. 3, erwähnt ein mir unbekannt gebliebenes Bildnis
Maximilians, eine zweifelhafte Arbeit des Lucas van Leyden, im Neapler Museum. — Wurzbach (Niederländisches Künstler-
lexikon) will in einer von neun auf ein Blatt aufgezogenen kleinen Federzeichnungen mit Köpfen das Bildnis Maximilians
erkennen. Doch ist diese Behauptung ganz ungerechtfertigt. Einzelne der kleinen Köpfe finden sich genau im Oeuvre des
Meisters, aus dem sie kopiert erscheinen. Ich halte keinen der neun Köpfe für von Lucas' eigener Hand. Ein dem Lucas
van Leyden zugeschriebenes Bildnis Maximilians war aus dem Besitze des Duke of Newcastle im Jahre 1857 in Manchester
unter Nr. 435 ausgestellt.
3 Auf der Vente Schneider in Paris 1876 wurde für 1205 Francs ein Porträt Kaiser Maximilians, eine Feder- und
Tuschezeichnung, versteigert. Nach einer Reproduktion in der Gazette des beaux arts 1876, I, p. 525, als Albert Dürer war
Fig. 5 5. Cornelis Vischer, Kupferstichbildnis Maximilians I. (nicht Philipps
des Guten von Burgund).
Ludwig von Baldass.
ihrem Tode im Jahre 1530 bei. Während Maximilian in den Niederlanden nie rechten Fuß fassen
konnte und es also erklärlich erscheint, daß wir aus den Zeiten seiner Regentschaft so wenig nieder-
ländische Bildnisse von ihm besitzen, erfreute sich seine Tochter bedeutend größerer Beliebtheit. Ihr
Hof in Mecheln lockte zahlreiche
Maler von Bedeutung an und da
man den Familiensinn der Erz-
herzogin kennt, ist es begreiflich,
daß man nun an ihrem Hofe und
in den Niederlanden überhaupt
auch dem Bilde ihres Vaters gro-
ßes Interesse entgegenbrachte. Von
dem noch zu Lebzeiten des Kai-
sers entstandenen Bildnisse des
Joos van Cleve war bereits früher
die Rede. Auch nach Margare-
tens Tod flaute dieses Interesse
nicht vollkommen ab. Maximilian
war das Bindeglied zwischen dem
neuen spanischen Königshause und
der alten burgundischen Herzogs-
familie, deren Andenken, mit dem
an die einstige politische und kul-
turelle Größe vereinigt, bis weit
in das XVII. Jahrhundert hinein
in den Niederlanden erhalten
blieb. Naturgemäß erstreckte sich
diese Erinnerung mehr auf die
südlichen Provinzen als auf das
immer mehr isolierte und vom
Hofe etwas stiefmütterlich behan-
delte Holland.
Dennoch ist das vornehmste
und großartigste Werk, das nach
dem Tode Maximilians zu seinem
Andenken entstanden ist, das eines
Holländers. Es ist des Lucas
van Leyden berühmtes Bildnis
Maximilians (Fig. 49), eine der ersten niederländischen Radierungen, bei der die Ätzung durch den Grab-
stichel ergänzt wird (B. 173).1 Karel von Mander behauptet, Lucas habe das Blatt gestochen, als der Kaiser
nach Leyden kam, um sich daselbst huldigen zu lassen.2 Diese Annahme läßt sich leicht widerlegen;
denn Maximilian war 1508 in Leyden, der Stich ist aber 1520 datiert,3 also nach dem Tode Maximilians
1 Volbehr 156; Pauli, Incunabcln der Radierung, T. 21.
2 Floerke, Karel von Mander [, p. 125. — Hymans I, p. 147, Anm. 3, erwähnt ein mir unbekannt gebliebenes Bildnis
Maximilians, eine zweifelhafte Arbeit des Lucas van Leyden, im Neapler Museum. — Wurzbach (Niederländisches Künstler-
lexikon) will in einer von neun auf ein Blatt aufgezogenen kleinen Federzeichnungen mit Köpfen das Bildnis Maximilians
erkennen. Doch ist diese Behauptung ganz ungerechtfertigt. Einzelne der kleinen Köpfe finden sich genau im Oeuvre des
Meisters, aus dem sie kopiert erscheinen. Ich halte keinen der neun Köpfe für von Lucas' eigener Hand. Ein dem Lucas
van Leyden zugeschriebenes Bildnis Maximilians war aus dem Besitze des Duke of Newcastle im Jahre 1857 in Manchester
unter Nr. 435 ausgestellt.
3 Auf der Vente Schneider in Paris 1876 wurde für 1205 Francs ein Porträt Kaiser Maximilians, eine Feder- und
Tuschezeichnung, versteigert. Nach einer Reproduktion in der Gazette des beaux arts 1876, I, p. 525, als Albert Dürer war
Fig. 5 5. Cornelis Vischer, Kupferstichbildnis Maximilians I. (nicht Philipps
des Guten von Burgund).