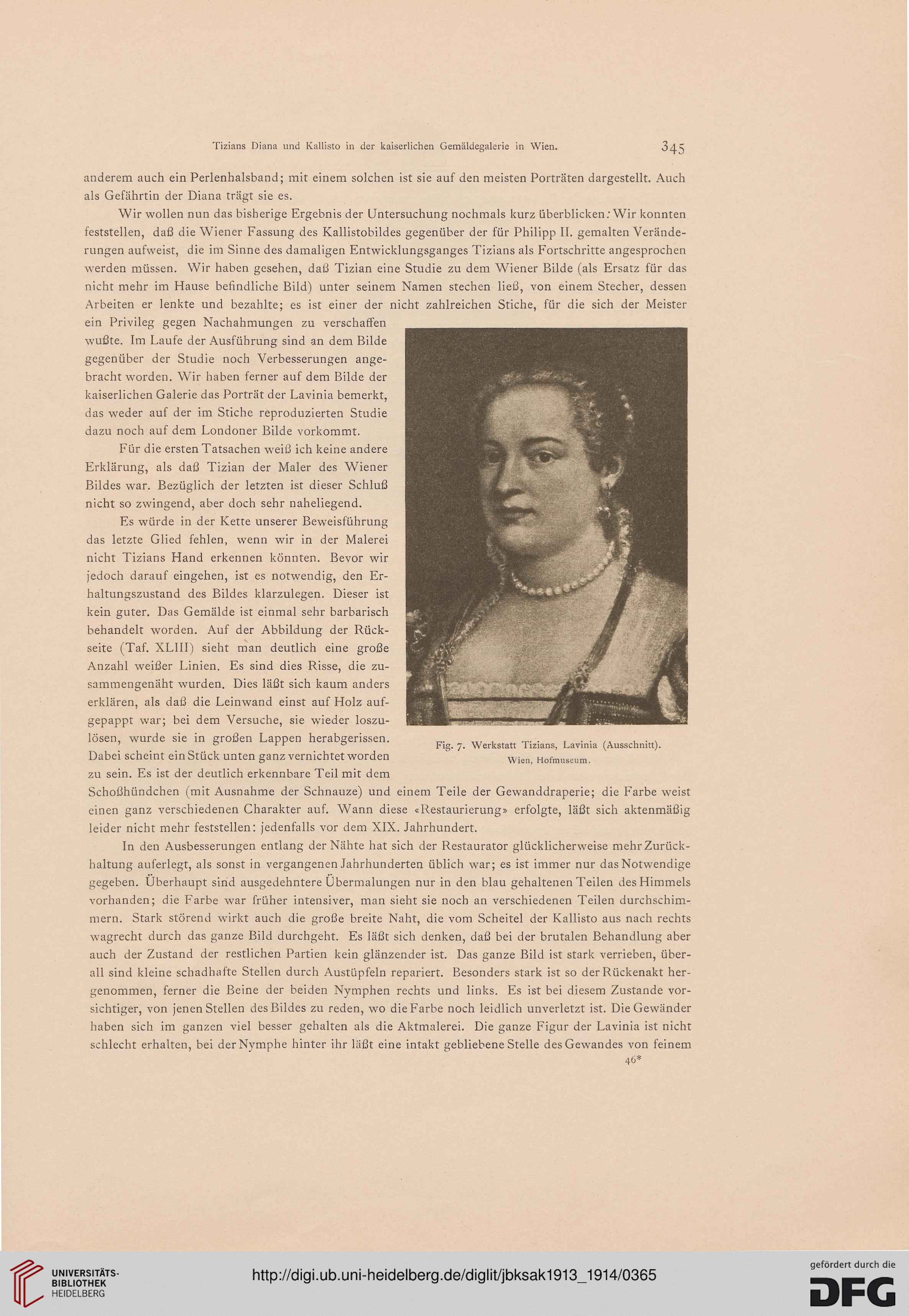Tizians Diana und Kallisto in der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien.
345
anderem auch ein Perlenhalsband; mit einem solchen ist sie auf den meisten Porträten dargestellt. Auch
als Gefährtin der Diana trägt sie es.
Wir wollen nun das bisherige Ergebnis der Untersuchung nochmals kurz überblicken: Wir konnten
feststellen, daß die Wiener Fassung des Kallistobildes gegenüber der für Philipp II. gemalten Verände-
rungen aufweist, die im Sinne des damaligen Entwicklungsganges Tizians als Fortschritte angesprochen
werden müssen. Wir haben gesehen, daß Tizian eine Studie zu dem Wiener Bilde (als Ersatz für das
nicht mehr im Hause befindliche Bild) unter seinem Namen stechen ließ, von einem Stecher, dessen
Arbeiten er lenkte und bezahlte; es ist einer der nicht zahlreichen Stiche, für die sich der Meister
ein Privileg gegen Nachahmungen zu verschaffen
wußte. Im Laufe der Ausführung sind an dem Bilde
gegenüber der Studie noch Verbesserungen ange-
bracht worden. Wir haben ferner auf dem Bilde der
kaiserlichen Galerie das Porträt der Lavinia bemerkt,
das weder auf der im Stiche reproduzierten Studie
dazu noch auf dem Londoner Bilde vorkommt.
Für die ersten Tatsachen weiß ich keine andere
Erklärung, als daß Tizian der Maler des Wiener
Bildes war. Bezüglich der letzten ist dieser Schluß
nicht so zwingend, aber doch sehr naheliegend.
Es würde in der Kette unserer Beweisführung
das letzte Glied fehlen, wenn wir in der Malerei
nicht Tizians Hand erkennen könnten. Bevor wir
jedoch darauf eingehen, ist es notwendig, den Er-
haltungszustand des Bildes klarzulegen. Dieser ist
kein guter. Das Gemälde ist einmal sehr barbarisch
behandelt worden. Auf der Abbildung der Rück-
seite (Taf. XLIII) sieht man deutlich eine große
Anzahl weißer Linien. Es sind dies Risse, die zu-
sammengenäht wurden. Dies läßt sich kaum anders
erklären, als daß die Leinwand einst auf Holz auf-
gepappt war; bei dem Versuche, sie wieder loszu-
lösen, wurde sie in großen Lappen herabgerissen.
Dabei scheint ein Stück unten ganz vernichtet worden
zu sein. Es ist der deutlich erkennbare Teil mit dem
Schoßhündchen (mit Ausnahme der Schnauze) und einem Teile der Gewanddraperie; die Farbe weist
einen ganz verschiedenen Charakter auf. Wann diese «Restaurierung» erfolgte, läßt sich aktenmäßig
leider nicht mehr feststellen: jedenfalls vor dem XIX. Jahrhundert.
In den Ausbesserungen entlang der Nähte hat sich der Restaurator glücklicherweise mehr Zurück-
haltung auferlegt, als sonst in vergangenen Jahrhunderten üblich war; es ist immer nur das Notwendige
gegeben. Uberhaupt sind ausgedehntere Ubermalungen nur in den blau gehaltenen Teilen des Himmels
vorhanden; die Farbe war früher intensiver, man sieht sie noch an verschiedenen Teilen durchschim-
mern. Stark störend wirkt auch die große breite Naht, die vom Scheitel der Kallisto aus nach rechts
wagrecht durch das ganze Bild durchgeht. Es läßt sich denken, daß bei der brutalen Behandlung aber
auch der Zustand der restlichen Partien kein glänzender ist. Das ganze Bild ist stark verrieben, über-
all sind kleine schadhafte Stellen durch Austüpfeln repariert. Besonders stark ist so der Rückenakt her-
genommen, ferner die Beine der beiden Nymphen rechts und links. Es ist bei diesem Zustande vor-
sichtiger, von jenen Stellen des Bildes zu reden, wo die Farbe noch leidlich unverletzt ist. Die Gewänder
haben sich im ganzen viel besser gehalten als die Aktmalerei. Die ganze Figur der Lavinia ist nicht
schlecht erhalten, bei der Nymphe hinter ihr läßt eine intakt gebliebene Stelle des Gewandes von feinem
46*
Fig. 7. Werkstatt Tizians, Lavinia (Ausschnitt).
Wien, Hofmuseum.
345
anderem auch ein Perlenhalsband; mit einem solchen ist sie auf den meisten Porträten dargestellt. Auch
als Gefährtin der Diana trägt sie es.
Wir wollen nun das bisherige Ergebnis der Untersuchung nochmals kurz überblicken: Wir konnten
feststellen, daß die Wiener Fassung des Kallistobildes gegenüber der für Philipp II. gemalten Verände-
rungen aufweist, die im Sinne des damaligen Entwicklungsganges Tizians als Fortschritte angesprochen
werden müssen. Wir haben gesehen, daß Tizian eine Studie zu dem Wiener Bilde (als Ersatz für das
nicht mehr im Hause befindliche Bild) unter seinem Namen stechen ließ, von einem Stecher, dessen
Arbeiten er lenkte und bezahlte; es ist einer der nicht zahlreichen Stiche, für die sich der Meister
ein Privileg gegen Nachahmungen zu verschaffen
wußte. Im Laufe der Ausführung sind an dem Bilde
gegenüber der Studie noch Verbesserungen ange-
bracht worden. Wir haben ferner auf dem Bilde der
kaiserlichen Galerie das Porträt der Lavinia bemerkt,
das weder auf der im Stiche reproduzierten Studie
dazu noch auf dem Londoner Bilde vorkommt.
Für die ersten Tatsachen weiß ich keine andere
Erklärung, als daß Tizian der Maler des Wiener
Bildes war. Bezüglich der letzten ist dieser Schluß
nicht so zwingend, aber doch sehr naheliegend.
Es würde in der Kette unserer Beweisführung
das letzte Glied fehlen, wenn wir in der Malerei
nicht Tizians Hand erkennen könnten. Bevor wir
jedoch darauf eingehen, ist es notwendig, den Er-
haltungszustand des Bildes klarzulegen. Dieser ist
kein guter. Das Gemälde ist einmal sehr barbarisch
behandelt worden. Auf der Abbildung der Rück-
seite (Taf. XLIII) sieht man deutlich eine große
Anzahl weißer Linien. Es sind dies Risse, die zu-
sammengenäht wurden. Dies läßt sich kaum anders
erklären, als daß die Leinwand einst auf Holz auf-
gepappt war; bei dem Versuche, sie wieder loszu-
lösen, wurde sie in großen Lappen herabgerissen.
Dabei scheint ein Stück unten ganz vernichtet worden
zu sein. Es ist der deutlich erkennbare Teil mit dem
Schoßhündchen (mit Ausnahme der Schnauze) und einem Teile der Gewanddraperie; die Farbe weist
einen ganz verschiedenen Charakter auf. Wann diese «Restaurierung» erfolgte, läßt sich aktenmäßig
leider nicht mehr feststellen: jedenfalls vor dem XIX. Jahrhundert.
In den Ausbesserungen entlang der Nähte hat sich der Restaurator glücklicherweise mehr Zurück-
haltung auferlegt, als sonst in vergangenen Jahrhunderten üblich war; es ist immer nur das Notwendige
gegeben. Uberhaupt sind ausgedehntere Ubermalungen nur in den blau gehaltenen Teilen des Himmels
vorhanden; die Farbe war früher intensiver, man sieht sie noch an verschiedenen Teilen durchschim-
mern. Stark störend wirkt auch die große breite Naht, die vom Scheitel der Kallisto aus nach rechts
wagrecht durch das ganze Bild durchgeht. Es läßt sich denken, daß bei der brutalen Behandlung aber
auch der Zustand der restlichen Partien kein glänzender ist. Das ganze Bild ist stark verrieben, über-
all sind kleine schadhafte Stellen durch Austüpfeln repariert. Besonders stark ist so der Rückenakt her-
genommen, ferner die Beine der beiden Nymphen rechts und links. Es ist bei diesem Zustande vor-
sichtiger, von jenen Stellen des Bildes zu reden, wo die Farbe noch leidlich unverletzt ist. Die Gewänder
haben sich im ganzen viel besser gehalten als die Aktmalerei. Die ganze Figur der Lavinia ist nicht
schlecht erhalten, bei der Nymphe hinter ihr läßt eine intakt gebliebene Stelle des Gewandes von feinem
46*
Fig. 7. Werkstatt Tizians, Lavinia (Ausschnitt).
Wien, Hofmuseum.