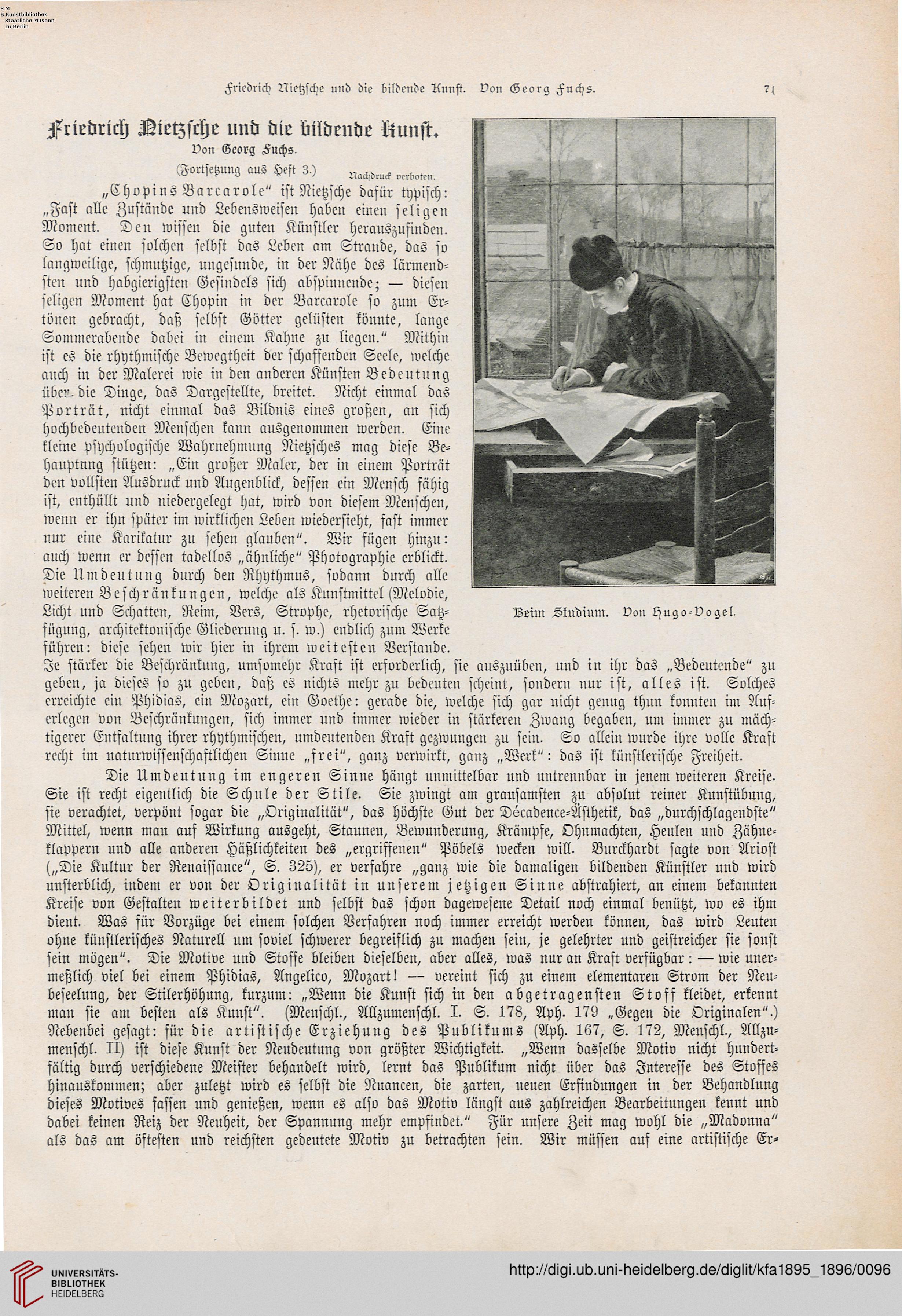Friedrich Nietzsche und die bildende Kunst, von Georg Fuchs. 7;
Friedrich Oietzsche und die bildende Aunst.
von Georg Fuchs.
(Fortsetzung aus Heft 3.) Nachdruck verboten.
„Chopins Barcarole" ist Nietzsche dafür typisch:
„Fast alle Zustände und Lebensweisen haben einen seligen
Moment. Den wissen die guten Künstler herauszufinden.
So hat einen solchen selbst das Leben am Strande, das so
langweilige, schmutzige, ungesunde, in der Nähe des lärmend-
sten und habgierigsten Gesindels sich abspinnende; — diesen
seligen Moment hat Chopin in der Barcarole so zum Er-
tönen gebracht, daß selbst Götter gelüsten könnte, lange
Sommerabende dabei in einem Kahne zu liegen." Mithin
ist es die rhythmische Bewegtheit der schaffenden Seele, welche
auch in der Malerei wie in den anderen Künsten Bedeutung
über, die Dinge, das Dargestellte, breitet. Nicht einmal das
Porträt, nicht einmal das Bildnis eines großen, an sich
hochbedeutenden Menschen kann ausgenommen werden. Eine
kleine psychologische Wahrnehmung Nietzsches mag diese Be-
hauptung stützen: „Ein großer Maler, der in einem Porträt
den vollsten Ausdruck und Augenblick, dessen ein Mensch fähig
ist, enthüllt und niedergelegt hat, wird von diesem Menschen,
wenn er ihn später im wirklichen Leben wiedersieht, fast immer
nur eine Karikatur zu sehen glauben". Wir fügen hinzu:
auch wenn er dessen tadellos „ähnliche" Photographie erblickt.
Die Umdeutung durch den Rhythmus, sodann durch alle
weiteren Beschränkungen, welche als Kunstmittel Melodie,
Licht und Schatten, Reim, Vers, Strophe, rhetorische Satz-
fügung, architektonische Gliederung u. s. w.) endlich zum Werke
führen: diese sehen wir hier in ihrem weitesten Verstände.
Je stärker die Beschränkung, umsomehr Kraft ist erforderlich, sie auszuüben, und in ihr das „Bedeutende" zu
geben, ja dieses so zu geben, daß es nichts mehr zu bedeuten scheint, sondern nur ist, alles ist. Solches
erreichte ein Phidias, ein Mozart, ein Goethe: gerade die, welche sich gar nicht genug thun konnten im Auf-
erlegen von Beschränkungen, sich immer und immer wieder in stärkeren Zwang begaben, um immer zu mäch-
tigerer Entfaltung ihrer rhythmischen, umdeutenden Kraft gezwungen zu sein. So allein wurde ihre volle Kraft
recht im naturwissenschaftlichen Sinne „frei", ganz verwirkt, ganz „Werk": das ist künstlerische Freiheit.
Die Umdeutung im engeren Sinne hängt unmittelbar und untrennbar in jenem weiteren Kreise.
Sie ist recht eigentlich die Schule der Stile. Sie zwingt am grausamsten zu absolut reiner Kunstübung,
sie verachtet, verpönt sogar die „Originalität", das höchste Gut der Decadence-Ästhetik, das „durchschlagendste"
Mittel, wenn man auf Wirkung ausgeht, Staunen, Bewunderung, Krämpfe, Ohnmächten, Heulen und Zähne-
klappern und alle anderen Häßlichkeiten des „ergriffenen" Pöbels wecken will. Burckhardt sagte von Ariost
(„Die Kultur der Renaissance", S. 325), er verfahre „ganz wie die damaligen bildenden Künstler und wird
unsterblich, indem er von der Originalität in unserem jetzigen Sinne abstrahiert, an einem bekannten
Kreise von Gestalten weiterbildet und selbst das schon dagewesene Detail noch einmal benützt, wo es ihm
dient. Was für Vorzüge bei einem solchen Verfahren noch immer erreicht werden können, das wird Leuten
ohne künstlerisches Naturell um soviel schwerer begreiflich zu machen sein, je gelehrter und geistreicher sie sonst
sein mögen". Die Motive und Stoffe bleiben dieselben, aber alles, was nur an Kraft verfügbar: — wie uner-
meßlich viel bei einem Phidias, Angelico, Mozart! — vereint sich zu einem elementaren Strom der Neu-
beseelung, der Stilerhöhung, kurzum: „Wenn die Kunst sich in den abgetragensten Stoff kleidet, erkennt
man sie am besten als Kunst". Menschl., Allzumenschl. I. S. 178, Aph. 179 „Gegen die Originalen".)
Nebenbei gesagt: für die artistische Erziehung des Publikums (Aph. 167, S. 172, Menschl., Allzu-
menschl. H) ist diese Kunst der Neudeutung von größter Wichtigkeit. „Wenn dasselbe Motiv nicht hundert-
fältig durch verschiedene Meister behandelt wird, lernt das Publikum nicht über das Interesse des Stoffes
hinauskommen; aber zuletzt wird es selbst die Nuancen, die zarten, neuen Erfindungen in der Behandlung
dieses Motives fassen und genießen, wenn es also das Motiv längst aus zahlreichen Bearbeitungen kennt und
dabei keinen Reiz der Neuheit, der Spannung mehr empfindet." Für unsere Zeit mag wohl die „Madonna"
als das am öftesten und reichsten gedeutete Motiv zu betrachten sein. Wir müssen auf eine artistische Er-
Friedrich Oietzsche und die bildende Aunst.
von Georg Fuchs.
(Fortsetzung aus Heft 3.) Nachdruck verboten.
„Chopins Barcarole" ist Nietzsche dafür typisch:
„Fast alle Zustände und Lebensweisen haben einen seligen
Moment. Den wissen die guten Künstler herauszufinden.
So hat einen solchen selbst das Leben am Strande, das so
langweilige, schmutzige, ungesunde, in der Nähe des lärmend-
sten und habgierigsten Gesindels sich abspinnende; — diesen
seligen Moment hat Chopin in der Barcarole so zum Er-
tönen gebracht, daß selbst Götter gelüsten könnte, lange
Sommerabende dabei in einem Kahne zu liegen." Mithin
ist es die rhythmische Bewegtheit der schaffenden Seele, welche
auch in der Malerei wie in den anderen Künsten Bedeutung
über, die Dinge, das Dargestellte, breitet. Nicht einmal das
Porträt, nicht einmal das Bildnis eines großen, an sich
hochbedeutenden Menschen kann ausgenommen werden. Eine
kleine psychologische Wahrnehmung Nietzsches mag diese Be-
hauptung stützen: „Ein großer Maler, der in einem Porträt
den vollsten Ausdruck und Augenblick, dessen ein Mensch fähig
ist, enthüllt und niedergelegt hat, wird von diesem Menschen,
wenn er ihn später im wirklichen Leben wiedersieht, fast immer
nur eine Karikatur zu sehen glauben". Wir fügen hinzu:
auch wenn er dessen tadellos „ähnliche" Photographie erblickt.
Die Umdeutung durch den Rhythmus, sodann durch alle
weiteren Beschränkungen, welche als Kunstmittel Melodie,
Licht und Schatten, Reim, Vers, Strophe, rhetorische Satz-
fügung, architektonische Gliederung u. s. w.) endlich zum Werke
führen: diese sehen wir hier in ihrem weitesten Verstände.
Je stärker die Beschränkung, umsomehr Kraft ist erforderlich, sie auszuüben, und in ihr das „Bedeutende" zu
geben, ja dieses so zu geben, daß es nichts mehr zu bedeuten scheint, sondern nur ist, alles ist. Solches
erreichte ein Phidias, ein Mozart, ein Goethe: gerade die, welche sich gar nicht genug thun konnten im Auf-
erlegen von Beschränkungen, sich immer und immer wieder in stärkeren Zwang begaben, um immer zu mäch-
tigerer Entfaltung ihrer rhythmischen, umdeutenden Kraft gezwungen zu sein. So allein wurde ihre volle Kraft
recht im naturwissenschaftlichen Sinne „frei", ganz verwirkt, ganz „Werk": das ist künstlerische Freiheit.
Die Umdeutung im engeren Sinne hängt unmittelbar und untrennbar in jenem weiteren Kreise.
Sie ist recht eigentlich die Schule der Stile. Sie zwingt am grausamsten zu absolut reiner Kunstübung,
sie verachtet, verpönt sogar die „Originalität", das höchste Gut der Decadence-Ästhetik, das „durchschlagendste"
Mittel, wenn man auf Wirkung ausgeht, Staunen, Bewunderung, Krämpfe, Ohnmächten, Heulen und Zähne-
klappern und alle anderen Häßlichkeiten des „ergriffenen" Pöbels wecken will. Burckhardt sagte von Ariost
(„Die Kultur der Renaissance", S. 325), er verfahre „ganz wie die damaligen bildenden Künstler und wird
unsterblich, indem er von der Originalität in unserem jetzigen Sinne abstrahiert, an einem bekannten
Kreise von Gestalten weiterbildet und selbst das schon dagewesene Detail noch einmal benützt, wo es ihm
dient. Was für Vorzüge bei einem solchen Verfahren noch immer erreicht werden können, das wird Leuten
ohne künstlerisches Naturell um soviel schwerer begreiflich zu machen sein, je gelehrter und geistreicher sie sonst
sein mögen". Die Motive und Stoffe bleiben dieselben, aber alles, was nur an Kraft verfügbar: — wie uner-
meßlich viel bei einem Phidias, Angelico, Mozart! — vereint sich zu einem elementaren Strom der Neu-
beseelung, der Stilerhöhung, kurzum: „Wenn die Kunst sich in den abgetragensten Stoff kleidet, erkennt
man sie am besten als Kunst". Menschl., Allzumenschl. I. S. 178, Aph. 179 „Gegen die Originalen".)
Nebenbei gesagt: für die artistische Erziehung des Publikums (Aph. 167, S. 172, Menschl., Allzu-
menschl. H) ist diese Kunst der Neudeutung von größter Wichtigkeit. „Wenn dasselbe Motiv nicht hundert-
fältig durch verschiedene Meister behandelt wird, lernt das Publikum nicht über das Interesse des Stoffes
hinauskommen; aber zuletzt wird es selbst die Nuancen, die zarten, neuen Erfindungen in der Behandlung
dieses Motives fassen und genießen, wenn es also das Motiv längst aus zahlreichen Bearbeitungen kennt und
dabei keinen Reiz der Neuheit, der Spannung mehr empfindet." Für unsere Zeit mag wohl die „Madonna"
als das am öftesten und reichsten gedeutete Motiv zu betrachten sein. Wir müssen auf eine artistische Er-