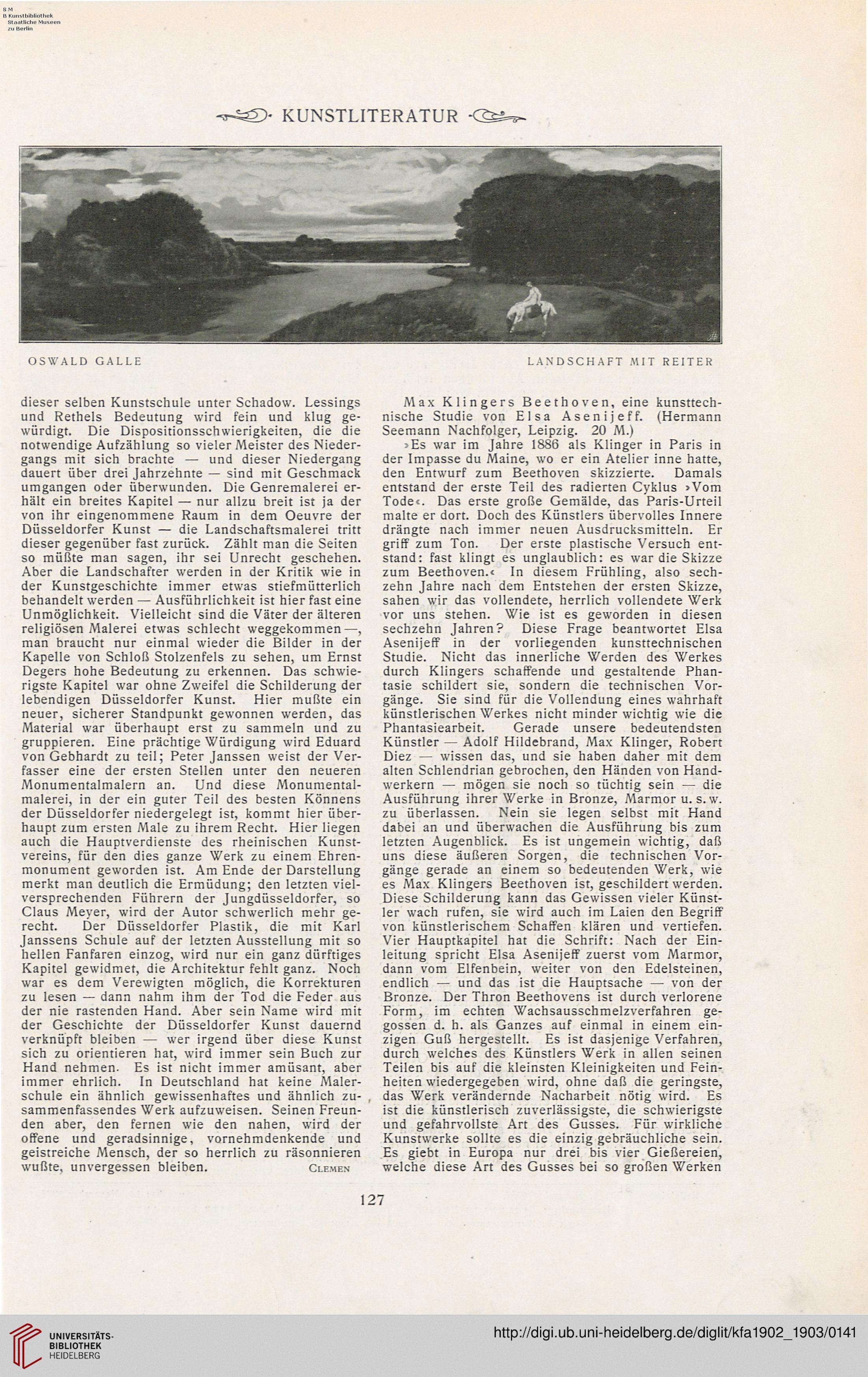-s-S^> KUNSTLITERATUR
dieser selben Kunstschule unter Schadow. Lessings
und Rethels Bedeutung wird fein und klug ge-
würdigt. Die Dispositionsschwierigkeiten, die die
notwendige Aufzählung so vieler Meister des Nieder-
gangs mit sich brachte — und dieser Niedergang
dauert über drei Jahrzehnte — sind mit Geschmack
umgangen oder überwunden. Die Genremalerei er-
hält ein breites Kapitel — nur allzu breit ist ja der
von ihr eingenommene Raum in dem Oeuvre der
Düsseldorfer Kunst — die Landschaftsmalerei tritt
dieser gegenüber fast zurück. Zählt man die Seiten
so müßte man sagen, ihr sei Unrecht geschehen.
Aber die Landschafter werden in der Kritik wie in
der Kunstgeschichte immer etwas stiefmütterlich
behandelt werden — Ausführlichkeit ist hier fast eine
Unmöglichkeit. Vielleicht sind die Väter der älteren
religiösen Malerei etwas schlecht weggekommen—,
man braucht nur einmal wieder die Bilder in der
Kapelle von Schloß Stolzenfels zu sehen, um Ernst
Degers hohe Bedeutung zu erkennen. Das schwie-
rigste Kapitel war ohne Zweifel die Schilderung der
lebendigen Düsseldorfer Kunst. Hier mußte ein
neuer, sicherer Standpunkt gewonnen werden, das
Material war überhaupt erst zu sammeln und zu
gruppieren. Eine prächtige Würdigung wird Eduard
von Gebhardt zu teil; Peter Janssen weist der Ver-
fasser eine der ersten Stellen unter den neueren
Monumentalmalern an. Und diese Monumental-
malerei, in der ein guter Teil des besten Könnens
der Düsseldorfer niedergelegt ist, kommt hier über-
haupt zum ersten Male zu ihrem Recht. Hier liegen
auch die Hauptverdienste des rheinischen Kunst-
vereins, für den dies ganze Werk zu einem Ehren-
monument geworden ist. Am Ende der Darstellung
merkt man deutlich die Ermüdung; den letzten viel-
versprechenden Führern der Jungdüsseldorfer, so
Claus Meyer, wird der Autor schwerlich mehr ge-
recht. Der Düsseldorfer Plastik, die mit Karl
Janssens Schule auf der letzten Ausstellung mit so
hellen Fanfaren einzog, wird nur ein ganz dürftiges
Kapitel gewidmet, die Architektur fehlt ganz. Noch
war es dem Verewigten möglich, die Korrekturen
zu lesen — dann nahm ihm der Tod die Feder aus
der nie rastenden Hand. Aber sein Name wird mit
der Geschichte der Düsseldorfer Kunst dauernd
verknüpft bleiben — wer irgend über diese Kunst
sich zu orientieren hat, wird immer sein Buch zur
Hand nehmen. Es ist nicht immer amüsant, aber
immer ehrlich. In Deutschland hat keine Maler-
schule ein ähnlich gewissenhaftes und ähnlich zu-
sammenfassendes Werk aufzuweisen. Seinen Freun-
den aber, den fernen wie den nahen, wird der
offene und geradsinnige, vornehmdenkende und
geistreiche Mensch, der so herrlich zu räsonnieren
wußte, unvergessen bleiben. Clemen
Max Klingers Beethoven, eine kunsttech-
nische Studie von Elsa Asenijeff. (Hermann
Seemann Nachfolger, Leipzig. 20 M.)
>Es war im Jahre 1886 als Klinger in Paris in
der Impasse du Maine, wo er ein Atelier inne hatte,
den Entwurf zum Beethoven skizzierte. Damals
entstand der erste Teil des radierten Cyklus >Vom
Tode«. Das erste große Gemälde, das Paris-Urteil
malte er dort. Doch des Künstlers übervolles Innere
drängte nach immer neuen Ausdrucksmitteln. Er
griff zum Ton. Der erste plastische Versuch ent-
stand: fast klingt es unglaublich: es war die Skizze
zum Beethoven.i In diesem Frühling, also sech-
zehn Jahre nach dem Entstehen der ersten Skizze,
sahen wir das vollendete, herrlich vollendete Werk
vor uns stehen. Wie ist es geworden in diesen
sechzehn Jahren? Diese Frage beantwortet Elsa
Asenijeff in der vorliegenden kunsttechnischen
Studie. Nicht das innerliche Werden des Werkes
durch Klingers schaffende und gestaltende Phan-
tasie schildert sie, sondern die technischen Vor-
gänge. Sie sind für die Vollendung eines wahrhaft
künstlerischen Werkes nicht minder wichtig wie die
Phantasiearbeit. Gerade unsere bedeutendsten
Künstler — Adolf Hildebrand, Max Klinger, Robert
Diez — wissen das, und sie haben daher mit dem
alten Schlendrian gebrochen, den Händen von Hand-
werkern — mögen sie noch so tüchtig sein — die
Ausführung ihrer Werke in Bronze, Marmor u. s. w.
zu überlassen. Nein sie legen selbst mit Hand
dabei an und überwachen die Ausführung bis zum
letzten Augenblick. Es ist ungemein wichtig, daß
uns diese äußeren Sorgen, die technischen Vor-
gänge gerade an einem so bedeutenden Werk, wie
es Max Klingers Beethoven ist, geschildert werden.
Diese Schilderung kann das Gewissen vieler Künst-
ler wach rufen, sie wird auch im Laien den Begriff
von künstlerischem Schaffen klären und vertiefen.
Vier Hauptkapitel hat die Schrift: Nach der Ein-
leitung spricht Elsa Asenijeff zuerst vom Marmor,
dann vom Elfenbein, weiter von den Edelsteinen,
endlich — und das ist die Hauptsache — von der
Bronze. Der Thron Beethovens ist durch verlorene
Form, im echten Wachsausschmelzverfahren ge-
gossen d. h. als Ganzes auf einmal in einem ein-
zigen Guß hergestellt. Es ist dasjenige Verfahren,
durch welches des Künstlers Werk in allen seinen
Teilen bis auf die kleinsten Kleinigkeiten und Fein-
heiten wiedergegeben wird, ohne daß die geringste,
das Werk verändernde Nacharbeit nötig wird. Es
ist die künstlerisch zuverlässigste, die schwierigste
und gefahrvollste Art des Gusses. Für wirkliche
Kunstwerke sollte es die einzig gebräuchliche sein.
Es giebt in Europa nur drei bis vier Gießereien,
welche diese Art des Gusses bei so großen Werken
127
dieser selben Kunstschule unter Schadow. Lessings
und Rethels Bedeutung wird fein und klug ge-
würdigt. Die Dispositionsschwierigkeiten, die die
notwendige Aufzählung so vieler Meister des Nieder-
gangs mit sich brachte — und dieser Niedergang
dauert über drei Jahrzehnte — sind mit Geschmack
umgangen oder überwunden. Die Genremalerei er-
hält ein breites Kapitel — nur allzu breit ist ja der
von ihr eingenommene Raum in dem Oeuvre der
Düsseldorfer Kunst — die Landschaftsmalerei tritt
dieser gegenüber fast zurück. Zählt man die Seiten
so müßte man sagen, ihr sei Unrecht geschehen.
Aber die Landschafter werden in der Kritik wie in
der Kunstgeschichte immer etwas stiefmütterlich
behandelt werden — Ausführlichkeit ist hier fast eine
Unmöglichkeit. Vielleicht sind die Väter der älteren
religiösen Malerei etwas schlecht weggekommen—,
man braucht nur einmal wieder die Bilder in der
Kapelle von Schloß Stolzenfels zu sehen, um Ernst
Degers hohe Bedeutung zu erkennen. Das schwie-
rigste Kapitel war ohne Zweifel die Schilderung der
lebendigen Düsseldorfer Kunst. Hier mußte ein
neuer, sicherer Standpunkt gewonnen werden, das
Material war überhaupt erst zu sammeln und zu
gruppieren. Eine prächtige Würdigung wird Eduard
von Gebhardt zu teil; Peter Janssen weist der Ver-
fasser eine der ersten Stellen unter den neueren
Monumentalmalern an. Und diese Monumental-
malerei, in der ein guter Teil des besten Könnens
der Düsseldorfer niedergelegt ist, kommt hier über-
haupt zum ersten Male zu ihrem Recht. Hier liegen
auch die Hauptverdienste des rheinischen Kunst-
vereins, für den dies ganze Werk zu einem Ehren-
monument geworden ist. Am Ende der Darstellung
merkt man deutlich die Ermüdung; den letzten viel-
versprechenden Führern der Jungdüsseldorfer, so
Claus Meyer, wird der Autor schwerlich mehr ge-
recht. Der Düsseldorfer Plastik, die mit Karl
Janssens Schule auf der letzten Ausstellung mit so
hellen Fanfaren einzog, wird nur ein ganz dürftiges
Kapitel gewidmet, die Architektur fehlt ganz. Noch
war es dem Verewigten möglich, die Korrekturen
zu lesen — dann nahm ihm der Tod die Feder aus
der nie rastenden Hand. Aber sein Name wird mit
der Geschichte der Düsseldorfer Kunst dauernd
verknüpft bleiben — wer irgend über diese Kunst
sich zu orientieren hat, wird immer sein Buch zur
Hand nehmen. Es ist nicht immer amüsant, aber
immer ehrlich. In Deutschland hat keine Maler-
schule ein ähnlich gewissenhaftes und ähnlich zu-
sammenfassendes Werk aufzuweisen. Seinen Freun-
den aber, den fernen wie den nahen, wird der
offene und geradsinnige, vornehmdenkende und
geistreiche Mensch, der so herrlich zu räsonnieren
wußte, unvergessen bleiben. Clemen
Max Klingers Beethoven, eine kunsttech-
nische Studie von Elsa Asenijeff. (Hermann
Seemann Nachfolger, Leipzig. 20 M.)
>Es war im Jahre 1886 als Klinger in Paris in
der Impasse du Maine, wo er ein Atelier inne hatte,
den Entwurf zum Beethoven skizzierte. Damals
entstand der erste Teil des radierten Cyklus >Vom
Tode«. Das erste große Gemälde, das Paris-Urteil
malte er dort. Doch des Künstlers übervolles Innere
drängte nach immer neuen Ausdrucksmitteln. Er
griff zum Ton. Der erste plastische Versuch ent-
stand: fast klingt es unglaublich: es war die Skizze
zum Beethoven.i In diesem Frühling, also sech-
zehn Jahre nach dem Entstehen der ersten Skizze,
sahen wir das vollendete, herrlich vollendete Werk
vor uns stehen. Wie ist es geworden in diesen
sechzehn Jahren? Diese Frage beantwortet Elsa
Asenijeff in der vorliegenden kunsttechnischen
Studie. Nicht das innerliche Werden des Werkes
durch Klingers schaffende und gestaltende Phan-
tasie schildert sie, sondern die technischen Vor-
gänge. Sie sind für die Vollendung eines wahrhaft
künstlerischen Werkes nicht minder wichtig wie die
Phantasiearbeit. Gerade unsere bedeutendsten
Künstler — Adolf Hildebrand, Max Klinger, Robert
Diez — wissen das, und sie haben daher mit dem
alten Schlendrian gebrochen, den Händen von Hand-
werkern — mögen sie noch so tüchtig sein — die
Ausführung ihrer Werke in Bronze, Marmor u. s. w.
zu überlassen. Nein sie legen selbst mit Hand
dabei an und überwachen die Ausführung bis zum
letzten Augenblick. Es ist ungemein wichtig, daß
uns diese äußeren Sorgen, die technischen Vor-
gänge gerade an einem so bedeutenden Werk, wie
es Max Klingers Beethoven ist, geschildert werden.
Diese Schilderung kann das Gewissen vieler Künst-
ler wach rufen, sie wird auch im Laien den Begriff
von künstlerischem Schaffen klären und vertiefen.
Vier Hauptkapitel hat die Schrift: Nach der Ein-
leitung spricht Elsa Asenijeff zuerst vom Marmor,
dann vom Elfenbein, weiter von den Edelsteinen,
endlich — und das ist die Hauptsache — von der
Bronze. Der Thron Beethovens ist durch verlorene
Form, im echten Wachsausschmelzverfahren ge-
gossen d. h. als Ganzes auf einmal in einem ein-
zigen Guß hergestellt. Es ist dasjenige Verfahren,
durch welches des Künstlers Werk in allen seinen
Teilen bis auf die kleinsten Kleinigkeiten und Fein-
heiten wiedergegeben wird, ohne daß die geringste,
das Werk verändernde Nacharbeit nötig wird. Es
ist die künstlerisch zuverlässigste, die schwierigste
und gefahrvollste Art des Gusses. Für wirkliche
Kunstwerke sollte es die einzig gebräuchliche sein.
Es giebt in Europa nur drei bis vier Gießereien,
welche diese Art des Gusses bei so großen Werken
127