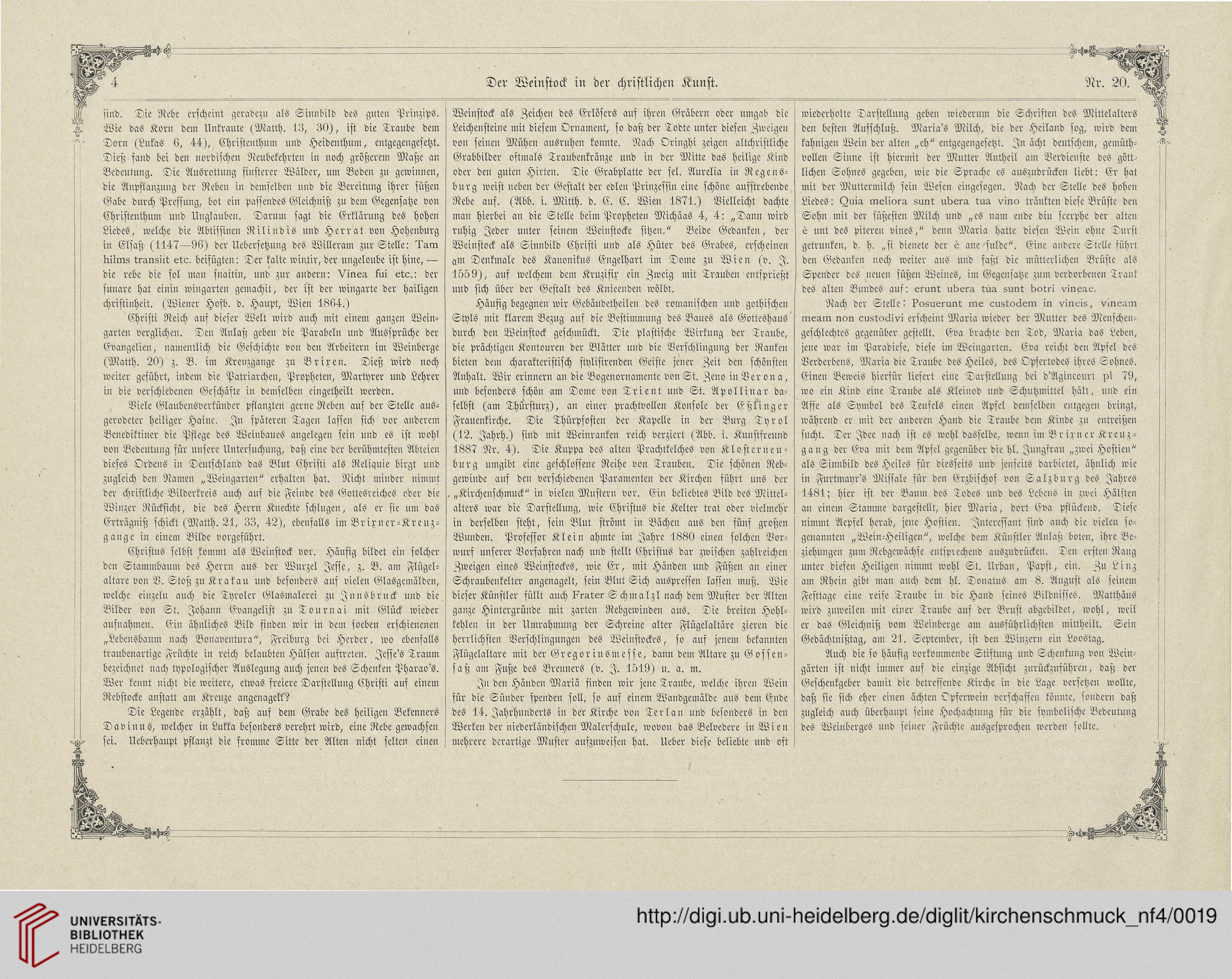M sind. Die Rebe erscheint geradezn als Sinnbild des gutcn Prinzips.
M Wie das Korn dem Unkraute bMatth. 13, 30), ist die Traube dern
Dorn (Lukaö 6, 44), Christeuthum uud Heideuthum, entgegeugesetzt.
Dieß faud bei deu uordischen Neubekehrteu iu noch größerem Maße an
Bedeutung. Die Ausrottung fiusterer Wälder, um Bodeu zu gewinnen,
die Anpstanzuug der Reben in demselbeu nud die Bereituug ihrer süßen
Gabe durch Pressung, bot ein passendes Gleichuiß zu dem Gegensatze von
Christenthum und Unglaubeu. Darum sagt die Erklärung des hoheu
Liedes, welche die Abtissiueu Riliudis und Herrat von Hohenburg
in Elsaß (1147—96) der Uebersetzung deö Willeram zur Stelle: Dum
llilms krLnsiik ekc. beisügten: Der kalte wiutir, der uugeloube ist hiue, —
die rebe die sol man suaitiu, uud zur auderu: Viirea llü etc.: der
suuare hat eiuiu wiugarteu gemachit, der ist der wiugarte der hailigen
christiuheit. (Wieuer Hofb. d. Haupt, Wien 1864.)
Christi Reich auf dieser Welt wird auch mit einem ganzen Wein-
garten verglicheu. Deu Aulah gebeu die Parabeln uud Aussprüche der
Evangelieu, uamentlich die Geschichte von den Arbeiteru im Weinberge
(Matth. 20) z. B. im Kreuzgange zu Brixen. Dieß wird noch
weiter geführt, indem die Patriarcheu, Propheten, Martyrer und Lchrer
iu die verschiedeneu Geschäfte iu demselbeu eingetheilt werden.
Viele Glaubensverküuder pflanzten gerne Reben aus der Stelle aus-
gerodeter heiliger Haine. In spätereu Tageu lasseu sich vor auderem
Benediktiuer die Pflege des Weiubaues augelegcu seiu uud es ist wohl
von Bedeutung sür uusere Untersuchuug, daß eine der berühmtesteu Abtcieu
dieses Ordeus in Deutschland das Blut Christi als Reliquie birgt uud
zugleich deu Nameu „Weiugarten" erhalten hat. Nicht miuder niuimt
der christliche Bilderkreis auch aus die Feinde des Gottesreiches oder die
Winzer Rücksicht, die des Herru Kuechte schlugen, als er sie um das
Erträguiß schickt (Matth. 21, 33, 42), ebeufalls im Brixuer-Kreuz-
gauge iu eiuem Bilde vorgeführt.
ChristuS selbst kommt als Weiustock vor. Häufig bildet ciu solcher
deu Stammbaum des Herrn aus der Wurzel Jesse, z. B. am Flügel-
altare von V. Stoß zu Krakau uud besonders auf vieleu Glasgemälden,
welche eiuzeln auch die Tyroler Glasmalerei zu JuuSbruck uud die
Bildcr vou St. Johanu Evangelist zu Touruai mit Glück wieder
aufuahmeu. Ein ähuliches Bild sindeu wir in dem soeben erschienenen
„Lebeusbaum nach Bouaventura", Freiburg bei Herder, wo ebeufalls
traubenartige Früchte in reich belaubteu Hülsen auftretcu. Jesse's Traum
bezeichuet uach typologischer Ausleguug auch jeuen des Scheukeu Pharao's.
Wer keunt uicht die weitere, etwas freiere Darstellung Christi aus einem
Rebstocke anstatt am Kreuze augenagelf?
Die Legende erzählt, daß auf dem Grabe des heiligen Bekenuers
Daviuus, welcher in Lukka besouders verehrt wird, eiue Rebe gewachseu
pflauzt die fromme Sitte der Alten nicht selten ciuen
sei. Uebcrhaupt
Der Weinftock in der christlichen Kunst.
Wciustock als Zeichen des Erlösers auf ihreu Gxäbern oder umgab die
Leichensteine mit diesem Oruament, so daß der Todte uuter diesen Zweigen
vou seiuen Müheu ausruhen kounte. Nach Oringhi zeigen altchristliche
Grabbilder oftmals Traubenkränze und in der Mitte das heilige Kiud
oder den guten Hirteu. Die Grabplatte der sel. Aurelia iu Regeus-
burg weist neben der Gestalt der edlen Priuzessiu eine schöue aufstrebende
Rebe auf. (Abb. i. Mitth. d. C. C. Wien 1871.) Vielleicht dachte
man hierbei an die Stelle beini Propheteu Michäas 4, 4: „Dann wird
ruhig Jeder uuter seiuem Weiustocke sitzen." Beide Gedanken, der
Weinstock als Siuubild Christi und als Hüter des Grabes, erscheineu
am Denkmale des Kauouikus Engelhart im Dome zu Wieu (v. I.
1559), auf welchem dem Kruzisix eiu Zweig mit Traubeu eutsprießt
uud sich über der Gestalt des Kuieendeu wölbt.
Häufig begegneu wir Gebäudetheilen des romanischen und gothischeu
Styls mit klarem Bezug auf die Bestimmuug des Baues als Gotteshaus
durch den Weinstock geschmückt. Die plastische Wirkuug der Traube,
die prächtigeu Kontvureu der Blätter uud die Verschliuguug der Ranken
bieten dem charakteristisch flylisirenden Geiste jeuer Zeit deu schönsten
Anhalt. Wir erinneru an die Bogenornameute vou St. Zeuo iu Veroua,
und besonders schön am Dvmc von Trient uud St. Apolliuar da-
selbst (am Thürsturz), au einer prachtvollen Konsole der Eßliuger
Frauenkirche. Die Thürpsosteu der Kapelle in der Burg Tyrol
(12. Jahrh.) sind mit Weinranken reich verziert (Abb. i. Kunstfreund
1887 Nr. 4). Die Kuppa des alteu PrachtkelcheS von Kloflerueu-
burg umgibt eiue geschlossene Reihe von Traubeu. Die schöueu Reb-
gewinde auf deu verschiedenen Parameuteu der Kirchen führt uns der
. „Kircheuschmuck" in vielen Musteru vor. Eiu beliebtes Bild des Mittel-
alters war die Darstelluug, wie Christus die Kelter trat oder vielmehr
in derselbe» steht, sein Blut strömt in Bächen aus deu füns großen
Wunden. Professor Kleiu ahmte im Jahre 1880 eine» solcheu Vor-
wurf uusercr Vorfahreu nach uud stellt Christus dar zwischen zahlreicheu
Zweigen eines Weinstockes, wie Er, mit Händen uud Füßeu au eiuer
Schraubeukelter angeuagelt, sein Blut Sich auspresseu lasseu muß. Wie
dieser Küustler füllt auch CrLker Schmalzl uach dem Muster der Alten
ganze Hiutergrüude mit zarteu Rebgewiuden aus. Die breiteu Hohl-
kehlen iu der Ilmrahmuug der Schreiue alter Flügelaltäre zieren die
herrlichsten Verschlingungen des Weinstockes, so auf jeuem bekannten
Flügelaltare mit der Gregoriusmesse, dann dem Altare zu Gossen-
saß am Fuße des Brenners (v. I. 1519) u. a. m.
Ju deu Händeu Mariä fiuden wir jeue Traube, welche ihreu Wein
für die Süuder speudeu soll, so auf einem Waudgemälde aus dem Eude
des 14. JahrhundertS iu der Kirche von Terlan und besonders in dc»
Werken der niederläudischen Malerschule, wovon das Belvedere iu Wien
mehrere dcrartige Muster aufzuweiseu hat. Ueber diese beliebte uud oft
wiederholte Darstelluug gebeu wiederum die Schristen des Mittelalters
den besten Aufschluß. Maria's Milch, die der Heiland sog, wird deni
kahnigeu Wei» der alten „eh" entgegengesetzt. Jn ächt deutschem, gemüth-
vollen Siune ist hiermit der Mutter Antheil am Verdieuste des gött-
licheu Sohnes gcgeben, wie die Sprache es auszudrückeu liebt: Er hat
mit der Muttermilch seiu Weseu eiugesogeu. Nach der Stelle des hohcn
Liedes: (Zuia metiorg. 8unk uderL kug vino tränkteu diese Brüstc deu
Sohn mit der süßesteu Milch und „es nam eude diu scerphe der alteu
e unt des piteren vines," denn Maria hatte diesen Weiu ohne Durst
getruuken, d. h. „si dieuete der e ane'sulde". Eine audere Stelle führt
deu Gedaukeu uoch weiter aus uud faßt dic mütterlichen Brüste als
Spender des »euen süßen Weiues, im Gegeusatze zum verdorbeuen Trant
deö alten Buudcs auf: erunk uderg kuu sunk botri vinene.
Nach der Stelle t kosuerunt rne euskockern in vlneis, vinenrn
rneani non euskoctlvi erscheiut Maria wieder der Mutter des Meuscheu-
geschlechtes gegeuüber gestellt. Eva brachte den Tod, Maria daS Leben,
jeue war im Paradiese, diese im Weiugarten. Eva reicht den Apsel dcs
Verderbens, Maria die Traube des Heiles, des Opfertodes ihres SohneS.
Eineu Beweis hierfür liefert eine Darstelluug bei d'Agiucourt pi 79,
wo ein Kiud eine Traube als Kleiuod und Schutzmittel hält, uud ein
Affe als Symbol des TeufelS eineu Apfel demselben entgegen bringt,
während er mit der auderen Haud die Traube dem Kiude zu eutreißeu
sucht. Der Jdee nach ist es wohl dasselbe, wenu im B r iru er Kreu z -
gaug der Eva mit dem Apfel gegeuüber die hl. Juugfrau „zwei Hostien"
als Sinnbild des Heiles für diesseits uud jeuseits darbietet, ähulich wie
iu Furtmayr's Rckssale für deu Erzbischof vou Salzburg des JahreS
1481; hier ist der Baum des Todes uud des Lebeus iu zwei Hälfteu
au eiuem Stamme dargestellt, hier Maria, dort Eva pflückeud. Diese
nimmt Aepfel herab, jeue Hostieu. Juteressant siud auch die vielen so-
geuanuten „Wein-Heiligen", welche dem Küustler Aulaß boteu, ihre Be-
ziehuugeu zum Rebgcwächse entsprechend auszudrücken. Den ersteu Raug
unter diesen Heiligeu nimmt wohl St. Urbau, Papst, cin. Zu Linz
am Rhcin gibt man auch dem hl. Douatus am 8. August als seiuem
Festtage eine reife Traube iu die Hand seines Bildnisses. Matthäus
wird zuweileu mit einer Traube auf der Brust abgebildct, wohl, wcil
er das Gleichniß vom Weiubcrge am ausführlichsteu mittheilt. Seiu
Gedächtuißtag, am 21. September, ist den Wiuzeru ein Loostag.
Auch die so häufig vorkommeude Stiftung uud Schenkuug vou Weiu-
gärten ist uicht immer auf die eiuzige Absicht zurückzuführeu, daß der
Gescheukgeber damit die betreffende Kirche in die Lage versetzeu wollte,
daß sie sick eher eineu ächten Opferwein verschasfeu köuutc, soudern daß
zugleich auch überhaupt seiue Hochachtuug sür die symbolische Bedeutung
des Weiuberges uud seiuer Früchte auSgesprochen werdeu sollte.
M Wie das Korn dem Unkraute bMatth. 13, 30), ist die Traube dern
Dorn (Lukaö 6, 44), Christeuthum uud Heideuthum, entgegeugesetzt.
Dieß faud bei deu uordischen Neubekehrteu iu noch größerem Maße an
Bedeutung. Die Ausrottung fiusterer Wälder, um Bodeu zu gewinnen,
die Anpstanzuug der Reben in demselbeu nud die Bereituug ihrer süßen
Gabe durch Pressung, bot ein passendes Gleichuiß zu dem Gegensatze von
Christenthum und Unglaubeu. Darum sagt die Erklärung des hoheu
Liedes, welche die Abtissiueu Riliudis und Herrat von Hohenburg
in Elsaß (1147—96) der Uebersetzung deö Willeram zur Stelle: Dum
llilms krLnsiik ekc. beisügten: Der kalte wiutir, der uugeloube ist hiue, —
die rebe die sol man suaitiu, uud zur auderu: Viirea llü etc.: der
suuare hat eiuiu wiugarteu gemachit, der ist der wiugarte der hailigen
christiuheit. (Wieuer Hofb. d. Haupt, Wien 1864.)
Christi Reich auf dieser Welt wird auch mit einem ganzen Wein-
garten verglicheu. Deu Aulah gebeu die Parabeln uud Aussprüche der
Evangelieu, uamentlich die Geschichte von den Arbeiteru im Weinberge
(Matth. 20) z. B. im Kreuzgange zu Brixen. Dieß wird noch
weiter geführt, indem die Patriarcheu, Propheten, Martyrer und Lchrer
iu die verschiedeneu Geschäfte iu demselbeu eingetheilt werden.
Viele Glaubensverküuder pflanzten gerne Reben aus der Stelle aus-
gerodeter heiliger Haine. In spätereu Tageu lasseu sich vor auderem
Benediktiuer die Pflege des Weiubaues augelegcu seiu uud es ist wohl
von Bedeutung sür uusere Untersuchuug, daß eine der berühmtesteu Abtcieu
dieses Ordeus in Deutschland das Blut Christi als Reliquie birgt uud
zugleich deu Nameu „Weiugarten" erhalten hat. Nicht miuder niuimt
der christliche Bilderkreis auch aus die Feinde des Gottesreiches oder die
Winzer Rücksicht, die des Herru Kuechte schlugen, als er sie um das
Erträguiß schickt (Matth. 21, 33, 42), ebeufalls im Brixuer-Kreuz-
gauge iu eiuem Bilde vorgeführt.
ChristuS selbst kommt als Weiustock vor. Häufig bildet ciu solcher
deu Stammbaum des Herrn aus der Wurzel Jesse, z. B. am Flügel-
altare von V. Stoß zu Krakau uud besonders auf vieleu Glasgemälden,
welche eiuzeln auch die Tyroler Glasmalerei zu JuuSbruck uud die
Bildcr vou St. Johanu Evangelist zu Touruai mit Glück wieder
aufuahmeu. Ein ähuliches Bild sindeu wir in dem soeben erschienenen
„Lebeusbaum nach Bouaventura", Freiburg bei Herder, wo ebeufalls
traubenartige Früchte in reich belaubteu Hülsen auftretcu. Jesse's Traum
bezeichuet uach typologischer Ausleguug auch jeuen des Scheukeu Pharao's.
Wer keunt uicht die weitere, etwas freiere Darstellung Christi aus einem
Rebstocke anstatt am Kreuze augenagelf?
Die Legende erzählt, daß auf dem Grabe des heiligen Bekenuers
Daviuus, welcher in Lukka besouders verehrt wird, eiue Rebe gewachseu
pflauzt die fromme Sitte der Alten nicht selten ciuen
sei. Uebcrhaupt
Der Weinftock in der christlichen Kunst.
Wciustock als Zeichen des Erlösers auf ihreu Gxäbern oder umgab die
Leichensteine mit diesem Oruament, so daß der Todte uuter diesen Zweigen
vou seiuen Müheu ausruhen kounte. Nach Oringhi zeigen altchristliche
Grabbilder oftmals Traubenkränze und in der Mitte das heilige Kiud
oder den guten Hirteu. Die Grabplatte der sel. Aurelia iu Regeus-
burg weist neben der Gestalt der edlen Priuzessiu eine schöue aufstrebende
Rebe auf. (Abb. i. Mitth. d. C. C. Wien 1871.) Vielleicht dachte
man hierbei an die Stelle beini Propheteu Michäas 4, 4: „Dann wird
ruhig Jeder uuter seiuem Weiustocke sitzen." Beide Gedanken, der
Weinstock als Siuubild Christi und als Hüter des Grabes, erscheineu
am Denkmale des Kauouikus Engelhart im Dome zu Wieu (v. I.
1559), auf welchem dem Kruzisix eiu Zweig mit Traubeu eutsprießt
uud sich über der Gestalt des Kuieendeu wölbt.
Häufig begegneu wir Gebäudetheilen des romanischen und gothischeu
Styls mit klarem Bezug auf die Bestimmuug des Baues als Gotteshaus
durch den Weinstock geschmückt. Die plastische Wirkuug der Traube,
die prächtigeu Kontvureu der Blätter uud die Verschliuguug der Ranken
bieten dem charakteristisch flylisirenden Geiste jeuer Zeit deu schönsten
Anhalt. Wir erinneru an die Bogenornameute vou St. Zeuo iu Veroua,
und besonders schön am Dvmc von Trient uud St. Apolliuar da-
selbst (am Thürsturz), au einer prachtvollen Konsole der Eßliuger
Frauenkirche. Die Thürpsosteu der Kapelle in der Burg Tyrol
(12. Jahrh.) sind mit Weinranken reich verziert (Abb. i. Kunstfreund
1887 Nr. 4). Die Kuppa des alteu PrachtkelcheS von Kloflerueu-
burg umgibt eiue geschlossene Reihe von Traubeu. Die schöueu Reb-
gewinde auf deu verschiedenen Parameuteu der Kirchen führt uns der
. „Kircheuschmuck" in vielen Musteru vor. Eiu beliebtes Bild des Mittel-
alters war die Darstelluug, wie Christus die Kelter trat oder vielmehr
in derselbe» steht, sein Blut strömt in Bächen aus deu füns großen
Wunden. Professor Kleiu ahmte im Jahre 1880 eine» solcheu Vor-
wurf uusercr Vorfahreu nach uud stellt Christus dar zwischen zahlreicheu
Zweigen eines Weinstockes, wie Er, mit Händen uud Füßeu au eiuer
Schraubeukelter angeuagelt, sein Blut Sich auspresseu lasseu muß. Wie
dieser Küustler füllt auch CrLker Schmalzl uach dem Muster der Alten
ganze Hiutergrüude mit zarteu Rebgewiuden aus. Die breiteu Hohl-
kehlen iu der Ilmrahmuug der Schreiue alter Flügelaltäre zieren die
herrlichsten Verschlingungen des Weinstockes, so auf jeuem bekannten
Flügelaltare mit der Gregoriusmesse, dann dem Altare zu Gossen-
saß am Fuße des Brenners (v. I. 1519) u. a. m.
Ju deu Händeu Mariä fiuden wir jeue Traube, welche ihreu Wein
für die Süuder speudeu soll, so auf einem Waudgemälde aus dem Eude
des 14. JahrhundertS iu der Kirche von Terlan und besonders in dc»
Werken der niederläudischen Malerschule, wovon das Belvedere iu Wien
mehrere dcrartige Muster aufzuweiseu hat. Ueber diese beliebte uud oft
wiederholte Darstelluug gebeu wiederum die Schristen des Mittelalters
den besten Aufschluß. Maria's Milch, die der Heiland sog, wird deni
kahnigeu Wei» der alten „eh" entgegengesetzt. Jn ächt deutschem, gemüth-
vollen Siune ist hiermit der Mutter Antheil am Verdieuste des gött-
licheu Sohnes gcgeben, wie die Sprache es auszudrückeu liebt: Er hat
mit der Muttermilch seiu Weseu eiugesogeu. Nach der Stelle des hohcn
Liedes: (Zuia metiorg. 8unk uderL kug vino tränkteu diese Brüstc deu
Sohn mit der süßesteu Milch und „es nam eude diu scerphe der alteu
e unt des piteren vines," denn Maria hatte diesen Weiu ohne Durst
getruuken, d. h. „si dieuete der e ane'sulde". Eine audere Stelle führt
deu Gedaukeu uoch weiter aus uud faßt dic mütterlichen Brüste als
Spender des »euen süßen Weiues, im Gegeusatze zum verdorbeuen Trant
deö alten Buudcs auf: erunk uderg kuu sunk botri vinene.
Nach der Stelle t kosuerunt rne euskockern in vlneis, vinenrn
rneani non euskoctlvi erscheiut Maria wieder der Mutter des Meuscheu-
geschlechtes gegeuüber gestellt. Eva brachte den Tod, Maria daS Leben,
jeue war im Paradiese, diese im Weiugarten. Eva reicht den Apsel dcs
Verderbens, Maria die Traube des Heiles, des Opfertodes ihres SohneS.
Eineu Beweis hierfür liefert eine Darstelluug bei d'Agiucourt pi 79,
wo ein Kiud eine Traube als Kleiuod und Schutzmittel hält, uud ein
Affe als Symbol des TeufelS eineu Apfel demselben entgegen bringt,
während er mit der auderen Haud die Traube dem Kiude zu eutreißeu
sucht. Der Jdee nach ist es wohl dasselbe, wenu im B r iru er Kreu z -
gaug der Eva mit dem Apfel gegeuüber die hl. Juugfrau „zwei Hostien"
als Sinnbild des Heiles für diesseits uud jeuseits darbietet, ähulich wie
iu Furtmayr's Rckssale für deu Erzbischof vou Salzburg des JahreS
1481; hier ist der Baum des Todes uud des Lebeus iu zwei Hälfteu
au eiuem Stamme dargestellt, hier Maria, dort Eva pflückeud. Diese
nimmt Aepfel herab, jeue Hostieu. Juteressant siud auch die vielen so-
geuanuten „Wein-Heiligen", welche dem Küustler Aulaß boteu, ihre Be-
ziehuugeu zum Rebgcwächse entsprechend auszudrücken. Den ersteu Raug
unter diesen Heiligeu nimmt wohl St. Urbau, Papst, cin. Zu Linz
am Rhcin gibt man auch dem hl. Douatus am 8. August als seiuem
Festtage eine reife Traube iu die Hand seines Bildnisses. Matthäus
wird zuweileu mit einer Traube auf der Brust abgebildct, wohl, wcil
er das Gleichniß vom Weiubcrge am ausführlichsteu mittheilt. Seiu
Gedächtuißtag, am 21. September, ist den Wiuzeru ein Loostag.
Auch die so häufig vorkommeude Stiftung uud Schenkuug vou Weiu-
gärten ist uicht immer auf die eiuzige Absicht zurückzuführeu, daß der
Gescheukgeber damit die betreffende Kirche in die Lage versetzeu wollte,
daß sie sick eher eineu ächten Opferwein verschasfeu köuutc, soudern daß
zugleich auch überhaupt seiue Hochachtuug sür die symbolische Bedeutung
des Weiuberges uud seiuer Früchte auSgesprochen werdeu sollte.