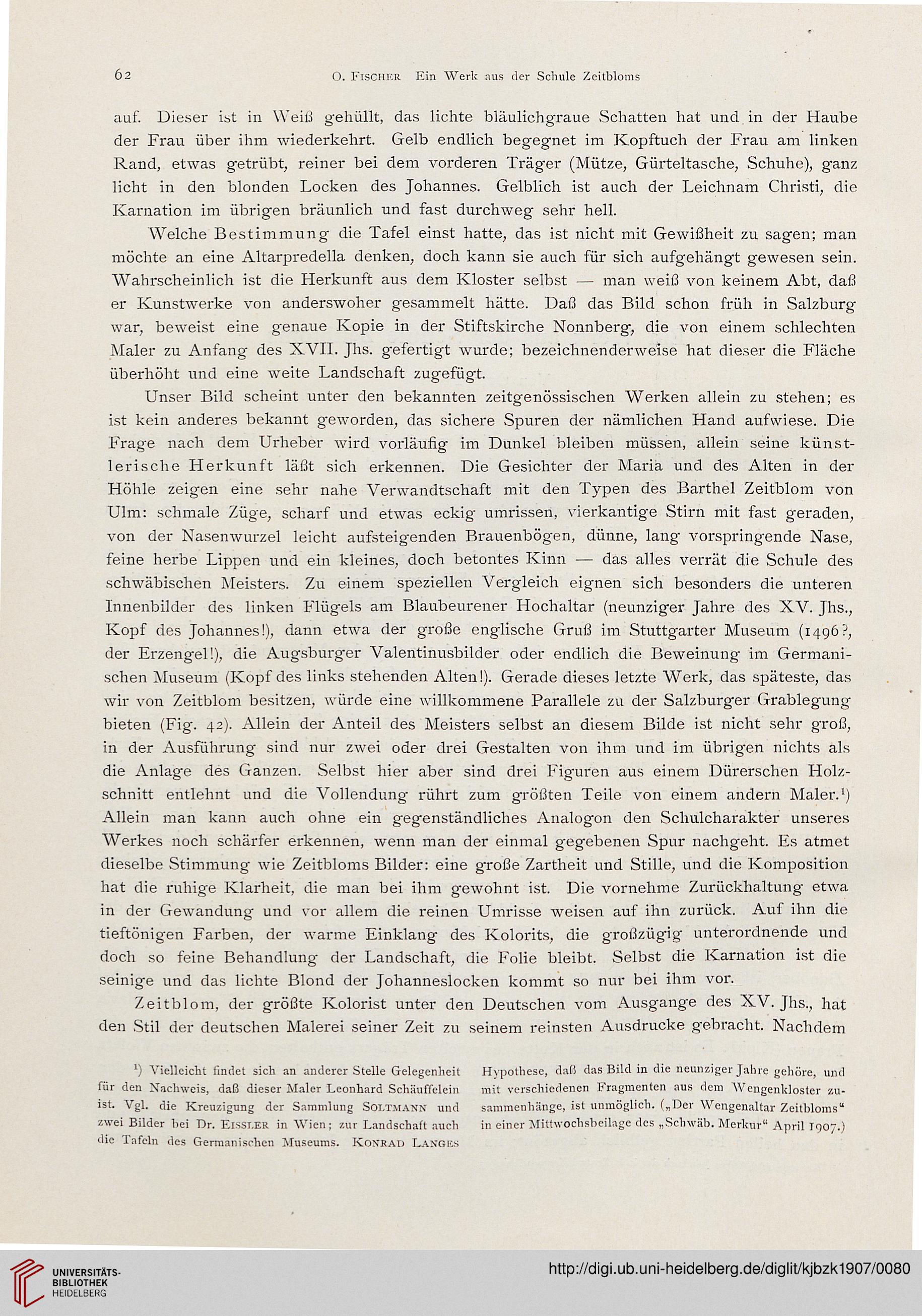6 2 O. Fischer Ein Werk aus der Schule Zeitbloms
auf. Dieser ist in Weiß gehüllt, das lichte bläulichgraue Schatten hat und in der Haube
der Frau über ihm wiederkehrt. Gelb endlich begegnet im Kopftuch der Frau am linken
Rand, etwas getrübt, reiner bei dem vorderen Träger (Mütze, Gürteltasche, Schuhe), ganz
licht in den blonden Locken des Johannes. Gelblich ist auch der Leichnam Christi, die
Karnation im übrigen bräunlich und fast durchweg sehr hell.
Welche Bestimmung die Tafel einst hatte, das ist nicht mit Gewißheit zu sagen; man
möchte an eine Altarpredella denken, doch kann sie auch für sich aufgehängt gewesen sein.
Wahrscheinlich ist die Herkunft aus dem Kloster selbst — man weiß von keinem Abt, daß
er Kunstwerke von anderswoher gesammelt hätte. Daß das Bild schon früh in Salzburg
war, beweist eine genaue Kopie in der Stiftskirche Nonnberg, die von einem schlechten
Maler zu Anfang des XVII. Jhs. gefertigt wurde; bezeichnenderweise hat dieser die Fläche
überhöht und eine weite Landschaft zugefügt.
Unser Bild scheint unter den bekannten zeitgenössischen Werken allein zu stehen; es
ist kein anderes bekannt geworden, das sichere Spuren der nämlichen Hand aufwiese. Die
Frage nach dem Urheber wird vorläufig im Dunkel bleiben müssen, allein seine künst-
lerische Herkunft läßt sich erkennen. Die Gesichter der Maria und des Alten in der
Höhle zeigen eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Typen des Barthel Zeitblom von
Ulm: schmale Züge, scharf und etwas eckig umrissen, vierkantige Stirn mit fast geraden,
von der Nasenwurzel leicht aufsteigenden Brauenbögen, dünne, lang vorspringende Nase,
feine herbe Lippen und ein kleines, doch betontes Kinn — das alles verrät die Schule des
schwäbischen Meisters. Zu einem speziellen Vergleich eignen sich besonders die unteren
Innenbilder des linken Flügels am Blaubeurener Hochaltar (neunziger Jahre des XV. Jhs.,
Kopf des Johannes!), dann etwa der große englische Gruß im Stuttgarter Museum (1496?,
der Erzengel!), die Augsburger Valentinusbilder oder endlich die Beweinung im Germani-
schen Museum (Kopf des links stehenden Alten!). Gerade dieses letzte Werk, das späteste, das
wir von Zeitblom besitzen, würde eine willkommene Parallele zu der Salzburger Grablegung
bieten (Fig. 42). Allein der Anteil des Meisters selbst an diesem Bilde ist nicht sehr groß,
in der Ausführung sind nur zwei oder drei Gestalten von ihm und im übrigen nichts als
die Anlage des Ganzen. Selbst hier aber sind drei Figuren aus einem Dürerschen Holz-
schnitt entlehnt und die Vollendung rührt zum größten Teile von einem andern Maler.1)
Allein man kann auch ohne ein gegenständliches Analogon den Schulcharakter unseres
Werkes noch schärfer erkennen, wenn man der einmal gegebenen Spur nachgeht. Es atmet
dieselbe Stimmung wie Zeitbloms Bilder: eine große Zartheit und Stille, und die Komposition
hat die ruhige Klarheit, die man bei ihm gewohnt ist. Die vornehme Zurückhaltung etwa
in der Gewandung und vor allem die reinen Umrisse weisen auf ihn zurück. Auf ihn die
tieftönigen Farben, der warme Einklang des Kolorits, die großzügig unterordnende und
doch so feine Behandlung der Landschaft, die Folie bleibt. Selbst die Karnation ist die
seinige und das lichte Blond der Johanneslocken kommt so nur bei ihm vor.
Zeitblom, der größte Kolorist unter den Deutschen vom Ausgange des XV. Jhs., hat
den Stil der deutschen Malerei seiner Zeit zu seinem reinsten Ausdrucke gebracht. Nachdem
*) Vielleicht findet sich an anderer Stelle Gelegenheit
für den Nachweis, daß dieser Maler Leonhard Schäuffelein
ist. Vgl. die Kreuzigung der Sammlung Sot.tmann und
zwei Bilder hei Dr. Eisst.er in Wien; zur Landschaft auch
die lafeln des Germanischen Museums. Kon'rad Langks
Hypothese, daß das Bild in die neunziger Jahre gehöre, und
mit verschiedenen Fragmenten aus dem AVengenldoster zu-
sammenhänge, ist unmöglich. („Der Wcngenaltar Zeitbloms"
in einer Mittwochsbeilage des „Schwab. Merkur" April I907.)
auf. Dieser ist in Weiß gehüllt, das lichte bläulichgraue Schatten hat und in der Haube
der Frau über ihm wiederkehrt. Gelb endlich begegnet im Kopftuch der Frau am linken
Rand, etwas getrübt, reiner bei dem vorderen Träger (Mütze, Gürteltasche, Schuhe), ganz
licht in den blonden Locken des Johannes. Gelblich ist auch der Leichnam Christi, die
Karnation im übrigen bräunlich und fast durchweg sehr hell.
Welche Bestimmung die Tafel einst hatte, das ist nicht mit Gewißheit zu sagen; man
möchte an eine Altarpredella denken, doch kann sie auch für sich aufgehängt gewesen sein.
Wahrscheinlich ist die Herkunft aus dem Kloster selbst — man weiß von keinem Abt, daß
er Kunstwerke von anderswoher gesammelt hätte. Daß das Bild schon früh in Salzburg
war, beweist eine genaue Kopie in der Stiftskirche Nonnberg, die von einem schlechten
Maler zu Anfang des XVII. Jhs. gefertigt wurde; bezeichnenderweise hat dieser die Fläche
überhöht und eine weite Landschaft zugefügt.
Unser Bild scheint unter den bekannten zeitgenössischen Werken allein zu stehen; es
ist kein anderes bekannt geworden, das sichere Spuren der nämlichen Hand aufwiese. Die
Frage nach dem Urheber wird vorläufig im Dunkel bleiben müssen, allein seine künst-
lerische Herkunft läßt sich erkennen. Die Gesichter der Maria und des Alten in der
Höhle zeigen eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Typen des Barthel Zeitblom von
Ulm: schmale Züge, scharf und etwas eckig umrissen, vierkantige Stirn mit fast geraden,
von der Nasenwurzel leicht aufsteigenden Brauenbögen, dünne, lang vorspringende Nase,
feine herbe Lippen und ein kleines, doch betontes Kinn — das alles verrät die Schule des
schwäbischen Meisters. Zu einem speziellen Vergleich eignen sich besonders die unteren
Innenbilder des linken Flügels am Blaubeurener Hochaltar (neunziger Jahre des XV. Jhs.,
Kopf des Johannes!), dann etwa der große englische Gruß im Stuttgarter Museum (1496?,
der Erzengel!), die Augsburger Valentinusbilder oder endlich die Beweinung im Germani-
schen Museum (Kopf des links stehenden Alten!). Gerade dieses letzte Werk, das späteste, das
wir von Zeitblom besitzen, würde eine willkommene Parallele zu der Salzburger Grablegung
bieten (Fig. 42). Allein der Anteil des Meisters selbst an diesem Bilde ist nicht sehr groß,
in der Ausführung sind nur zwei oder drei Gestalten von ihm und im übrigen nichts als
die Anlage des Ganzen. Selbst hier aber sind drei Figuren aus einem Dürerschen Holz-
schnitt entlehnt und die Vollendung rührt zum größten Teile von einem andern Maler.1)
Allein man kann auch ohne ein gegenständliches Analogon den Schulcharakter unseres
Werkes noch schärfer erkennen, wenn man der einmal gegebenen Spur nachgeht. Es atmet
dieselbe Stimmung wie Zeitbloms Bilder: eine große Zartheit und Stille, und die Komposition
hat die ruhige Klarheit, die man bei ihm gewohnt ist. Die vornehme Zurückhaltung etwa
in der Gewandung und vor allem die reinen Umrisse weisen auf ihn zurück. Auf ihn die
tieftönigen Farben, der warme Einklang des Kolorits, die großzügig unterordnende und
doch so feine Behandlung der Landschaft, die Folie bleibt. Selbst die Karnation ist die
seinige und das lichte Blond der Johanneslocken kommt so nur bei ihm vor.
Zeitblom, der größte Kolorist unter den Deutschen vom Ausgange des XV. Jhs., hat
den Stil der deutschen Malerei seiner Zeit zu seinem reinsten Ausdrucke gebracht. Nachdem
*) Vielleicht findet sich an anderer Stelle Gelegenheit
für den Nachweis, daß dieser Maler Leonhard Schäuffelein
ist. Vgl. die Kreuzigung der Sammlung Sot.tmann und
zwei Bilder hei Dr. Eisst.er in Wien; zur Landschaft auch
die lafeln des Germanischen Museums. Kon'rad Langks
Hypothese, daß das Bild in die neunziger Jahre gehöre, und
mit verschiedenen Fragmenten aus dem AVengenldoster zu-
sammenhänge, ist unmöglich. („Der Wcngenaltar Zeitbloms"
in einer Mittwochsbeilage des „Schwab. Merkur" April I907.)