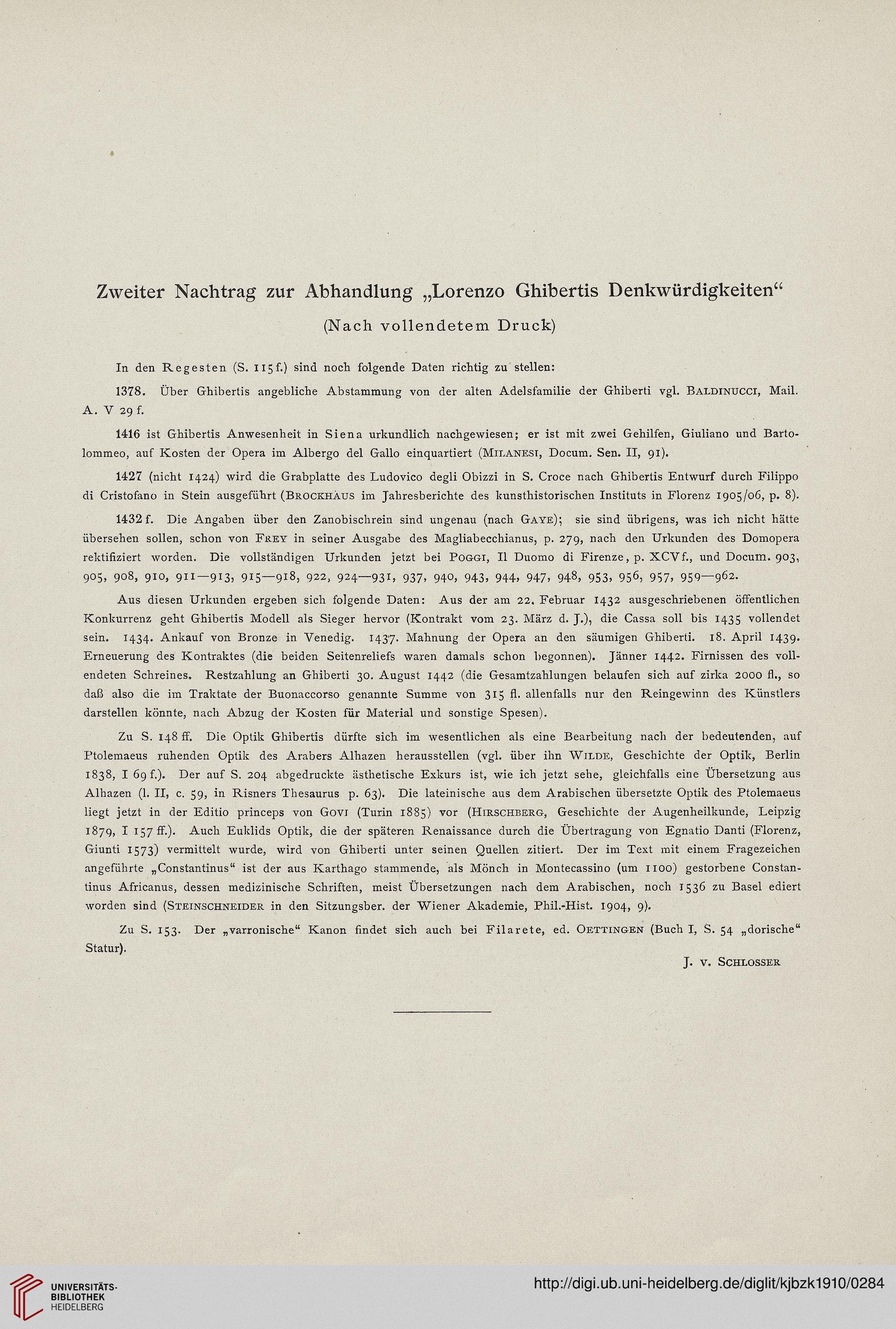Zweiter Nachtrag zur Abhandlung „Lorenzo Ghibertis Denkwürdigkeiten"
(Nach vollendetem Druck)
In den Regesten (S. H5f.) sind noch folgende Dnten richtig zu stellen:
1378. Über Ghibertis angebliche Abstnmmung von der alten Adelsfamilie der Ghiberti vgl. BALDiNUCCt, Mail.
A. V 29 f.
1416 ist Ghibertis Anwesenheit in Siena urkundlich nachgewiesen; er ist mit zwei Gehilfen, Giuliano und Barto-
lommeo, auf Kosten der Opera im Albergo del Gallo einquartiert (Mn.ANESt, Docum. Sen. II, 91).
1427 (nicht 1424) wird die Grabplatte des Ludovico degli Obizzi in S. Croce nach Ghibertis Entwurf durch Fiiippo
di Cristofano in Stein ausgefiihrt (BROCKHÄus im Jahresberichte des hunsthistorischen Instituts in Florenz 1905/06, p. 8).
1432 f. Die Angaben iiber den Zanobischrein sind ungenau (nach GAYE); sie sind iibrigens, was ich nicht hätte
iibersehen solien, schon von FREY in seiner Ausgabe des Magliabecchianus, p. 279, nach den Urkunden des Domopera
rektifiziert worden. Die vollständigen Urkunden jetzt bei PoGGi, II Duomo di Firenze.p. XCVf., undDocum. 903,
905. 9°3, 9:0. 911—913. 915—918, 922, 924—931, 937, 940, 943, 944, 947, 948, 953, 956, 957, 959—962.
Aus diesen Urkunden ergeben sich folgende Daten: Aus der am 22. Februar 1432 ausgeschriebenen öffentlichen
Konkurrenz geht Ghibertis Modell als Sieger hervor (Kontrakt vom 23. März d. J.), die Cassa soll bis 1435 vollendet
sein. 1434. Ankauf von Bronze in Venedig. 1437. Mahnung der Opera an den säumigen Ghiberti. 18. April 1439.
Erneuerung des Kontraktes (die beiden Seitenreliefs waren damals schon l.egonnen). Jänner 1442. Firnissen des voll-
endeten Schreines. Restzahlung an Ghiberti 30. August 1442 (die Gesamtzahlungen belaufen sich auf zirka 2000 ih, so
daß also die im Traktate der Buonaccorso genannte Summe von 315 allenfalls nur den Reingewinn des Kiinstlers
darstellen könnte, nach Abzug der Kosten für Material und sonstige Spesen).
Zu S. 148 ff. Die Optik Ghibertis dürfte sich im wesentlichen als eine Bearbeitung nach der bedeutenden, auf
I'tolemaeus ruhenden Optik des Arabers Alhazen herausstellen (vgl. iiber ihn W11.DE, Geschichte der Optik, Berlin
1838, I 69!). Der auf S. 204 abgedruckte ästhetische Exkurs ist, wie ich jetzt sehe, gleichfalls eine Übersetzung aus
Alhazen (I. II, c. 59, in Risners Thesaurus p. 63). Die lateinische aus dem Arabischen iibersetzte Optik des Ptolemaeus
liegt jetzt in der Editio princeps von Govi (Turin 1885) vor (HtRSCHBERG, Gescliichte der Augenheilkunde, Leipzig
1879, I 157 ff.). Auch Euklids Optik, die der späteren Renaissance durch die Übertragung von Egnatio Danti (Florenz,
Giunti 1573) vermittelt wurde, wird von Ghiberti unter seinen Quellen zitiert. Der im Text mit einem Fragezeichen
angeführte „Constantinus" ist der aus Karthago stammende, als Mönch in Montecassino (um 1100) gestorbene Constan-
tinus Africanus, dessen medizinische Schriften, meist Übersetzungen nach dem Arabischen, noch 1536 zu Basel ediert
worden sind (STEINSCHNEIDER in den Sitzungsber. der Wiener Akademie, Phil.-Hist. 1904, 9).
Zu S. 153. Der „varronische" Kanon hndet sich auch bei Filarete, ed. OETTINGEN (Buch I, S. 54 „dorische"
Statur).
J. V. SCHLOSSER
(Nach vollendetem Druck)
In den Regesten (S. H5f.) sind noch folgende Dnten richtig zu stellen:
1378. Über Ghibertis angebliche Abstnmmung von der alten Adelsfamilie der Ghiberti vgl. BALDiNUCCt, Mail.
A. V 29 f.
1416 ist Ghibertis Anwesenheit in Siena urkundlich nachgewiesen; er ist mit zwei Gehilfen, Giuliano und Barto-
lommeo, auf Kosten der Opera im Albergo del Gallo einquartiert (Mn.ANESt, Docum. Sen. II, 91).
1427 (nicht 1424) wird die Grabplatte des Ludovico degli Obizzi in S. Croce nach Ghibertis Entwurf durch Fiiippo
di Cristofano in Stein ausgefiihrt (BROCKHÄus im Jahresberichte des hunsthistorischen Instituts in Florenz 1905/06, p. 8).
1432 f. Die Angaben iiber den Zanobischrein sind ungenau (nach GAYE); sie sind iibrigens, was ich nicht hätte
iibersehen solien, schon von FREY in seiner Ausgabe des Magliabecchianus, p. 279, nach den Urkunden des Domopera
rektifiziert worden. Die vollständigen Urkunden jetzt bei PoGGi, II Duomo di Firenze.p. XCVf., undDocum. 903,
905. 9°3, 9:0. 911—913. 915—918, 922, 924—931, 937, 940, 943, 944, 947, 948, 953, 956, 957, 959—962.
Aus diesen Urkunden ergeben sich folgende Daten: Aus der am 22. Februar 1432 ausgeschriebenen öffentlichen
Konkurrenz geht Ghibertis Modell als Sieger hervor (Kontrakt vom 23. März d. J.), die Cassa soll bis 1435 vollendet
sein. 1434. Ankauf von Bronze in Venedig. 1437. Mahnung der Opera an den säumigen Ghiberti. 18. April 1439.
Erneuerung des Kontraktes (die beiden Seitenreliefs waren damals schon l.egonnen). Jänner 1442. Firnissen des voll-
endeten Schreines. Restzahlung an Ghiberti 30. August 1442 (die Gesamtzahlungen belaufen sich auf zirka 2000 ih, so
daß also die im Traktate der Buonaccorso genannte Summe von 315 allenfalls nur den Reingewinn des Kiinstlers
darstellen könnte, nach Abzug der Kosten für Material und sonstige Spesen).
Zu S. 148 ff. Die Optik Ghibertis dürfte sich im wesentlichen als eine Bearbeitung nach der bedeutenden, auf
I'tolemaeus ruhenden Optik des Arabers Alhazen herausstellen (vgl. iiber ihn W11.DE, Geschichte der Optik, Berlin
1838, I 69!). Der auf S. 204 abgedruckte ästhetische Exkurs ist, wie ich jetzt sehe, gleichfalls eine Übersetzung aus
Alhazen (I. II, c. 59, in Risners Thesaurus p. 63). Die lateinische aus dem Arabischen iibersetzte Optik des Ptolemaeus
liegt jetzt in der Editio princeps von Govi (Turin 1885) vor (HtRSCHBERG, Gescliichte der Augenheilkunde, Leipzig
1879, I 157 ff.). Auch Euklids Optik, die der späteren Renaissance durch die Übertragung von Egnatio Danti (Florenz,
Giunti 1573) vermittelt wurde, wird von Ghiberti unter seinen Quellen zitiert. Der im Text mit einem Fragezeichen
angeführte „Constantinus" ist der aus Karthago stammende, als Mönch in Montecassino (um 1100) gestorbene Constan-
tinus Africanus, dessen medizinische Schriften, meist Übersetzungen nach dem Arabischen, noch 1536 zu Basel ediert
worden sind (STEINSCHNEIDER in den Sitzungsber. der Wiener Akademie, Phil.-Hist. 1904, 9).
Zu S. 153. Der „varronische" Kanon hndet sich auch bei Filarete, ed. OETTINGEN (Buch I, S. 54 „dorische"
Statur).
J. V. SCHLOSSER