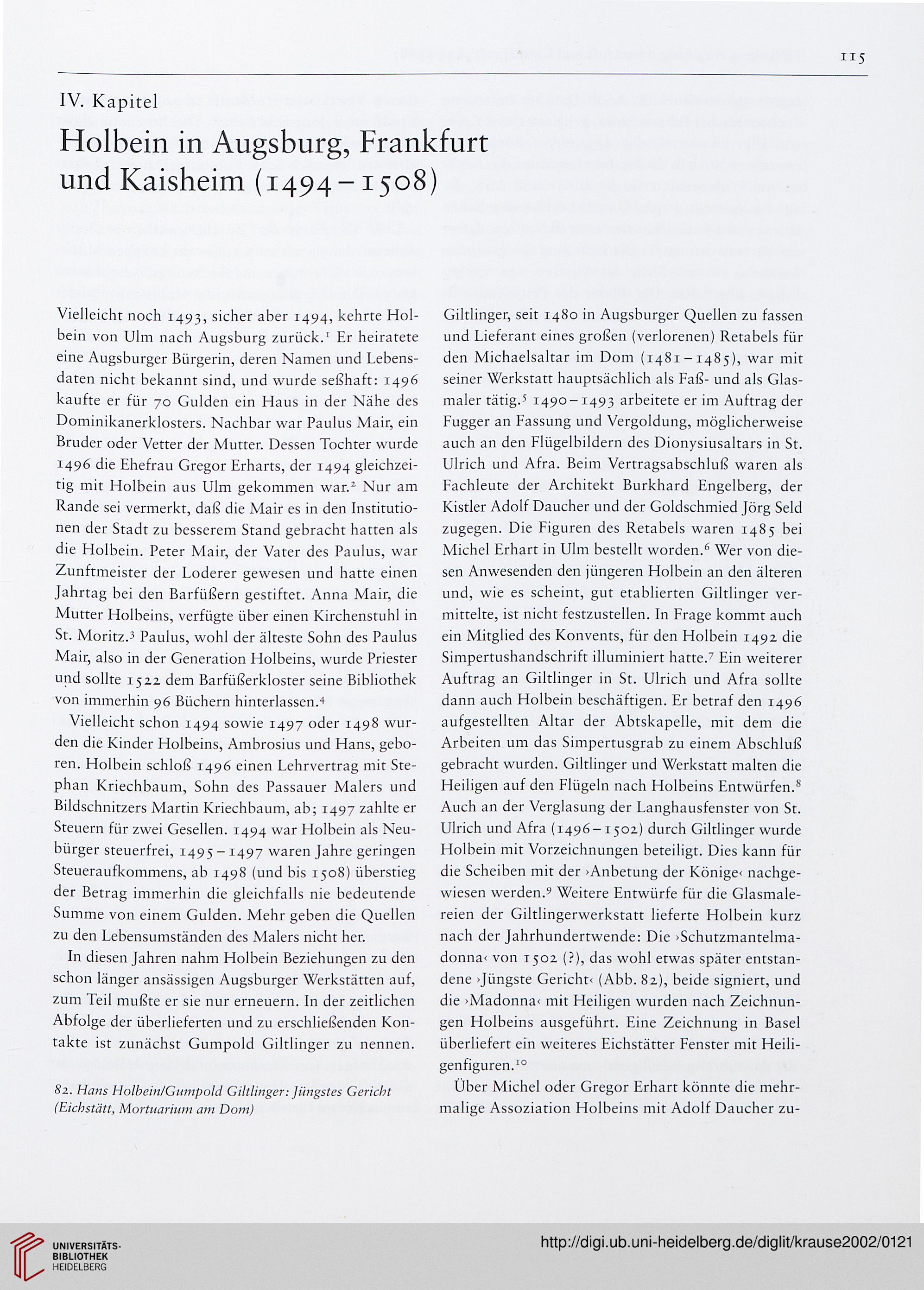IV. Kapitel
Holbein in Augsburg, Frankfurt
und Kaisheim (1494- 1508)
Vielleicht noch 1493, sicher aber 1494, kehrte Hol-
bein von Ulm nach Augsburg zurück.' Er heiratete
eine Augsburger Bürgerin, deren Namen und Lebens-
daten nicht bekannt sind, und wurde seßhaft: 1496
kaufte er für 70 Gulden ein Haus in der Nähe des
Dominikanerklosters. Nachbar war Paulus Mair, ein
Bruder oder Vetter der Mutter. Dessen Tochter wurde
1496 die Ehefrau Gregor Erharts, der 1494 gleichzei-
tig mit Holbein aus Ulm gekommen war.2 Nur am
Rande sei vermerkt, daß die Mair es in den Institutio-
nen der Stadt zu besserem Stand gebracht hatten als
die Holbein. Peter Mair, der Vater des Paulus, war
Zunftmeister der Loderer gewesen und hatte einen
Jahrtag bei den Barfüßern gestiftet. Anna Mair, die
Mutter Holbeins, verfügte über einen Kirchenstuhl in
St. Moritz.3 Paulus, wohl der älteste Sohn des Paulus
Mair, also in der Generation Holbeins, wurde Priester
und sollte 1522 dem Barfüßerkloster seine Bibliothek
von immerhin 96 Büchern hinterlassen.4
Vielleicht schon 1494 sowie 1497 oder 1498 wur-
den die Kinder Holbeins, Ambrosius und Hans, gebo-
ren. Holbein schloß 1496 einen Lehrvertrag mit Ste-
phan Kriechbaum, Sohn des Passauer Malers und
Bildschnitzers Martin Kriechbaum, ab; 1497 zahlte er
Steuern für zwei Gesellen. 1494 war Holbein als Neu-
bürger steuerfrei, 1495 - 1497 waren Jahre geringen
Steueraufkommens, ab 1498 (und bis 1508) überstieg
der Betrag immerhin die gleichfalls nie bedeutende
Summe von einem Gulden. Mehr geben die Quellen
zu den Lebensumständen des Malers nicht her.
In diesen Jahren nahm Holbein Beziehungen zu den
schon länger ansässigen Augsburger Werkstätten auf,
zum Teil mußte er sie nur erneuern. In der zeitlichen
Abfolge der überlieferten und zu erschließenden Kon-
takte ist zunächst Gumpold Giltlinger zu nennen.
82. Hans Holbein/Gumpold Giltlinger: Jüngstes Gericht
(Eichstätt, Mortiiarium am Dom)
Giltlinger, seit 1480 in Augsburger Quellen zu fassen
und Lieferant eines großen (verlorenen) Retabels für
den Michaelsaltar im Dom (1481-1485), war mit
seiner Werkstatt hauptsächlich als Faß- und als Glas-
maler tätig.5 1490- 1493 arbeitete er im Auftrag der
Fugger an Fassung und Vergoldung, möglicherweise
auch an den Flügelbildern des Dionysiusaltars in St.
Ulrich und Afra. Beim Vertragsabschluß waren als
Fachleute der Architekt Burkhard Engelberg, der
Kistler Adolf Daucher und der Goldschmied Jörg Seid
zugegen. Die Figuren des Retabels waren 1485 bei
Michel Erhart in Ulm bestellt worden.6 Wer von die-
sen Anwesenden den jüngeren Holbein an den älteren
und, wie es scheint, gut etablierten Giltlinger ver-
mittelte, ist nicht festzustellen. In Frage kommt auch
ein Mitglied des Konvents, für den Holbein 1492 die
Simpertushandschrift illuminiert hatte.7 Ein weiterer
Auftrag an Giltlinger in St. Ulrich und Afra sollte
dann auch Holbein beschäftigen. Er betraf den 1496
aufgestellten Altar der Abtskapelle, mit dem die
Arbeiten um das Simpertusgrab zu einem Abschluß
gebracht wurden. Giltlinger und Werkstatt malten die
Heiligen auf den Flügeln nach Holbeins Entwürfen.8
Auch an der Verglasung der Langhausfenster von St.
Ulrich und Afra (1496-1502) durch Giltlinger wurde
Holbein mit Vorzeichnungen beteiligt. Dies kann für
die Scheiben mit der >Anbetung der Könige« nachge-
wiesen werden.9 Weitere Entwürfe für die Glasmale-
reien der Giltlingerwerkstatt lieferte Holbein kurz
nach der Jahrhundertwende: Die >Schutzmantelma-
donna« von 1502 (?), das wohl etwas später entstan-
dene Jüngste Gericht« (Abb. 82), beide signiert, und
die >Madonna< mit Heiligen wurden nach Zeichnun-
gen Holbeins ausgeführt. Eine Zeichnung in Basel
überliefert ein weiteres Eichstätter Fenster mit Heili-
genfiguren.10
Über Michel oder Gregor Erhart könnte die mehr-
malige Assoziation Holbeins mit Adolf Daucher zu-
Holbein in Augsburg, Frankfurt
und Kaisheim (1494- 1508)
Vielleicht noch 1493, sicher aber 1494, kehrte Hol-
bein von Ulm nach Augsburg zurück.' Er heiratete
eine Augsburger Bürgerin, deren Namen und Lebens-
daten nicht bekannt sind, und wurde seßhaft: 1496
kaufte er für 70 Gulden ein Haus in der Nähe des
Dominikanerklosters. Nachbar war Paulus Mair, ein
Bruder oder Vetter der Mutter. Dessen Tochter wurde
1496 die Ehefrau Gregor Erharts, der 1494 gleichzei-
tig mit Holbein aus Ulm gekommen war.2 Nur am
Rande sei vermerkt, daß die Mair es in den Institutio-
nen der Stadt zu besserem Stand gebracht hatten als
die Holbein. Peter Mair, der Vater des Paulus, war
Zunftmeister der Loderer gewesen und hatte einen
Jahrtag bei den Barfüßern gestiftet. Anna Mair, die
Mutter Holbeins, verfügte über einen Kirchenstuhl in
St. Moritz.3 Paulus, wohl der älteste Sohn des Paulus
Mair, also in der Generation Holbeins, wurde Priester
und sollte 1522 dem Barfüßerkloster seine Bibliothek
von immerhin 96 Büchern hinterlassen.4
Vielleicht schon 1494 sowie 1497 oder 1498 wur-
den die Kinder Holbeins, Ambrosius und Hans, gebo-
ren. Holbein schloß 1496 einen Lehrvertrag mit Ste-
phan Kriechbaum, Sohn des Passauer Malers und
Bildschnitzers Martin Kriechbaum, ab; 1497 zahlte er
Steuern für zwei Gesellen. 1494 war Holbein als Neu-
bürger steuerfrei, 1495 - 1497 waren Jahre geringen
Steueraufkommens, ab 1498 (und bis 1508) überstieg
der Betrag immerhin die gleichfalls nie bedeutende
Summe von einem Gulden. Mehr geben die Quellen
zu den Lebensumständen des Malers nicht her.
In diesen Jahren nahm Holbein Beziehungen zu den
schon länger ansässigen Augsburger Werkstätten auf,
zum Teil mußte er sie nur erneuern. In der zeitlichen
Abfolge der überlieferten und zu erschließenden Kon-
takte ist zunächst Gumpold Giltlinger zu nennen.
82. Hans Holbein/Gumpold Giltlinger: Jüngstes Gericht
(Eichstätt, Mortiiarium am Dom)
Giltlinger, seit 1480 in Augsburger Quellen zu fassen
und Lieferant eines großen (verlorenen) Retabels für
den Michaelsaltar im Dom (1481-1485), war mit
seiner Werkstatt hauptsächlich als Faß- und als Glas-
maler tätig.5 1490- 1493 arbeitete er im Auftrag der
Fugger an Fassung und Vergoldung, möglicherweise
auch an den Flügelbildern des Dionysiusaltars in St.
Ulrich und Afra. Beim Vertragsabschluß waren als
Fachleute der Architekt Burkhard Engelberg, der
Kistler Adolf Daucher und der Goldschmied Jörg Seid
zugegen. Die Figuren des Retabels waren 1485 bei
Michel Erhart in Ulm bestellt worden.6 Wer von die-
sen Anwesenden den jüngeren Holbein an den älteren
und, wie es scheint, gut etablierten Giltlinger ver-
mittelte, ist nicht festzustellen. In Frage kommt auch
ein Mitglied des Konvents, für den Holbein 1492 die
Simpertushandschrift illuminiert hatte.7 Ein weiterer
Auftrag an Giltlinger in St. Ulrich und Afra sollte
dann auch Holbein beschäftigen. Er betraf den 1496
aufgestellten Altar der Abtskapelle, mit dem die
Arbeiten um das Simpertusgrab zu einem Abschluß
gebracht wurden. Giltlinger und Werkstatt malten die
Heiligen auf den Flügeln nach Holbeins Entwürfen.8
Auch an der Verglasung der Langhausfenster von St.
Ulrich und Afra (1496-1502) durch Giltlinger wurde
Holbein mit Vorzeichnungen beteiligt. Dies kann für
die Scheiben mit der >Anbetung der Könige« nachge-
wiesen werden.9 Weitere Entwürfe für die Glasmale-
reien der Giltlingerwerkstatt lieferte Holbein kurz
nach der Jahrhundertwende: Die >Schutzmantelma-
donna« von 1502 (?), das wohl etwas später entstan-
dene Jüngste Gericht« (Abb. 82), beide signiert, und
die >Madonna< mit Heiligen wurden nach Zeichnun-
gen Holbeins ausgeführt. Eine Zeichnung in Basel
überliefert ein weiteres Eichstätter Fenster mit Heili-
genfiguren.10
Über Michel oder Gregor Erhart könnte die mehr-
malige Assoziation Holbeins mit Adolf Daucher zu-