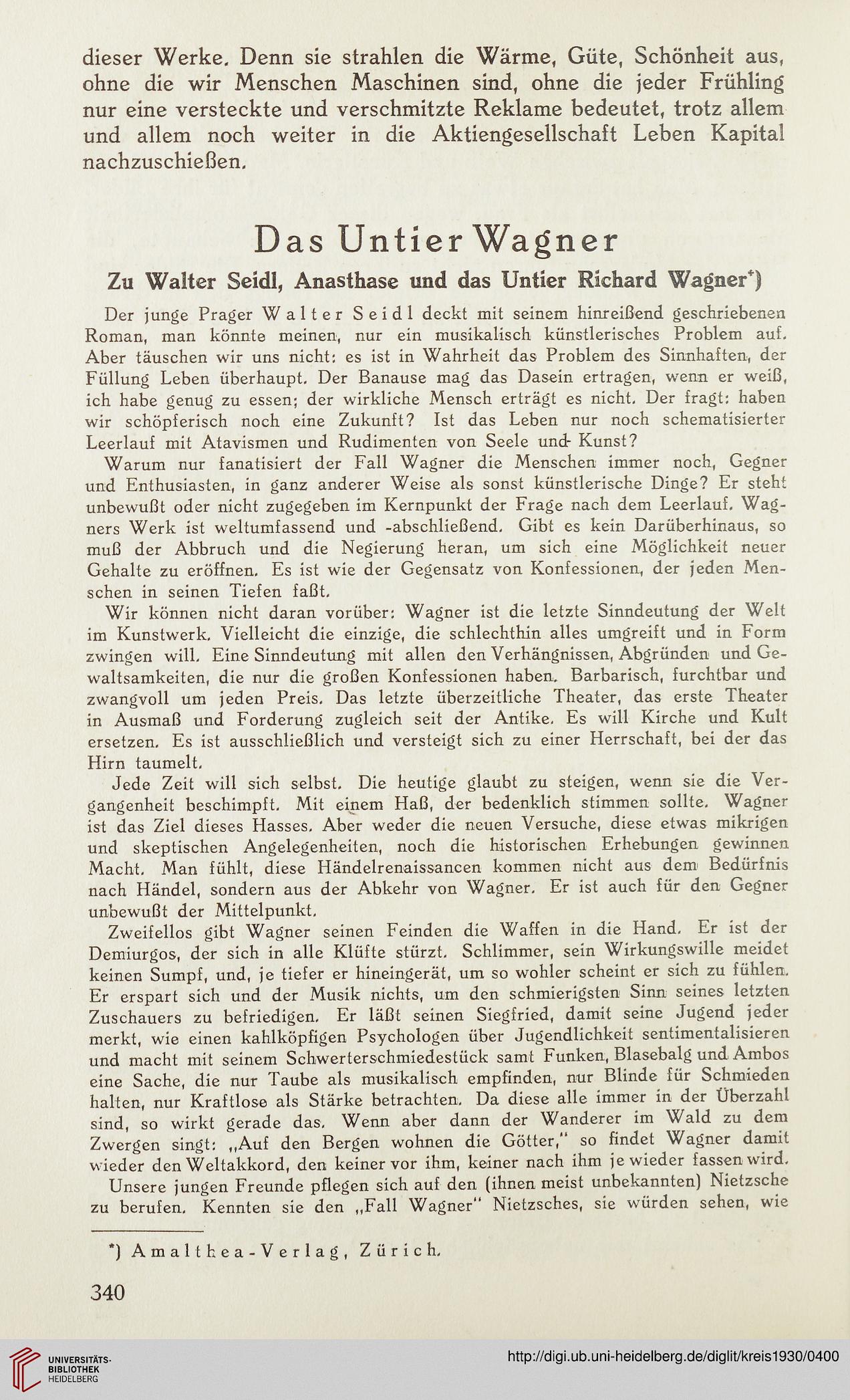dieser Werke, Denn sie strahlen die Wärme, Güte, Schönheit aus,
ohne die wir Menschen Maschinen sind, ohne die jeder Frühling
nur eine versteckte und verschmitzte Reklame bedeutet, trotz allem
und allem noch weiter in die Aktiengesellschaft Leben Kapital
nachzuschießen.
Das UntierWagner
Zu Walter Seidl, Anasthase und das Untier Richard Wagner*)
Der junge Prager Walter Seidl deckt mit seinem hinreißend geschriebenen
Roman, man könnte meinen, nur ein musikalisch künstlerisches Problem auf.
Aber täuschen wir uns nicht: es ist in Wahrheit das Problem des Sinnhaften, der
Füllung Leben überhaupt. Der Banause mag das Dasein ertragen, wenn er weiß,
ich habe genug zu essen; der wirkliche Mensch erträgt es nicht, Der fragt: haben
wir schöpferisch noch eine Zukunft? Ist das Leben nur noch schematisierter
Leerlauf mit Atavismen und Rudimenten von Seele und- Kunst?
Warum nur fanatisiert der Fall Wagner die Menschen immer noch, Gegner
und Enthusiasten, in ganz anderer Weise als sonst künstlerische Dinge? Er steht
unbewußt oder nicht zugegeben im Kernpunkt der Frage nach dem Leerlauf. Wag-
ners Werk ist weltumfassend und -abschließend. Gibt es kein Darüberhinaus, so
muß der Abbruch und die Negierung heran, um sich eine Möglichkeit neuer
Gehalte zu eröffnen. Es ist wie der Gegensatz von Konfessionen, der jeden Men-
schen in seinen Tiefen faßt.
Wir können nicht daran vorüber: Wagner ist die letzte Sinndeutung der Welt
im Kunstwerk. Vielleicht die einzige, die schlechthin alles umgreift und in Form
zwingen will. Eine Sinndeutung mit allen den Verhängnissen, Abgründen und Ge-
waltsamkeiten, die nur die großen Konfessionen haben. Barbarisch, furchtbar und
zwangvoll um jeden Preis. Das letzte überzeitliche Theater, das erste Theater
in Ausmaß und Forderung zugleich seit der Antike, Es will Kirche und Kult
ersetzen. Es ist ausschließlich und versteigt sich zu einer Herrschaft, bei der das
Hirn taumelt.
Jede Zeit will sich selbst. Die heutige glaubt zu steigen, wenn sie die Ver-
gangenheit beschimpft. Mit einem Haß, der bedenklich stimmen sollte. Wagner
ist das Ziel dieses Hasses, Aber weder die neuen Versuche, diese etwas mikrigen
und skeptischen Angelegenheiten, noch die historischen Erhebungen gewinnen
Macht. Man fühlt, diese Händelrenaissancen kommen nicht aus dem Bedürfnis
nach Händel, sondern aus der Abkehr von Wagner, Er ist auch für den Gegner
unbewußt der Mittelpunkt.
Zweifellos gibt Wagner seinen Feinden die Waffen in die Hand. Er ist der
Demiurgos, der sich in alle Klüfte stürzt. Schlimmer, sein Wirkungswille meidet
keinen Sumpf, und, je tiefer er hineingerät, um so wohler scheint er sich zu fühlen.
Er erspart sich und der Musik nichts, um den schmierigsten Sinn seines letzten
Zuschauers zu befriedigen. Er läßt seinen Siegfried, damit seine Jugend jeder
merkt, wie einen kahlköpfigen Psychologen über Jugendlichkeit sentimentalisieren
und macht mit seinem Schwerterschmiedestück samt Funken, Blasebalg und Ambos
eine Sache, die nur Taube als musikalisch empfinden, nur Blinde für Schmieden
halten, nur Kraftlose als Stärke betrachten. Da diese alle immer in der Überzahl
sind, so wirkt gerade das. Wenn aber dann der Wanderer im Wald zu dem
Zwergen singt: ,,Auf den Bergen wohnen die Götter," so findet Wagner damit
wieder den Weltakkord, den keiner vor ihm, keiner nach ihm je wieder fassen wird.
Unsere jungen Freunde pflegen sich auf den (ihnen meist unbekannten) Nietzsche
zu berufen. Kennten sie den „Fall Wagner“ Nietzsches, sie würden sehen, wie
*) Amalt he a - Verlag , Zürich,
340
ohne die wir Menschen Maschinen sind, ohne die jeder Frühling
nur eine versteckte und verschmitzte Reklame bedeutet, trotz allem
und allem noch weiter in die Aktiengesellschaft Leben Kapital
nachzuschießen.
Das UntierWagner
Zu Walter Seidl, Anasthase und das Untier Richard Wagner*)
Der junge Prager Walter Seidl deckt mit seinem hinreißend geschriebenen
Roman, man könnte meinen, nur ein musikalisch künstlerisches Problem auf.
Aber täuschen wir uns nicht: es ist in Wahrheit das Problem des Sinnhaften, der
Füllung Leben überhaupt. Der Banause mag das Dasein ertragen, wenn er weiß,
ich habe genug zu essen; der wirkliche Mensch erträgt es nicht, Der fragt: haben
wir schöpferisch noch eine Zukunft? Ist das Leben nur noch schematisierter
Leerlauf mit Atavismen und Rudimenten von Seele und- Kunst?
Warum nur fanatisiert der Fall Wagner die Menschen immer noch, Gegner
und Enthusiasten, in ganz anderer Weise als sonst künstlerische Dinge? Er steht
unbewußt oder nicht zugegeben im Kernpunkt der Frage nach dem Leerlauf. Wag-
ners Werk ist weltumfassend und -abschließend. Gibt es kein Darüberhinaus, so
muß der Abbruch und die Negierung heran, um sich eine Möglichkeit neuer
Gehalte zu eröffnen. Es ist wie der Gegensatz von Konfessionen, der jeden Men-
schen in seinen Tiefen faßt.
Wir können nicht daran vorüber: Wagner ist die letzte Sinndeutung der Welt
im Kunstwerk. Vielleicht die einzige, die schlechthin alles umgreift und in Form
zwingen will. Eine Sinndeutung mit allen den Verhängnissen, Abgründen und Ge-
waltsamkeiten, die nur die großen Konfessionen haben. Barbarisch, furchtbar und
zwangvoll um jeden Preis. Das letzte überzeitliche Theater, das erste Theater
in Ausmaß und Forderung zugleich seit der Antike, Es will Kirche und Kult
ersetzen. Es ist ausschließlich und versteigt sich zu einer Herrschaft, bei der das
Hirn taumelt.
Jede Zeit will sich selbst. Die heutige glaubt zu steigen, wenn sie die Ver-
gangenheit beschimpft. Mit einem Haß, der bedenklich stimmen sollte. Wagner
ist das Ziel dieses Hasses, Aber weder die neuen Versuche, diese etwas mikrigen
und skeptischen Angelegenheiten, noch die historischen Erhebungen gewinnen
Macht. Man fühlt, diese Händelrenaissancen kommen nicht aus dem Bedürfnis
nach Händel, sondern aus der Abkehr von Wagner, Er ist auch für den Gegner
unbewußt der Mittelpunkt.
Zweifellos gibt Wagner seinen Feinden die Waffen in die Hand. Er ist der
Demiurgos, der sich in alle Klüfte stürzt. Schlimmer, sein Wirkungswille meidet
keinen Sumpf, und, je tiefer er hineingerät, um so wohler scheint er sich zu fühlen.
Er erspart sich und der Musik nichts, um den schmierigsten Sinn seines letzten
Zuschauers zu befriedigen. Er läßt seinen Siegfried, damit seine Jugend jeder
merkt, wie einen kahlköpfigen Psychologen über Jugendlichkeit sentimentalisieren
und macht mit seinem Schwerterschmiedestück samt Funken, Blasebalg und Ambos
eine Sache, die nur Taube als musikalisch empfinden, nur Blinde für Schmieden
halten, nur Kraftlose als Stärke betrachten. Da diese alle immer in der Überzahl
sind, so wirkt gerade das. Wenn aber dann der Wanderer im Wald zu dem
Zwergen singt: ,,Auf den Bergen wohnen die Götter," so findet Wagner damit
wieder den Weltakkord, den keiner vor ihm, keiner nach ihm je wieder fassen wird.
Unsere jungen Freunde pflegen sich auf den (ihnen meist unbekannten) Nietzsche
zu berufen. Kennten sie den „Fall Wagner“ Nietzsches, sie würden sehen, wie
*) Amalt he a - Verlag , Zürich,
340