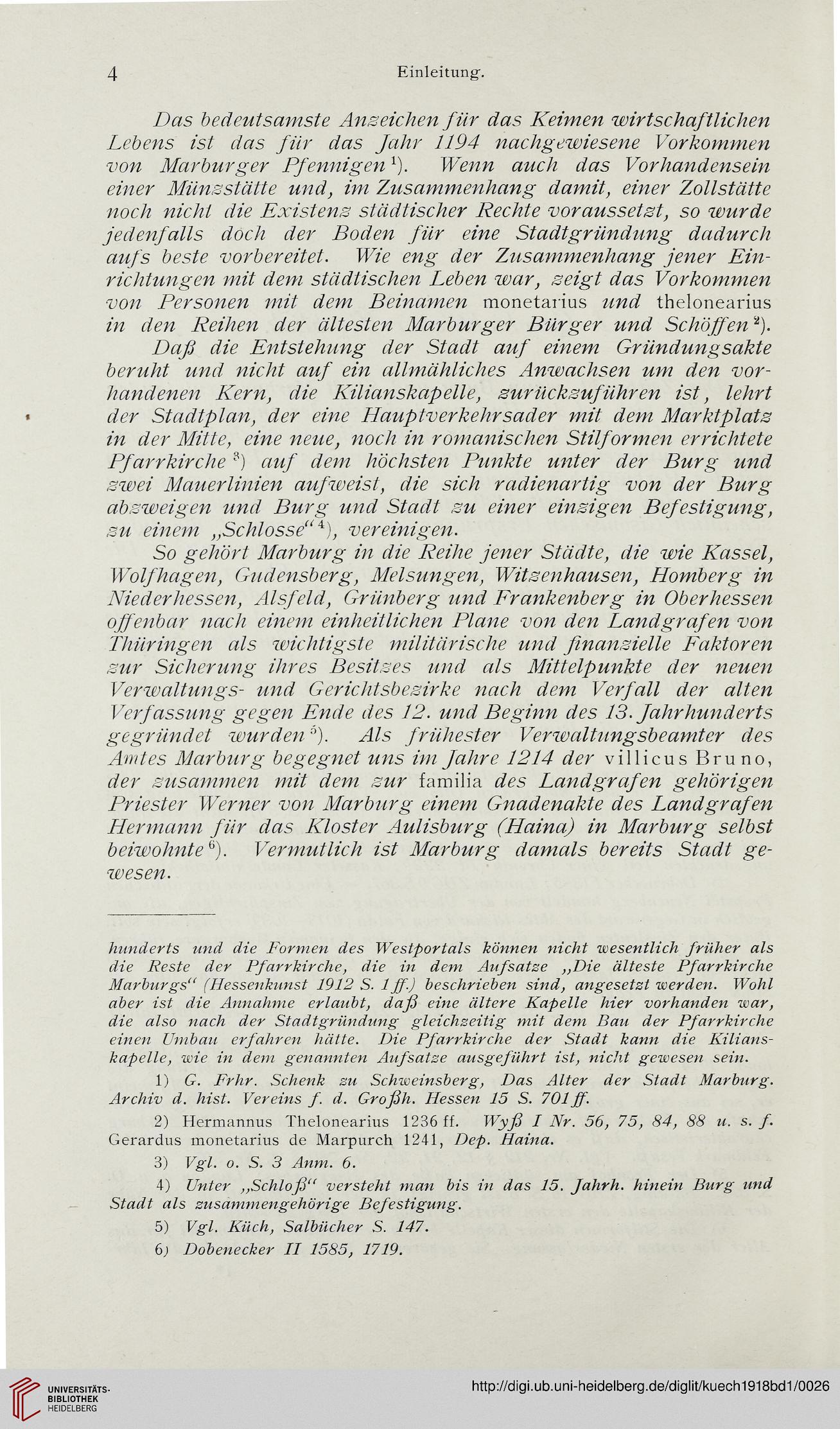4
Einleitung".
Das bedeutsamste Anseichen für das Keimen wirtschaftlichen
Lebens ist das für das Jahr 1194 nachgewiesene Vorkommen
von Marburger PfennigenL). Wenn auch das Vorhandensein
einer Münzstätte und, im Zusammenhang damit, einer Zollstätte
noch nicht die Existens städtischer Rechte voraussetst, so wurde
jedenfalls doch der Boden für eine Stadtgründung dadurch
aufs beste vorbereitet. Wie eng der Zusammenhang jener Ein-
richtungen mit dem städtischen Leben war, seigt das Vorkommen
von Personen mit dem Beinamen monetarius und thelonearius
in den Reihen der ältesten Marburger Bürger und Schöffen* 1 2 3 4).
Daß die Entstehung der Stadt auf einem Gründungsakte
beruht und nicht auf ein allmähliches Anwachsen um den vor-
handenen Kern, die Kilianskapelle, zurückzufUhren ist, lehrt
der Stadtplan, der eine Hauptverkehrsader mit dem Marktplatz
in der Mitte, eine neue, noch in romanischen Stilformen errichtete
Pfarrkirche ?) auf dem höchsten Punkte unter der Burg und
zwei Mauerlinien aufweist, die sich radienartig von der Burg
abzweigen und Burg und Stadt zu einer einzigen Befestigung,
zu einem „Schlosse“ f, vereinigen.
So gehört Marburg in die Reihe jener Städte, die wie Kassel,
Wolfhagen, Gudensberg, Melsungen, Witzenhausen, Homberg in
Niederhessen, Alsfeld, Grimberg und Frankenberg in Oberhessen
offenbar nach einem einheitlichen Plane von den Landgrafen von
Thüringen als wichtigste militärische und finanzielle Faktoren
zur Sicherung ihres Besitzes und als Mittelpunkte der neuen
Verwaltungs- und Gerichtsbezirke nach dem Verfall der alten
Verfassung gegen Ende des 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts
gegründet wurden5). Als frühester Verwaltungsbeamter des
Amtes Marburg begegnet uns im Jahre 1214 der villicus Bruno,
der zusammen mit dem zur familia des Landgrafen gehörigen
Priester Werner von Marburg einem Gnadenakte des Landgrafen
Hermann für das Kloster Aulisburg (Haina) in Marburg selbst
beiwohnte6). Vermutlich ist Marburg damals bereits Stadt ge-
wesen.
hunderts und die Formen des Westportals können nicht wesentlich früher als
die Reste der Pfarrkirche, die in dem Aufsatze „Die älteste Pfarrkirche
Marburgs“ (Hessenkunst 1912 S. 1 ff.) beschrieben sind, an gesetzt werden. Wohl
aber ist die Annahme erlaubt, daß eine ältere Kapelle hier vorhanden war,
die also nach der Stadtgründung gleichzeitig mit dem Bau der Pfarrkirche
einen Umbau erfahren hätte. Die Pfarrkirche der Stadt kann die Kilians-
kapelle, wie in dem genannten Aufsätze ausgeführt ist, nicht gewesen sein.
1) G. Frhr. Schenk zu Schweinsberg, Das Alter der Stadt Marburg.
Archiv d. hist. Vereins f. d. Großh. Hessen 15 S. 701 ff.
2) Hermannus Thelonearius 1236 ff. Wyß I Nr. 56, 75, 84, 88 u. s. f.
Gerardus monetarius de Marpurch 1241, Dep. Haina.
3) Vgl. o. S. 3 Anm. 6.
4) Unter „Schloß“ versteht man bis in das 15. Jahrh. hinein Burg und
Stadt als zusammengehörige Befestigung.
5) Vgl. Küch, Salbiicher S. 147.
6) Dobenecker II 1585, 1719.
Einleitung".
Das bedeutsamste Anseichen für das Keimen wirtschaftlichen
Lebens ist das für das Jahr 1194 nachgewiesene Vorkommen
von Marburger PfennigenL). Wenn auch das Vorhandensein
einer Münzstätte und, im Zusammenhang damit, einer Zollstätte
noch nicht die Existens städtischer Rechte voraussetst, so wurde
jedenfalls doch der Boden für eine Stadtgründung dadurch
aufs beste vorbereitet. Wie eng der Zusammenhang jener Ein-
richtungen mit dem städtischen Leben war, seigt das Vorkommen
von Personen mit dem Beinamen monetarius und thelonearius
in den Reihen der ältesten Marburger Bürger und Schöffen* 1 2 3 4).
Daß die Entstehung der Stadt auf einem Gründungsakte
beruht und nicht auf ein allmähliches Anwachsen um den vor-
handenen Kern, die Kilianskapelle, zurückzufUhren ist, lehrt
der Stadtplan, der eine Hauptverkehrsader mit dem Marktplatz
in der Mitte, eine neue, noch in romanischen Stilformen errichtete
Pfarrkirche ?) auf dem höchsten Punkte unter der Burg und
zwei Mauerlinien aufweist, die sich radienartig von der Burg
abzweigen und Burg und Stadt zu einer einzigen Befestigung,
zu einem „Schlosse“ f, vereinigen.
So gehört Marburg in die Reihe jener Städte, die wie Kassel,
Wolfhagen, Gudensberg, Melsungen, Witzenhausen, Homberg in
Niederhessen, Alsfeld, Grimberg und Frankenberg in Oberhessen
offenbar nach einem einheitlichen Plane von den Landgrafen von
Thüringen als wichtigste militärische und finanzielle Faktoren
zur Sicherung ihres Besitzes und als Mittelpunkte der neuen
Verwaltungs- und Gerichtsbezirke nach dem Verfall der alten
Verfassung gegen Ende des 12. und Beginn des 13. Jahrhunderts
gegründet wurden5). Als frühester Verwaltungsbeamter des
Amtes Marburg begegnet uns im Jahre 1214 der villicus Bruno,
der zusammen mit dem zur familia des Landgrafen gehörigen
Priester Werner von Marburg einem Gnadenakte des Landgrafen
Hermann für das Kloster Aulisburg (Haina) in Marburg selbst
beiwohnte6). Vermutlich ist Marburg damals bereits Stadt ge-
wesen.
hunderts und die Formen des Westportals können nicht wesentlich früher als
die Reste der Pfarrkirche, die in dem Aufsatze „Die älteste Pfarrkirche
Marburgs“ (Hessenkunst 1912 S. 1 ff.) beschrieben sind, an gesetzt werden. Wohl
aber ist die Annahme erlaubt, daß eine ältere Kapelle hier vorhanden war,
die also nach der Stadtgründung gleichzeitig mit dem Bau der Pfarrkirche
einen Umbau erfahren hätte. Die Pfarrkirche der Stadt kann die Kilians-
kapelle, wie in dem genannten Aufsätze ausgeführt ist, nicht gewesen sein.
1) G. Frhr. Schenk zu Schweinsberg, Das Alter der Stadt Marburg.
Archiv d. hist. Vereins f. d. Großh. Hessen 15 S. 701 ff.
2) Hermannus Thelonearius 1236 ff. Wyß I Nr. 56, 75, 84, 88 u. s. f.
Gerardus monetarius de Marpurch 1241, Dep. Haina.
3) Vgl. o. S. 3 Anm. 6.
4) Unter „Schloß“ versteht man bis in das 15. Jahrh. hinein Burg und
Stadt als zusammengehörige Befestigung.
5) Vgl. Küch, Salbiicher S. 147.
6) Dobenecker II 1585, 1719.