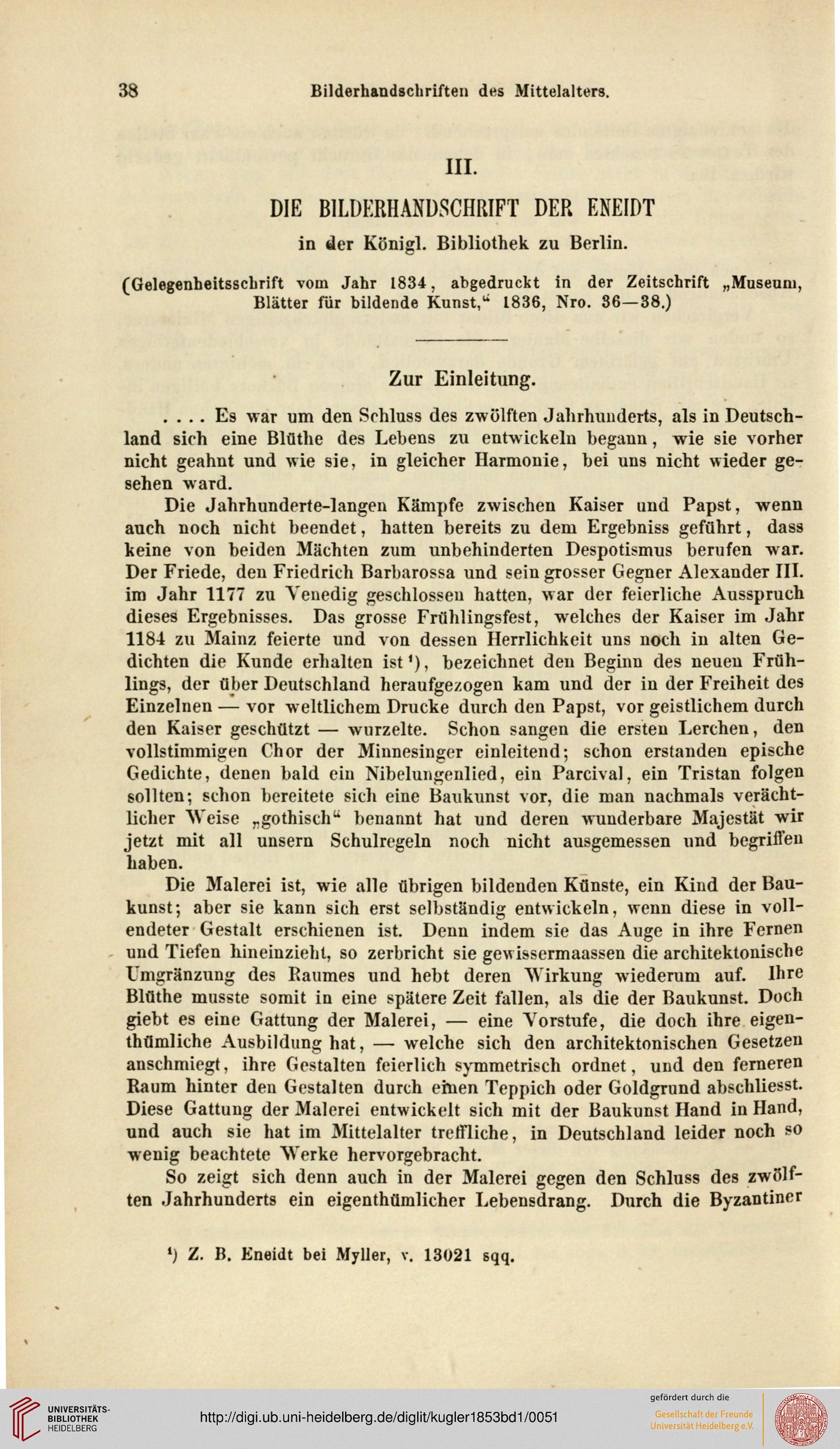38 Bilderhandschriften des Mittelalters.
III.
DIE BILÜERHANDSCHRIFT DER EHEIDT
in der Königl. Bibliothek zu Berlin.
(Gelegenheitsscbrift vom Jahr 1834, abgedruckt in der Zeitschrift „Museuni,
Blätter für bildende Kunst,u 1836, Nro. 36—38.)
Zur Einleitung.
.... Es war um den Sehluss des zwölften Jahrhunderts, als in Deutsch-
land sich eine Blüthe des Lebens zu entwickeln begann, wie sie vorher
nicht geahnt und wie sie, in gleicher Harmonie, bei uns nicht wieder ge-
sehen ward.
Die Jahrhunderte-langen Kämpfe zwischen Kaiser und Papst, wenn
auch noch nicht beendet, hatten bereits zu dem Ergebniss geführt, dass
keine von beiden Machten zum unbehinderten Despotismus berufen war.
Der Friede, den Friedrich Barbarossa und sein grosser Gegner Alexander III.
im Jahr 1177 zu Venedig geschlossen hatten, war der feierliche Ausspruch
dieses Ergebnisses. Das grosse Frühlingsfest, welches der Kaiser im Jahr
1184 zu Mainz feierte und von dessen Herrlichkeit uns noch in alten Ge-
dichten die Kunde erhalten ist'), bezeichnet den Beginn des neuen Früh-
lings, der über Deutschland heraufgezogen kam und der in der Freiheit des
Einzelnen — vor weltlichem Drucke durch den Papst, vor geistlichem durch
den Kaiser geschützt — wurzelte. Schon sangen die ersten Lerchen, den
vollstimmigen Chor der Minnesinger einleitend; schon erstanden epische
Gedichte, denen bald ein Nibelungenlied, ein Parcival, ein Tristan folgen
sollten; schon bereitete sich eine Baukunst vor, die man nachmals verächt-
licher 'Weise „gothischu benannt hat und deren wunderbare Majestät wir
jetzt mit all unsern Schulregeln noch nicht ausgemessen und begriffen
haben.
Die Malerei ist, wie alle übrigen bildenden Künste, ein Kind der Bau-
kunst; aber sie kann sich erst selbständig entwickeln, wenn diese in voll-
endeter Gestalt erschienen ist. Denn indem sie das Auge in ihre Fernen
und Tiefen hineinzieht, so zerbricht sie gewissermaassen die architektonische
Umgränzung des Baumes und hebt deren Wirkung wiederum auf. Ihre
Blüthe musste somit in eine spätere Zeit fallen, als die der Baukunst. Doch
giebt es eine Gattung der Malerei, — eine Vorstufe, die doch ihre eigen-
thümliche Ausbildung hat, — welche sich den architektonischen Gesetzen
anschmiegt, ihre Gestalten feierlich symmetrisch ordnet, und den ferneren
Baum hinter den Gestalten durch ehien Teppich oder Goldgrund abschliesst.
Diese Gattung der Malerei entwickelt sich mit der Baukunst Hand in Hand,
und auch sie hat im Mittelalter treffliche, in Deutschland leider noch so
wenig beachtete Werke hervorgebracht.
So zeigt sich denn auch in der Malerei gegen den Schluss des zwölf-
ten Jahrhunderts ein eigentümlicher Lebensdrang. Durch die Byzantiner
') Z. B. Eneidt bei Myller, v. 13021 sqq.
III.
DIE BILÜERHANDSCHRIFT DER EHEIDT
in der Königl. Bibliothek zu Berlin.
(Gelegenheitsscbrift vom Jahr 1834, abgedruckt in der Zeitschrift „Museuni,
Blätter für bildende Kunst,u 1836, Nro. 36—38.)
Zur Einleitung.
.... Es war um den Sehluss des zwölften Jahrhunderts, als in Deutsch-
land sich eine Blüthe des Lebens zu entwickeln begann, wie sie vorher
nicht geahnt und wie sie, in gleicher Harmonie, bei uns nicht wieder ge-
sehen ward.
Die Jahrhunderte-langen Kämpfe zwischen Kaiser und Papst, wenn
auch noch nicht beendet, hatten bereits zu dem Ergebniss geführt, dass
keine von beiden Machten zum unbehinderten Despotismus berufen war.
Der Friede, den Friedrich Barbarossa und sein grosser Gegner Alexander III.
im Jahr 1177 zu Venedig geschlossen hatten, war der feierliche Ausspruch
dieses Ergebnisses. Das grosse Frühlingsfest, welches der Kaiser im Jahr
1184 zu Mainz feierte und von dessen Herrlichkeit uns noch in alten Ge-
dichten die Kunde erhalten ist'), bezeichnet den Beginn des neuen Früh-
lings, der über Deutschland heraufgezogen kam und der in der Freiheit des
Einzelnen — vor weltlichem Drucke durch den Papst, vor geistlichem durch
den Kaiser geschützt — wurzelte. Schon sangen die ersten Lerchen, den
vollstimmigen Chor der Minnesinger einleitend; schon erstanden epische
Gedichte, denen bald ein Nibelungenlied, ein Parcival, ein Tristan folgen
sollten; schon bereitete sich eine Baukunst vor, die man nachmals verächt-
licher 'Weise „gothischu benannt hat und deren wunderbare Majestät wir
jetzt mit all unsern Schulregeln noch nicht ausgemessen und begriffen
haben.
Die Malerei ist, wie alle übrigen bildenden Künste, ein Kind der Bau-
kunst; aber sie kann sich erst selbständig entwickeln, wenn diese in voll-
endeter Gestalt erschienen ist. Denn indem sie das Auge in ihre Fernen
und Tiefen hineinzieht, so zerbricht sie gewissermaassen die architektonische
Umgränzung des Baumes und hebt deren Wirkung wiederum auf. Ihre
Blüthe musste somit in eine spätere Zeit fallen, als die der Baukunst. Doch
giebt es eine Gattung der Malerei, — eine Vorstufe, die doch ihre eigen-
thümliche Ausbildung hat, — welche sich den architektonischen Gesetzen
anschmiegt, ihre Gestalten feierlich symmetrisch ordnet, und den ferneren
Baum hinter den Gestalten durch ehien Teppich oder Goldgrund abschliesst.
Diese Gattung der Malerei entwickelt sich mit der Baukunst Hand in Hand,
und auch sie hat im Mittelalter treffliche, in Deutschland leider noch so
wenig beachtete Werke hervorgebracht.
So zeigt sich denn auch in der Malerei gegen den Schluss des zwölf-
ten Jahrhunderts ein eigentümlicher Lebensdrang. Durch die Byzantiner
') Z. B. Eneidt bei Myller, v. 13021 sqq.