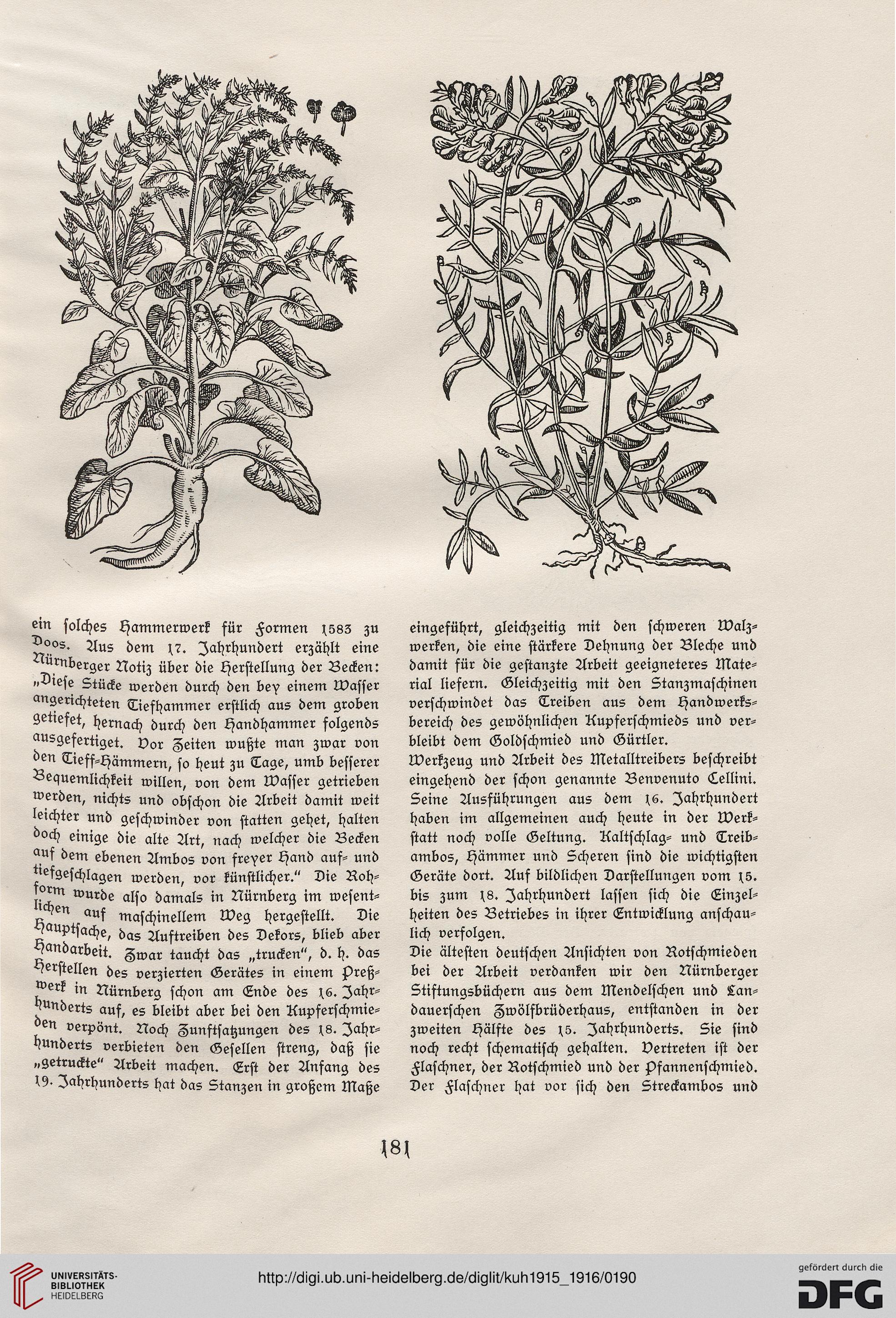ein solches Hammerwerk für formen ^583 zu
Doos. Aus dem \7. Jahrhundert erzählt eine
Nürnberger Notiz über die Herstellung der Becken:
»Diese Stücke werden durch den be^ einem Wasser
angerichteten Tiefhammer erstlich aus dem groben
getiefet, hernach durch den Handhammer folgends
ausgefertiget. vor Zeiten wußte man zwar von
den Tieff-Hämmern, so heut zu Tage, umb besserer
Bequemlichkeit willen, von dem Wasser getrieben
werden, nichts und obschon die Arbeit damit weit
leichter und geschwinder von statten gehet, halten
doch einige die alte Art, nach welcher die Becken
auf dem ebenen Ambos von freier Hand auf- und
tiefgeschl^gen werden, vor künstlicher." Die Roh-
sorm wurde also damals in Nürnberg im wesent-
lichen auf maschinellem weg hergestellt. Die
Hauptsache, das Auftreiben des Dekors, blieb aber
Handarbeit. Zwar taucht das „trucken", d. h. das
Herstellen des verzierten Gerätes in einem preß-
^erk in Nürnberg schon am Ende des \6. Jahr-
hunderts auf, es bleibt aber bei den Kupferschmie-
den verpönt. Noch Zunftsatzungen des J8. Jahr-
hunderts verbieten den Gesellen streng, daß sie
„getruckte" Arbeit machen. Erst der Anfang des
Jahrhunderts hat das Stanzen in großem Maße
eingeführt, gleichzeitig mit den schweren Walz-
werken, die eine stärkere Dehnung der Bleche und
damit für die gestanzte Arbeit geeigneteres Mate-
rial liefern. Gleichzeitig mit den Stanzmaschinen
verschwindet das Treiben aus dem Handwerks-
bereich des gewöhnlichen Kupferschmieds und ver-
bleibt dem Goldschmied und Gürtler.
Werkzeug und Arbeit des Metalltreibers beschreibt
eingehend der schon genannte Benvenuto Lellini.
Seine Ausführungen aus dem *6. Jahrhundert
haben im allgemeinen auch heute in der Werk-
statt noch volle Geltung. Kaltschlag- und Treib-
ambos, Hämmer und Scheren sind die wichtigsten
Geräte dort. Auf bildlichen Darstellungen vom ^5.
bis zum Jahrhundert lassen sich die Einzel-
heiten des Betriebes in ihrer Entwicklung anschau-
lich verfolgen.
Die ältesten deutschen Ansichten von Rotschmieden
bei der Arbeit verdanken wir den Nürnberger
Stiftungsbüchern aus dem Mendelschen und Lan-
dauerschen Zwölfbrüderhaus, entstanden in der
zweiten Hälfte des *5. Jahrhunderts. Sie sind
noch recht schematisch gehalten. Vertreten ist der
Flaschner, der Rotschmied und der Hfannenschmied.
Der Flaschner hat vor sich den Streckambos und
m
Doos. Aus dem \7. Jahrhundert erzählt eine
Nürnberger Notiz über die Herstellung der Becken:
»Diese Stücke werden durch den be^ einem Wasser
angerichteten Tiefhammer erstlich aus dem groben
getiefet, hernach durch den Handhammer folgends
ausgefertiget. vor Zeiten wußte man zwar von
den Tieff-Hämmern, so heut zu Tage, umb besserer
Bequemlichkeit willen, von dem Wasser getrieben
werden, nichts und obschon die Arbeit damit weit
leichter und geschwinder von statten gehet, halten
doch einige die alte Art, nach welcher die Becken
auf dem ebenen Ambos von freier Hand auf- und
tiefgeschl^gen werden, vor künstlicher." Die Roh-
sorm wurde also damals in Nürnberg im wesent-
lichen auf maschinellem weg hergestellt. Die
Hauptsache, das Auftreiben des Dekors, blieb aber
Handarbeit. Zwar taucht das „trucken", d. h. das
Herstellen des verzierten Gerätes in einem preß-
^erk in Nürnberg schon am Ende des \6. Jahr-
hunderts auf, es bleibt aber bei den Kupferschmie-
den verpönt. Noch Zunftsatzungen des J8. Jahr-
hunderts verbieten den Gesellen streng, daß sie
„getruckte" Arbeit machen. Erst der Anfang des
Jahrhunderts hat das Stanzen in großem Maße
eingeführt, gleichzeitig mit den schweren Walz-
werken, die eine stärkere Dehnung der Bleche und
damit für die gestanzte Arbeit geeigneteres Mate-
rial liefern. Gleichzeitig mit den Stanzmaschinen
verschwindet das Treiben aus dem Handwerks-
bereich des gewöhnlichen Kupferschmieds und ver-
bleibt dem Goldschmied und Gürtler.
Werkzeug und Arbeit des Metalltreibers beschreibt
eingehend der schon genannte Benvenuto Lellini.
Seine Ausführungen aus dem *6. Jahrhundert
haben im allgemeinen auch heute in der Werk-
statt noch volle Geltung. Kaltschlag- und Treib-
ambos, Hämmer und Scheren sind die wichtigsten
Geräte dort. Auf bildlichen Darstellungen vom ^5.
bis zum Jahrhundert lassen sich die Einzel-
heiten des Betriebes in ihrer Entwicklung anschau-
lich verfolgen.
Die ältesten deutschen Ansichten von Rotschmieden
bei der Arbeit verdanken wir den Nürnberger
Stiftungsbüchern aus dem Mendelschen und Lan-
dauerschen Zwölfbrüderhaus, entstanden in der
zweiten Hälfte des *5. Jahrhunderts. Sie sind
noch recht schematisch gehalten. Vertreten ist der
Flaschner, der Rotschmied und der Hfannenschmied.
Der Flaschner hat vor sich den Streckambos und
m