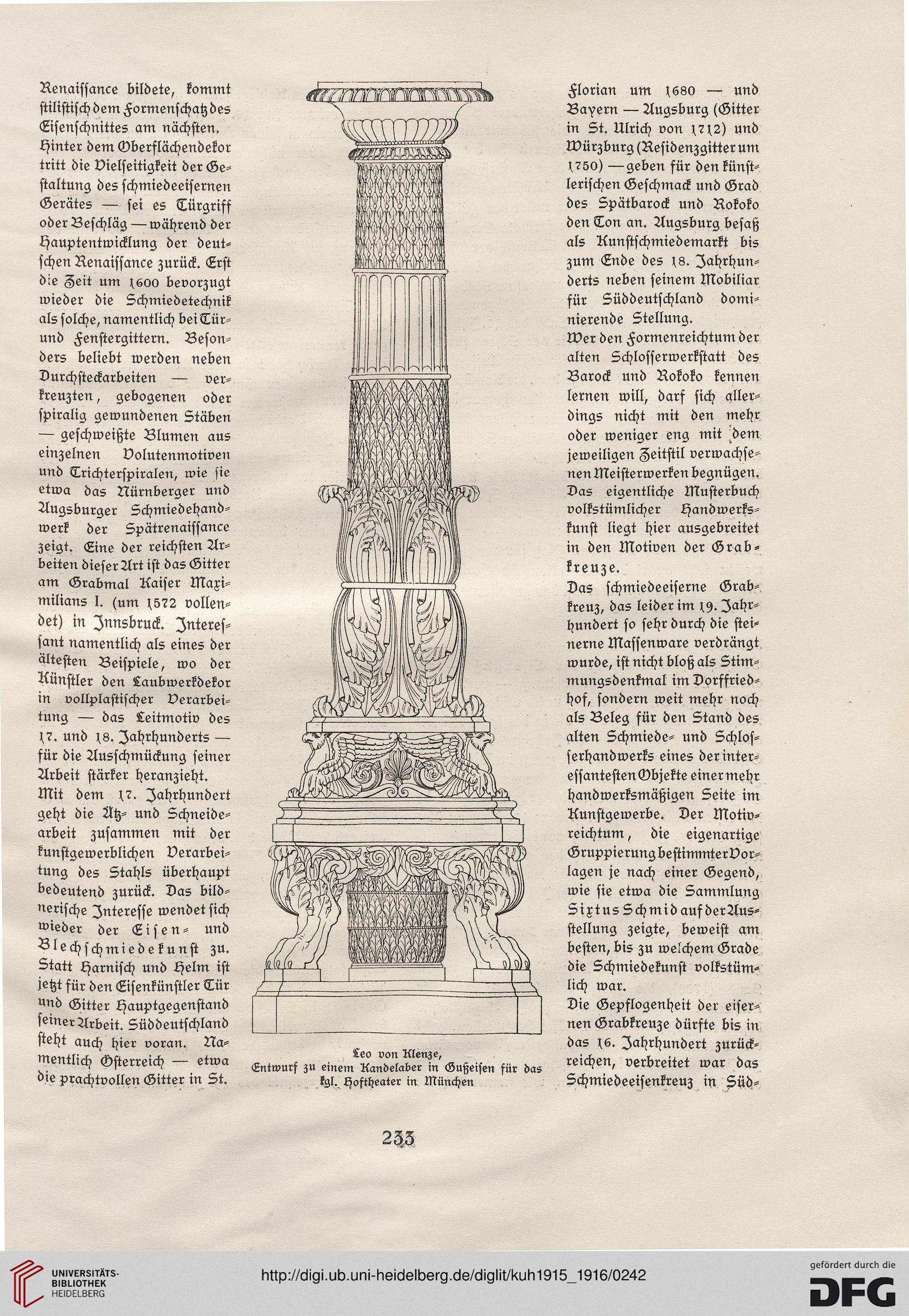Renaissance bildete, kommt
stilistisch dem Formenschatz des
Eisenschnittes am nächsten,
hinter dem Gberflächendekor
tritt die Vielseitigkeit der Ge-
staltung des schmiedeeisernen
Gerätes — sei es Türgriff
oder Beschläg — während der
Hauptentwicklung der deut-
schen Renaissance zurück. Erst
die Zeit um (öoo bevorzugt
wieder die Schmiedetechnik
als solche, namentlich bei Tür-
und Fenstergittern. Beson-
ders beliebt werden neben
Durchsteckarbeiten — ver-
kreuzten, gebogenen oder
spiralig gewundenen Stäben
— geschweißte Blumen aus
einzelnen Volutenmotiven
und Trichterspiralen, wie sie
etwa das Nürnberger und
Augsburger Schmiedehand-
werk der Spätrenaissance
zeigt. Eine der reichsten Ar-
beiten dieser Art ist das Gitter
am Grabmal Kaiser Maxi-
milians l. (um (572 vollen-
det) in Innsbruck. Interes-
sant namentlich als eines der
ältesten Beispiele, wo der
Aünstler den Laubwerkdekor
in vollplastischer Verarbei-
tung — das Leitmotiv des
(7. und (8. Jahrhunderts —
für die Ausschmückung seiner
Arbeit stärker heranzieht.
Mit dem (7. Jahrhundert
geht die Atz- und Schneide-
arbeit zusammen mit der
kunstgewerblichen Verarbei-
tung des Stahls überhaupt
bedeutend zurück. Das bild-
nerische Interesse wendet sich
wieder der Lisen- und
Blechsch-miedekunst zu.
Statt Harnisch und Helm ist
jetzt für den Eisenkünstler Tür
und Gitter Hauptgegenstand
seiner Arbeit. Süddeutschland
steht auch hier voran. Na-
mentlich Österreich — etwa
bie prachtvollen Gitter in St.
Leo von Klenze,
Entwurf zu einem Kandelaber in Gußeisen für das
kgl. kfoftheater in. München
Florian um (680 — und
Bayern — Augsburg (Gitter
in St. Ulrich von (7(2) und
Würzburg (Residenzgitter uni
(750) —geben für den künst-
lerischen Geschmack und Grad
des Spätbarock und Rokoko
den Ton an. Augsburg besaß
als Kunstschmiedemarkt bis
zum Ende des (8. Jahrhun-
derts neben seinem Mobiliar
für Süddeutschland domi-
nierende Stellung,
wer den Formenreichtum der
alten Schlosserwerkstatt des
Barock und Rokoko kennen
lernen will, darf sich aller-
dings nicht mit den mehr
oder weniger eng mit chem
jeweiligen Jeitstil verwachse-
nen Meisterwerken begnügen.
Das eigentliche Musterbuch
volkstümlicher Handwerks-
kunst liegt hier ausgebreitet
in den Motiven der Grab-
kreuze.
Das schmiedeeiserne Grab-
kreuz, das leider im (y. Jahr-
hundert so sehr durch die stei-
nerne Massenware verdrängt
wurde, ist nicht bloß als Stim-
mungsdenkmal im Dorffried-
hof, sondern weit mehr noch
als Beleg für den Stand des
alten Schmiede- und Schlos-
serhandwerks eines der inter-
essantesten Objekte einer mehr
handwerksmäßigen Seite im
Kunstgewerbe. Der Motiv-
reichtum , die eigenartige
Gruppierung bestimmtervor-
lagen je nach einer Gegend,
wie sie etwa die Sammlung
Sixtus SchmidaufderAus-
stellung zeigte, beweist am
besten, bis zu welchem Grade
die Schmiedekunst volkstüm-
lich war.
Die Gepflogenheit der eiser-
nen Grabkreuze dürfte bis in
das (6. Jahrhundert zurück-
reichen, verbreitet war das
Schmiedeeisenkreuz in Süd-
stilistisch dem Formenschatz des
Eisenschnittes am nächsten,
hinter dem Gberflächendekor
tritt die Vielseitigkeit der Ge-
staltung des schmiedeeisernen
Gerätes — sei es Türgriff
oder Beschläg — während der
Hauptentwicklung der deut-
schen Renaissance zurück. Erst
die Zeit um (öoo bevorzugt
wieder die Schmiedetechnik
als solche, namentlich bei Tür-
und Fenstergittern. Beson-
ders beliebt werden neben
Durchsteckarbeiten — ver-
kreuzten, gebogenen oder
spiralig gewundenen Stäben
— geschweißte Blumen aus
einzelnen Volutenmotiven
und Trichterspiralen, wie sie
etwa das Nürnberger und
Augsburger Schmiedehand-
werk der Spätrenaissance
zeigt. Eine der reichsten Ar-
beiten dieser Art ist das Gitter
am Grabmal Kaiser Maxi-
milians l. (um (572 vollen-
det) in Innsbruck. Interes-
sant namentlich als eines der
ältesten Beispiele, wo der
Aünstler den Laubwerkdekor
in vollplastischer Verarbei-
tung — das Leitmotiv des
(7. und (8. Jahrhunderts —
für die Ausschmückung seiner
Arbeit stärker heranzieht.
Mit dem (7. Jahrhundert
geht die Atz- und Schneide-
arbeit zusammen mit der
kunstgewerblichen Verarbei-
tung des Stahls überhaupt
bedeutend zurück. Das bild-
nerische Interesse wendet sich
wieder der Lisen- und
Blechsch-miedekunst zu.
Statt Harnisch und Helm ist
jetzt für den Eisenkünstler Tür
und Gitter Hauptgegenstand
seiner Arbeit. Süddeutschland
steht auch hier voran. Na-
mentlich Österreich — etwa
bie prachtvollen Gitter in St.
Leo von Klenze,
Entwurf zu einem Kandelaber in Gußeisen für das
kgl. kfoftheater in. München
Florian um (680 — und
Bayern — Augsburg (Gitter
in St. Ulrich von (7(2) und
Würzburg (Residenzgitter uni
(750) —geben für den künst-
lerischen Geschmack und Grad
des Spätbarock und Rokoko
den Ton an. Augsburg besaß
als Kunstschmiedemarkt bis
zum Ende des (8. Jahrhun-
derts neben seinem Mobiliar
für Süddeutschland domi-
nierende Stellung,
wer den Formenreichtum der
alten Schlosserwerkstatt des
Barock und Rokoko kennen
lernen will, darf sich aller-
dings nicht mit den mehr
oder weniger eng mit chem
jeweiligen Jeitstil verwachse-
nen Meisterwerken begnügen.
Das eigentliche Musterbuch
volkstümlicher Handwerks-
kunst liegt hier ausgebreitet
in den Motiven der Grab-
kreuze.
Das schmiedeeiserne Grab-
kreuz, das leider im (y. Jahr-
hundert so sehr durch die stei-
nerne Massenware verdrängt
wurde, ist nicht bloß als Stim-
mungsdenkmal im Dorffried-
hof, sondern weit mehr noch
als Beleg für den Stand des
alten Schmiede- und Schlos-
serhandwerks eines der inter-
essantesten Objekte einer mehr
handwerksmäßigen Seite im
Kunstgewerbe. Der Motiv-
reichtum , die eigenartige
Gruppierung bestimmtervor-
lagen je nach einer Gegend,
wie sie etwa die Sammlung
Sixtus SchmidaufderAus-
stellung zeigte, beweist am
besten, bis zu welchem Grade
die Schmiedekunst volkstüm-
lich war.
Die Gepflogenheit der eiser-
nen Grabkreuze dürfte bis in
das (6. Jahrhundert zurück-
reichen, verbreitet war das
Schmiedeeisenkreuz in Süd-