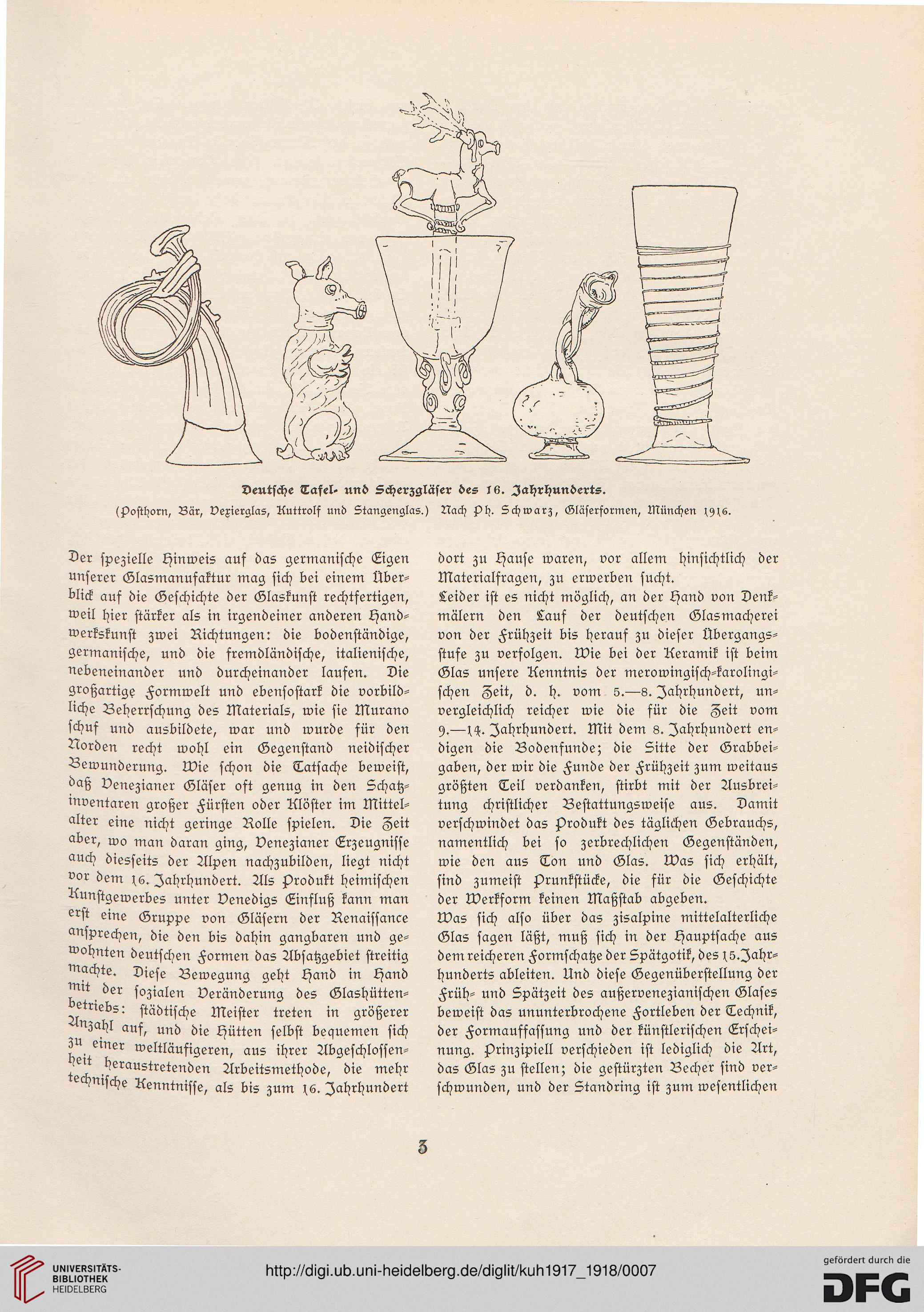Deutsche Tafel- und Scherzgläser -es 7 6. Jahrhunderts.
(Posthorn, Bär, vexierglas, Auttrolf und Stangenglas.) Nach PH. Schwarz, Gläserformen, München (9(6.
Der spezielle Hinweis auf das germanische Ligen
unserer Glasmanufaktur mag sich bei einem Über-
blick auf die Geschichte der Glaskunst rechtfertigen,
weil hier stärker als in irgendeiner anderen Hand-
werkskunst zwei Richtungen: die bodenständige,
germanische, und die fremdländische, italienische,
nebeneinander und durcheinander laufen. Die
großartig? Formwelt und ebensostark die vorbild-
liche Beherrschung des Materials, wie sie Murano
schuf und ausbildete, war und wurde für den
Norden recht wohl ein Gegenstand neidischer
Bewunderung. wie schon die Tatsache beweist,
daß Venezianer Gläser oft genug in den Schatz-
inventaren großer Fürsten oder Klöster im Mittel-
alter eine nicht geringe Rolle spielen. Die Zeit
aber, wo man daran ging, Venezianer Erzeugnisse
auch diesseits der Alpen nachzubilden, liegt nicht
vor dem (6. Jahrhundert. Als Produkt heimischen
Nunstgewerbes unter Venedigs Einfluß kann man
erst eine Gruppe von Gläsern der Renaissance
ansprechen, die den bis dahin gangbaren und ge-
wohnten deutschen formen das Absatzgebiet streitig
wachte. Diese Bewegung geht Hand in Hand
Mit der sozialen Veränderung des Glashütten-
betriebs: städtische Meister treten in größerer
Anzahl auf, und die Hütten selbst bequemen sich
Zu einer weitläufigeren, aus ihrer Abgeschlossen-
heit heraustretenden Arbeitsmethode, die mehr
technische Kenntnisse, als bis zum (6. Jahrhundert
dort zu Hause waren, vor allem hinsichtlich der
Materialfragen, zu erwerben sucht.
Leider ist es nicht möglich, an der Hand von Denk-
mälern den Lauf der deutschen Glasmacherei
von der Frühzeit bis herauf zu dieser Ubergangs-
ftufe zu verfolgen, wie bei der Keramik ist beim
Glas unsere Kenntnis der merowingisch-karolingi-
schen Zeit, d. h. vom 5.—8. Jahrhundert, un-
vergleichlich reicher wie die für die Zeit vom
9.—Jahrhundert. Mit dem 8. Jahrhundert en-
digen die Bodenfunde; die Sitte der Grabbei-
gaben, der wir die Funde der Frühzeit zum weitaus
größten Teil verdanken, stirbt mit der Ausbrei-
tung christlicher Bestattungsweise aus. Damit
verschwindet das Produkt des täglichen Gebrauchs,
namentlich bei so zerbrechlichen Gegenständen,
wie den aus Ton und Glas, was sich erhält,
sind zumeist Prunkstücke, die für die Geschichte
der werkform keinen Maßstab abgeben,
was sich also über das zisalpine mittelalterliche
Glas sagen läßt, muß sich in der Hauptsache aus
dem reicheren Formschatze der Spätgotik, des (S.Iahr-
hunderts ableiten. Und diese Gegenüberstellung der
Früh- und Spätzeit des außervenezianischen Glases
beweist das ununterbrochene Fortleben der Technik,
der Formauffassung und der künstlerischen Erschei-
nung. Prinzipiell verschieden ist lediglich die Art,
das Glas zu stellen; die gestürzten Becher sind ver-
schwunden, und der Standring ist zum wesentlichen
3
(Posthorn, Bär, vexierglas, Auttrolf und Stangenglas.) Nach PH. Schwarz, Gläserformen, München (9(6.
Der spezielle Hinweis auf das germanische Ligen
unserer Glasmanufaktur mag sich bei einem Über-
blick auf die Geschichte der Glaskunst rechtfertigen,
weil hier stärker als in irgendeiner anderen Hand-
werkskunst zwei Richtungen: die bodenständige,
germanische, und die fremdländische, italienische,
nebeneinander und durcheinander laufen. Die
großartig? Formwelt und ebensostark die vorbild-
liche Beherrschung des Materials, wie sie Murano
schuf und ausbildete, war und wurde für den
Norden recht wohl ein Gegenstand neidischer
Bewunderung. wie schon die Tatsache beweist,
daß Venezianer Gläser oft genug in den Schatz-
inventaren großer Fürsten oder Klöster im Mittel-
alter eine nicht geringe Rolle spielen. Die Zeit
aber, wo man daran ging, Venezianer Erzeugnisse
auch diesseits der Alpen nachzubilden, liegt nicht
vor dem (6. Jahrhundert. Als Produkt heimischen
Nunstgewerbes unter Venedigs Einfluß kann man
erst eine Gruppe von Gläsern der Renaissance
ansprechen, die den bis dahin gangbaren und ge-
wohnten deutschen formen das Absatzgebiet streitig
wachte. Diese Bewegung geht Hand in Hand
Mit der sozialen Veränderung des Glashütten-
betriebs: städtische Meister treten in größerer
Anzahl auf, und die Hütten selbst bequemen sich
Zu einer weitläufigeren, aus ihrer Abgeschlossen-
heit heraustretenden Arbeitsmethode, die mehr
technische Kenntnisse, als bis zum (6. Jahrhundert
dort zu Hause waren, vor allem hinsichtlich der
Materialfragen, zu erwerben sucht.
Leider ist es nicht möglich, an der Hand von Denk-
mälern den Lauf der deutschen Glasmacherei
von der Frühzeit bis herauf zu dieser Ubergangs-
ftufe zu verfolgen, wie bei der Keramik ist beim
Glas unsere Kenntnis der merowingisch-karolingi-
schen Zeit, d. h. vom 5.—8. Jahrhundert, un-
vergleichlich reicher wie die für die Zeit vom
9.—Jahrhundert. Mit dem 8. Jahrhundert en-
digen die Bodenfunde; die Sitte der Grabbei-
gaben, der wir die Funde der Frühzeit zum weitaus
größten Teil verdanken, stirbt mit der Ausbrei-
tung christlicher Bestattungsweise aus. Damit
verschwindet das Produkt des täglichen Gebrauchs,
namentlich bei so zerbrechlichen Gegenständen,
wie den aus Ton und Glas, was sich erhält,
sind zumeist Prunkstücke, die für die Geschichte
der werkform keinen Maßstab abgeben,
was sich also über das zisalpine mittelalterliche
Glas sagen läßt, muß sich in der Hauptsache aus
dem reicheren Formschatze der Spätgotik, des (S.Iahr-
hunderts ableiten. Und diese Gegenüberstellung der
Früh- und Spätzeit des außervenezianischen Glases
beweist das ununterbrochene Fortleben der Technik,
der Formauffassung und der künstlerischen Erschei-
nung. Prinzipiell verschieden ist lediglich die Art,
das Glas zu stellen; die gestürzten Becher sind ver-
schwunden, und der Standring ist zum wesentlichen
3