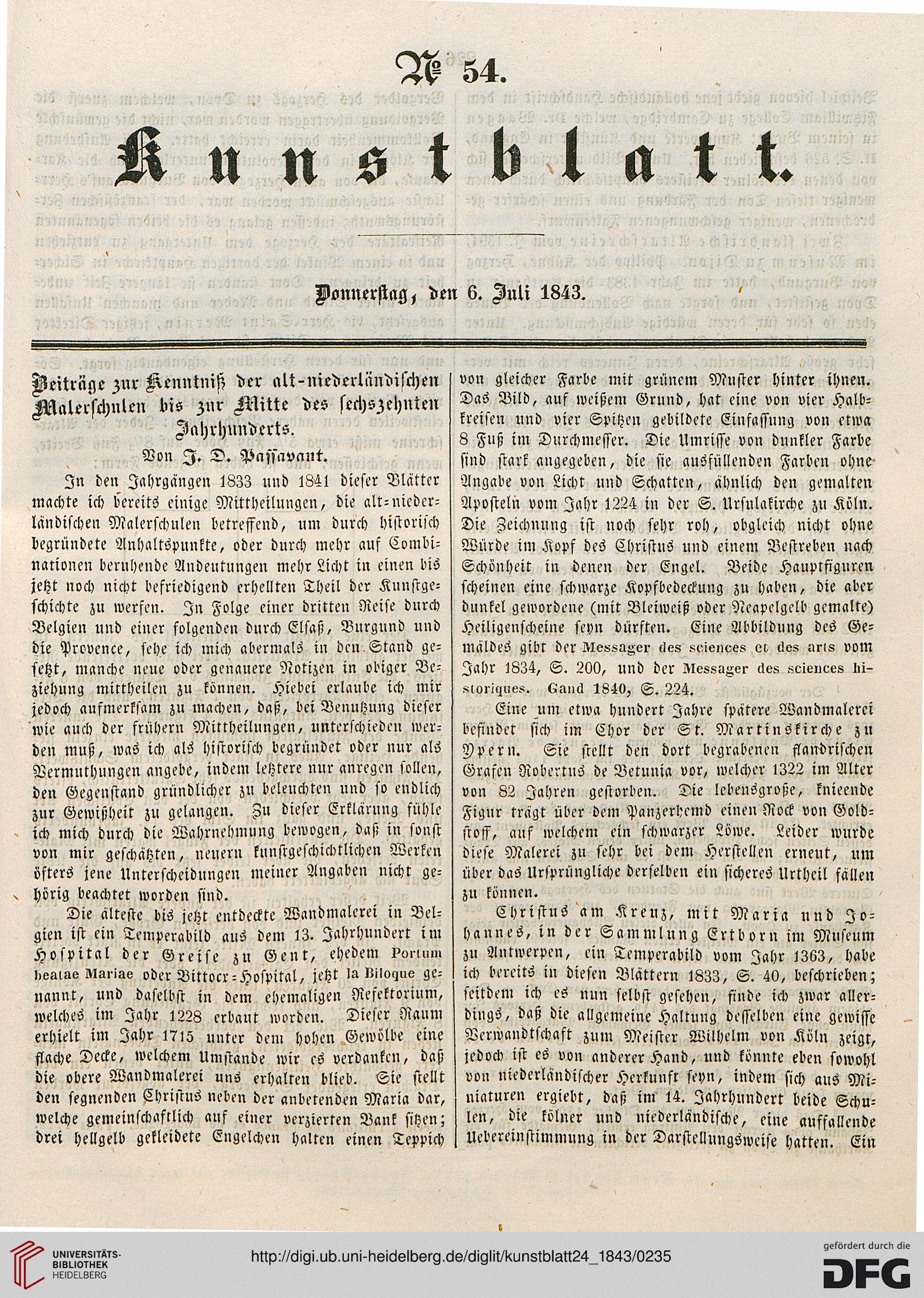Kunstblatt.
Donnerstag, den 6. Inli 1843.
Beiträge zur Kenntnist der att-nicdertändifchen
Malerfchnlen bis zur Mitte des sechszehnten
Jahrhunderts.
Von I. D. Paffavant.
In den Jahrgängen 1833 und 1841 dieser Blätter
machte ich bereits einige Mittheilungen, die alt-nieder-
ländischen Malerschulen betreffend, um durch historisch
begründete Anhaltspunkte, oder durch mehr auf Combi-
Nationen beruhende Andeutungen mehr Licht in einen bis
jetzt noch nicht befriedigend erhellten Theil der Kunstge-
schichte zu werfen. In Folge einer dritten Reise durch
Belgien und einer folgenden durch Elsaß, Burgund und
die Provence, sehe ich mich abermals in den Stand ge-
setzt, manche neue oder genauere Notizen in obiger Be-
ziehung mittheilen zu können. Hiebei erlaube ich mir
jedoch aufmerksam zu machen, daß, bei Benutzung dieser
wie auch der früher» Mittheilungen, unterschieden wer-
den muß, was ich als historisch begründet oder nur als
Vermuthungen angebe, indem letztere nur anregen sollen,
den Gegenstand gründlicher zu beleuchten und so endlich
zur Gewißheit zu gelangen. Zu dieser Erklärung fühle
ich mich durch die Wahrnehmung bewogen, daß in sonst
von mir geschätzten, neuern kunstgeschiclitlichen Werken
öfters jene Unterscheidungen meiner Angaben nicht ge-
hörig beachtet worden sind.
Die älteste bis jetzt entdeckte Wandmalerei in Bel-
gien ist ein Temperabild aus dem 13. Jahrhundert im
Hospital der Greise zu Gent, ehedem kor»»»
Iieucae Mariae oder Bittocr-Hospital, jetzt In Biloque ge-
nannt, und daselbst in dem ehemaligen Refektorium,
welches im Jahr 1228 erbaut worden. Dieser Raum
erhielt im Jahr 1715 unter dem hohen Gewölbe eine
flache Decke, welchem Umstande wir es verdanken, daß
die obere Wandmalerei uns erhalten blieb. Sie stellt
den segnenden Christus neben der anbetenden Maria dar,
welche gemeinschaftlich auf einer verzierten Bank sitzen;
drei hellgelb gekleidete Engelchen halten einen Teppich
von gleicher Farbe mit grünem Muster hinter ihnen.
Das Bild, auf weißem Grund, hat eine von vier Halb-
kreisen und vier Spitzen gebildete Einfassung von etwa
8 Fnß im Durchmesser. Die Umrisse von dunkler Farbe
sind stark angegeben, die sie ausfüllenden Farben ohne
Angabe von Licht und Schatten, ähnlich den gemalten
Aposteln vom Jahr 1224 in der S. Ursulakirche zu Köln.
Die Zeichnung ist noch sehr roh, obgleich nicht ohne
Würde im Kopf des Christus und einem Bestreben nach
Schönheit in denen der Engel. Beide Hauptfiguren
scheinen eine schwarze Kopfbedeckung zu haben, die aber
dunkel gewordene (mit Bleiweiß oder Neapelgelb gemalte)
Heiligenscheine seyn dürften. Eine Abbildung des Ge-
mäldes gibt der Messager des Sciences cd des arts vom
Jahr 1834, S. 200, und der Messager des Sciences lii-
sioriques. Gand 1840, S. 224.
Eine um etwa hundert Jahre spätere Wandmalerei
befindet sich im Chor der St. Martinskirche zu
Upern. Sie stellt den dort begrabenen flandrischen
Grafen Robcrtus de Vetunia vor, welcher 1322 im Alter
von 82 Jahren gestorben. Die lebensgroße, knieende
Figur trägt über dem Panzerhemd einen Rock von Gold-
stoff, auf welchem ein schwarzer Löwe. Leider wurde
diese Malerei zu sehr bei dem Herstellen erneut, um
über das Ursprüngliche derselben ein sicheres Urthcil fällen
zu können.
Christus am Kreuz, mit Maria und Jo-
hannes, in der Sammlung Ertborn im Museum
zu Antwerpen, ein Temperabild vom Jahr 1363, habe
ich bereits in diesen Blättern 1833, S. 40, beschrieben;
seitdem ich es nun selbst gesehen, finde ic» zwar aller-
dings, daß die allgemeine Haltung desselben eine gewisse
Verwandtschaft zum Meister Wilhelm von Köln zeigt,
jedoch ist es von anderer Hand, und könnte eben sowohl
von niederländischer Herkunft seyn, indem sich aus Mi-
niaturen erzieht, daß im 14. Jahrhundert beide Schu-
len, die kölner und niederländische, eine auffallende
Uebereinstj,nmung in der Darstellungsweise hatten. Ein
Donnerstag, den 6. Inli 1843.
Beiträge zur Kenntnist der att-nicdertändifchen
Malerfchnlen bis zur Mitte des sechszehnten
Jahrhunderts.
Von I. D. Paffavant.
In den Jahrgängen 1833 und 1841 dieser Blätter
machte ich bereits einige Mittheilungen, die alt-nieder-
ländischen Malerschulen betreffend, um durch historisch
begründete Anhaltspunkte, oder durch mehr auf Combi-
Nationen beruhende Andeutungen mehr Licht in einen bis
jetzt noch nicht befriedigend erhellten Theil der Kunstge-
schichte zu werfen. In Folge einer dritten Reise durch
Belgien und einer folgenden durch Elsaß, Burgund und
die Provence, sehe ich mich abermals in den Stand ge-
setzt, manche neue oder genauere Notizen in obiger Be-
ziehung mittheilen zu können. Hiebei erlaube ich mir
jedoch aufmerksam zu machen, daß, bei Benutzung dieser
wie auch der früher» Mittheilungen, unterschieden wer-
den muß, was ich als historisch begründet oder nur als
Vermuthungen angebe, indem letztere nur anregen sollen,
den Gegenstand gründlicher zu beleuchten und so endlich
zur Gewißheit zu gelangen. Zu dieser Erklärung fühle
ich mich durch die Wahrnehmung bewogen, daß in sonst
von mir geschätzten, neuern kunstgeschiclitlichen Werken
öfters jene Unterscheidungen meiner Angaben nicht ge-
hörig beachtet worden sind.
Die älteste bis jetzt entdeckte Wandmalerei in Bel-
gien ist ein Temperabild aus dem 13. Jahrhundert im
Hospital der Greise zu Gent, ehedem kor»»»
Iieucae Mariae oder Bittocr-Hospital, jetzt In Biloque ge-
nannt, und daselbst in dem ehemaligen Refektorium,
welches im Jahr 1228 erbaut worden. Dieser Raum
erhielt im Jahr 1715 unter dem hohen Gewölbe eine
flache Decke, welchem Umstande wir es verdanken, daß
die obere Wandmalerei uns erhalten blieb. Sie stellt
den segnenden Christus neben der anbetenden Maria dar,
welche gemeinschaftlich auf einer verzierten Bank sitzen;
drei hellgelb gekleidete Engelchen halten einen Teppich
von gleicher Farbe mit grünem Muster hinter ihnen.
Das Bild, auf weißem Grund, hat eine von vier Halb-
kreisen und vier Spitzen gebildete Einfassung von etwa
8 Fnß im Durchmesser. Die Umrisse von dunkler Farbe
sind stark angegeben, die sie ausfüllenden Farben ohne
Angabe von Licht und Schatten, ähnlich den gemalten
Aposteln vom Jahr 1224 in der S. Ursulakirche zu Köln.
Die Zeichnung ist noch sehr roh, obgleich nicht ohne
Würde im Kopf des Christus und einem Bestreben nach
Schönheit in denen der Engel. Beide Hauptfiguren
scheinen eine schwarze Kopfbedeckung zu haben, die aber
dunkel gewordene (mit Bleiweiß oder Neapelgelb gemalte)
Heiligenscheine seyn dürften. Eine Abbildung des Ge-
mäldes gibt der Messager des Sciences cd des arts vom
Jahr 1834, S. 200, und der Messager des Sciences lii-
sioriques. Gand 1840, S. 224.
Eine um etwa hundert Jahre spätere Wandmalerei
befindet sich im Chor der St. Martinskirche zu
Upern. Sie stellt den dort begrabenen flandrischen
Grafen Robcrtus de Vetunia vor, welcher 1322 im Alter
von 82 Jahren gestorben. Die lebensgroße, knieende
Figur trägt über dem Panzerhemd einen Rock von Gold-
stoff, auf welchem ein schwarzer Löwe. Leider wurde
diese Malerei zu sehr bei dem Herstellen erneut, um
über das Ursprüngliche derselben ein sicheres Urthcil fällen
zu können.
Christus am Kreuz, mit Maria und Jo-
hannes, in der Sammlung Ertborn im Museum
zu Antwerpen, ein Temperabild vom Jahr 1363, habe
ich bereits in diesen Blättern 1833, S. 40, beschrieben;
seitdem ich es nun selbst gesehen, finde ic» zwar aller-
dings, daß die allgemeine Haltung desselben eine gewisse
Verwandtschaft zum Meister Wilhelm von Köln zeigt,
jedoch ist es von anderer Hand, und könnte eben sowohl
von niederländischer Herkunft seyn, indem sich aus Mi-
niaturen erzieht, daß im 14. Jahrhundert beide Schu-
len, die kölner und niederländische, eine auffallende
Uebereinstj,nmung in der Darstellungsweise hatten. Ein