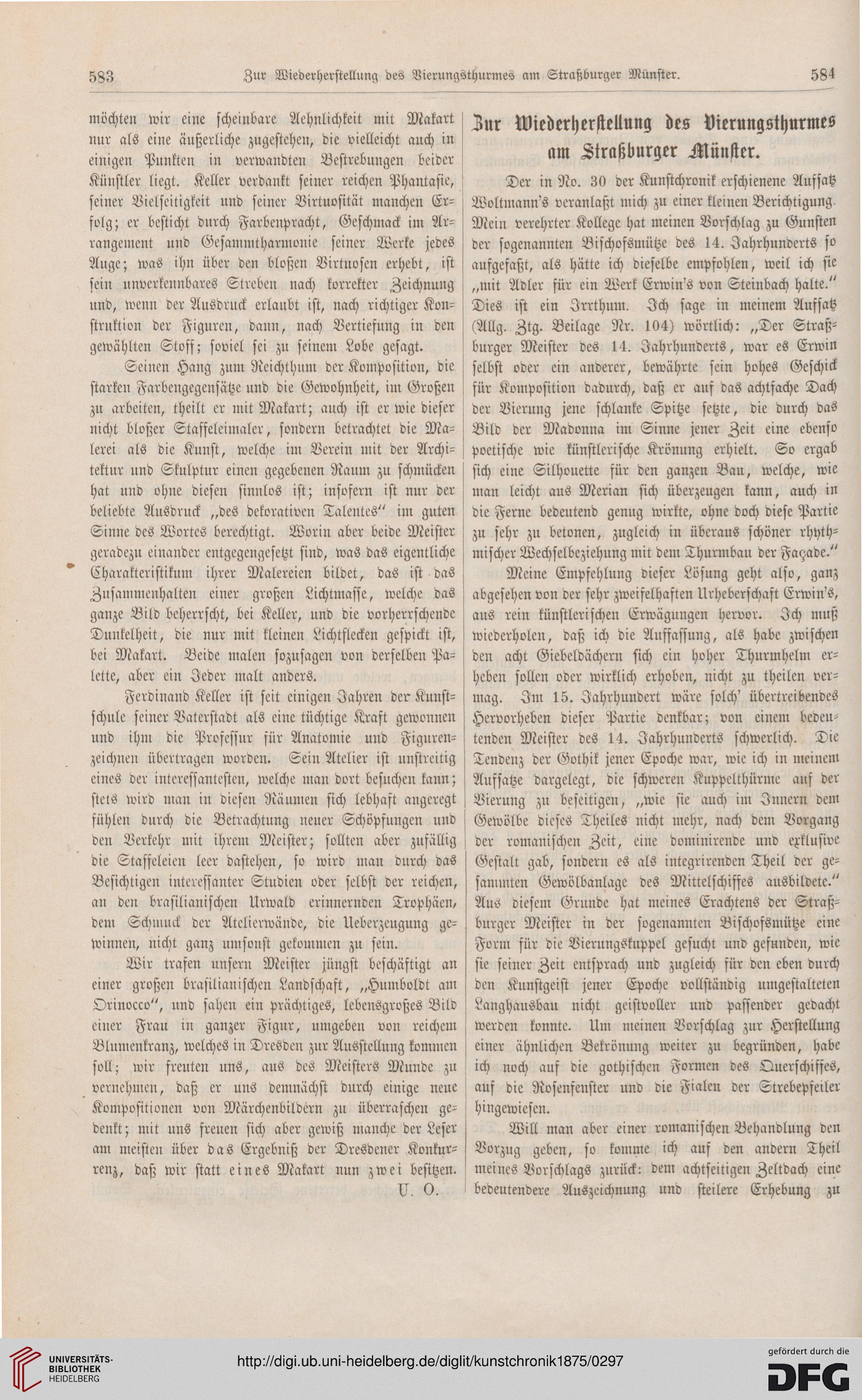583
Zur Wiederherstellunff des Vierungsthurmes am Straßburger Münster.
58<
möchten wir eine scheinbare Aehnlichkeit mit Makart
nur als eine äußerliche zugestehen, die vielleicht auch in
einigen Punkten in verwandten Bestrebungen beider
Künstler liegt. Keller verdankt seiner reichen Phantasie,
seiner Vielseitigkeit und seiner Virtuosität manchen Er-
folg; er besticht durch Farbeupracht, Geschmack im Ar-
rangement und Gesammtharmonie seiner Werke jedes
Auge; was ihn über den bloßen Virtuosen erhebt, ist
sein unverkennbares Strcben nach korrekter Zeichnung
und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nach richtiger Kon-
struktion der Figuren, dann, nach Vertiefung in den
gewählteu Stofs; soviel sei zu seinem Lobe gesagt.
Seinen Hang zum Reichthum der Komposition, die
starken Farbengegensätze und die Gewohnheit, im Großen
zu arbeiten, theilt er mit Makart; auch ist er wie dieser
nicht bloßer Staffeleimaler, sonderu betrachtet die Ma-
lerei als die Kunst, welche im Verein mit der Archi-
tektur uud Skulptur einen gegebenen Raum zu schmücken
hat und ohne diesen sinnlos ist; insofern ist nur der
beliebte Ausdruck „des dekorativen Talentes" im guten
Sinne des Wortes berechtigt. Worin aber beide Meister
geradezu einander entgegengesetzt sind, was das eigentliche
Charakteristikum ihrer Malereien bildet, das ist das
Zusammenhalten einer großen Lichtmasse, welche das
ganze Bild beherrscht, bei Keller, und die vorherrschende
Dunkelheit, die nur mit kleinen Lichtflecken gespickt ist,
bei Makart. Beide malen sozusagen von derselben Pa-
lette, aber ciu Jeder malt anders.
Ferdinand Keller ist seit einigen Jahren der Kunst-
schule seiner Vaterstadt als eine tüchtige Kraft gewonnen
und ihm die Professur sür Anatomie und Figuren-
zeichnen übertragen worden. Sem Atelier ist unstreitig
eines der interessantesten, welche man dort besuchen kann;
stels wird man in diesen Räumen sich lebhaft angcregt
fühlen durch die Betrachtung neuer Schöpfungen und
den Verkehr mit ihrem Meister; sollten aber zufällig
die Staffeleicn leer dastehen, so wird man durch das
Besichtigen interessanter Studien oder selbst der reichen,
an den brasilianischen Urwald erinnernden Trophäen,
dem Schmuck der Atclierwände, die Ueberzeugung ge-
winneu, nicht ganz umsonst gckommen zu sein.
Wir trafen unsern Meister jüngst beschäftigt an
einer großen brasilianischen Landschaft, „Humboldt am
Orinocco", und saheu ein prächtiges, lebensgroßes Bild
einer Frau in ganzer Figur, umgeben von reichcm
Blnmenkranz, welches in Dresden zur Ausstellung kommcn
soll; wir freuten uns, aus des Meisters Munde zu
veruehmen, daß er uns demnächst durch einige neue
Kompofitionen von Märchenbildern zu überrascheu ge-
denkl; mit uns freuen sich aber gewiß nianche der Leser
am meisten über das Ergebniß der Dresdener Koukur-
renz, daß wir statt eines Makart nun zwei besitzem
II. 0.
Zur Wiederherstellung des Vierungsthurmes
am Ztraßburger Münster.
Der in No. 30 der Kunstchronik erschienene Aufsatz
Woltmann's veranlaßt mich zu einer kleinen Berichtigung.
Mein verehrter Kollege hat meinen Vorschlag zu Gunsten
der sogenannten Bischofsmütze des 14. Jahrhunderts so
aufgefaßt, als hätte ich dieselbe empfohlen, weil ich sie
„mit Adler für ein Werk Erwin's vou Steinbach halte."
Dies ist ein Jrrthum. Jch sage in meinem Aufsatz
(Allg. Ztg. Beilage Nr. 104) wörtlich: „Der Straß-
burger Meister des 14. Jahrhunderts, war es Erwin
selbst oder ein anderer, bewährte sein hohes Geschick
für Komposition dadurch, daß er auf das achtfache Dach
der Vierung jene schlanke Spitze setzte, die durch das
Bild der Madouna im Sinne jener Zeit eine ebenso
poetische wie künstlerische Krönung erhielt. So ergab
sich eine Silhouette für den ganzen Bau, welche, wie
man leicht aus Merian sich überzeugen kann, auch in
die Ferne bedeutend genug wirkte, ohne doch diese Partie
zu sehr zu betonen, zugleich in überaus schöner rhyth-
mischer Wechselbeziehung mit dem Thurmbau der Fayade."
Meine Empfehlung dieser Lösung geht also, ganz
abgesehen von der sehr zweifelhaften Urheberschaft Erwin's,
aus rein künstlerischen Erwägungen hervor. Ich muß
wiederholeu, daß ich die Auffassung, als habe zwischen
den acht Giebeldächern sich ein hoher Thurmhelm er-
heben sollen oder wirklich erhoben, nicht zu theilen ver-
mag. Jm 15. Jahrhundert wäre solch' übertreibendes
Hervorheben dieser Partie denkbar; von einem bedeu-
tendcn Meister des 14. Jahrhunderts schwerlich. Die
Tendenz der Gothik jener Epoche war, wie ich in meinein
Aufsatze dargelegt, die schwereu Kuppelthürme auf der
Vierung zu beseitigen, „wie sie auch im Jnnern dem
Gewölbe dicses Theiles nicht mehr, nach dem Vorgang
der romanischen Zeit, eine dominirende und exklusive
Gestalt gab, soudern es als integrirenden Theil der ge-
sammten Gewölbanlage des Mittelschiffes ausbildete."
Aus diesem Grunde hat meines Erachtens der Straß-
burgcr Mcister in der sogenannten Bischofsmütze eine
Form für die Vierungskuppel gesucht und gefunden, wie
sie seiner Zeit entsprach und zugleich für den eben durch
den Äunstgeist jener Epoche vollständig umgestalteten
Langhausbau nicht geistvoller und passender gedacht
werden konnte. Um meinen Vorschlag zur Herstellung
einer ähnlichen Bekrönung weiter zu begründen, habe
ich noch auf die gothischen Formen des Querschiffes,
auf die Rosenfenster und die Fialen der Strebepfeiler
hingewiescn.
Will man aber einer romanischen Behandlung den
Vorzug geben, so komme ich auf den andern Theil
meines Vorschlags zurück: dem achtseitigen Zeltdach eine
bedeutendere Auszeichnung und steilere Erhebung zu
Zur Wiederherstellunff des Vierungsthurmes am Straßburger Münster.
58<
möchten wir eine scheinbare Aehnlichkeit mit Makart
nur als eine äußerliche zugestehen, die vielleicht auch in
einigen Punkten in verwandten Bestrebungen beider
Künstler liegt. Keller verdankt seiner reichen Phantasie,
seiner Vielseitigkeit und seiner Virtuosität manchen Er-
folg; er besticht durch Farbeupracht, Geschmack im Ar-
rangement und Gesammtharmonie seiner Werke jedes
Auge; was ihn über den bloßen Virtuosen erhebt, ist
sein unverkennbares Strcben nach korrekter Zeichnung
und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nach richtiger Kon-
struktion der Figuren, dann, nach Vertiefung in den
gewählteu Stofs; soviel sei zu seinem Lobe gesagt.
Seinen Hang zum Reichthum der Komposition, die
starken Farbengegensätze und die Gewohnheit, im Großen
zu arbeiten, theilt er mit Makart; auch ist er wie dieser
nicht bloßer Staffeleimaler, sonderu betrachtet die Ma-
lerei als die Kunst, welche im Verein mit der Archi-
tektur uud Skulptur einen gegebenen Raum zu schmücken
hat und ohne diesen sinnlos ist; insofern ist nur der
beliebte Ausdruck „des dekorativen Talentes" im guten
Sinne des Wortes berechtigt. Worin aber beide Meister
geradezu einander entgegengesetzt sind, was das eigentliche
Charakteristikum ihrer Malereien bildet, das ist das
Zusammenhalten einer großen Lichtmasse, welche das
ganze Bild beherrscht, bei Keller, und die vorherrschende
Dunkelheit, die nur mit kleinen Lichtflecken gespickt ist,
bei Makart. Beide malen sozusagen von derselben Pa-
lette, aber ciu Jeder malt anders.
Ferdinand Keller ist seit einigen Jahren der Kunst-
schule seiner Vaterstadt als eine tüchtige Kraft gewonnen
und ihm die Professur sür Anatomie und Figuren-
zeichnen übertragen worden. Sem Atelier ist unstreitig
eines der interessantesten, welche man dort besuchen kann;
stels wird man in diesen Räumen sich lebhaft angcregt
fühlen durch die Betrachtung neuer Schöpfungen und
den Verkehr mit ihrem Meister; sollten aber zufällig
die Staffeleicn leer dastehen, so wird man durch das
Besichtigen interessanter Studien oder selbst der reichen,
an den brasilianischen Urwald erinnernden Trophäen,
dem Schmuck der Atclierwände, die Ueberzeugung ge-
winneu, nicht ganz umsonst gckommen zu sein.
Wir trafen unsern Meister jüngst beschäftigt an
einer großen brasilianischen Landschaft, „Humboldt am
Orinocco", und saheu ein prächtiges, lebensgroßes Bild
einer Frau in ganzer Figur, umgeben von reichcm
Blnmenkranz, welches in Dresden zur Ausstellung kommcn
soll; wir freuten uns, aus des Meisters Munde zu
veruehmen, daß er uns demnächst durch einige neue
Kompofitionen von Märchenbildern zu überrascheu ge-
denkl; mit uns freuen sich aber gewiß nianche der Leser
am meisten über das Ergebniß der Dresdener Koukur-
renz, daß wir statt eines Makart nun zwei besitzem
II. 0.
Zur Wiederherstellung des Vierungsthurmes
am Ztraßburger Münster.
Der in No. 30 der Kunstchronik erschienene Aufsatz
Woltmann's veranlaßt mich zu einer kleinen Berichtigung.
Mein verehrter Kollege hat meinen Vorschlag zu Gunsten
der sogenannten Bischofsmütze des 14. Jahrhunderts so
aufgefaßt, als hätte ich dieselbe empfohlen, weil ich sie
„mit Adler für ein Werk Erwin's vou Steinbach halte."
Dies ist ein Jrrthum. Jch sage in meinem Aufsatz
(Allg. Ztg. Beilage Nr. 104) wörtlich: „Der Straß-
burger Meister des 14. Jahrhunderts, war es Erwin
selbst oder ein anderer, bewährte sein hohes Geschick
für Komposition dadurch, daß er auf das achtfache Dach
der Vierung jene schlanke Spitze setzte, die durch das
Bild der Madouna im Sinne jener Zeit eine ebenso
poetische wie künstlerische Krönung erhielt. So ergab
sich eine Silhouette für den ganzen Bau, welche, wie
man leicht aus Merian sich überzeugen kann, auch in
die Ferne bedeutend genug wirkte, ohne doch diese Partie
zu sehr zu betonen, zugleich in überaus schöner rhyth-
mischer Wechselbeziehung mit dem Thurmbau der Fayade."
Meine Empfehlung dieser Lösung geht also, ganz
abgesehen von der sehr zweifelhaften Urheberschaft Erwin's,
aus rein künstlerischen Erwägungen hervor. Ich muß
wiederholeu, daß ich die Auffassung, als habe zwischen
den acht Giebeldächern sich ein hoher Thurmhelm er-
heben sollen oder wirklich erhoben, nicht zu theilen ver-
mag. Jm 15. Jahrhundert wäre solch' übertreibendes
Hervorheben dieser Partie denkbar; von einem bedeu-
tendcn Meister des 14. Jahrhunderts schwerlich. Die
Tendenz der Gothik jener Epoche war, wie ich in meinein
Aufsatze dargelegt, die schwereu Kuppelthürme auf der
Vierung zu beseitigen, „wie sie auch im Jnnern dem
Gewölbe dicses Theiles nicht mehr, nach dem Vorgang
der romanischen Zeit, eine dominirende und exklusive
Gestalt gab, soudern es als integrirenden Theil der ge-
sammten Gewölbanlage des Mittelschiffes ausbildete."
Aus diesem Grunde hat meines Erachtens der Straß-
burgcr Mcister in der sogenannten Bischofsmütze eine
Form für die Vierungskuppel gesucht und gefunden, wie
sie seiner Zeit entsprach und zugleich für den eben durch
den Äunstgeist jener Epoche vollständig umgestalteten
Langhausbau nicht geistvoller und passender gedacht
werden konnte. Um meinen Vorschlag zur Herstellung
einer ähnlichen Bekrönung weiter zu begründen, habe
ich noch auf die gothischen Formen des Querschiffes,
auf die Rosenfenster und die Fialen der Strebepfeiler
hingewiescn.
Will man aber einer romanischen Behandlung den
Vorzug geben, so komme ich auf den andern Theil
meines Vorschlags zurück: dem achtseitigen Zeltdach eine
bedeutendere Auszeichnung und steilere Erhebung zu