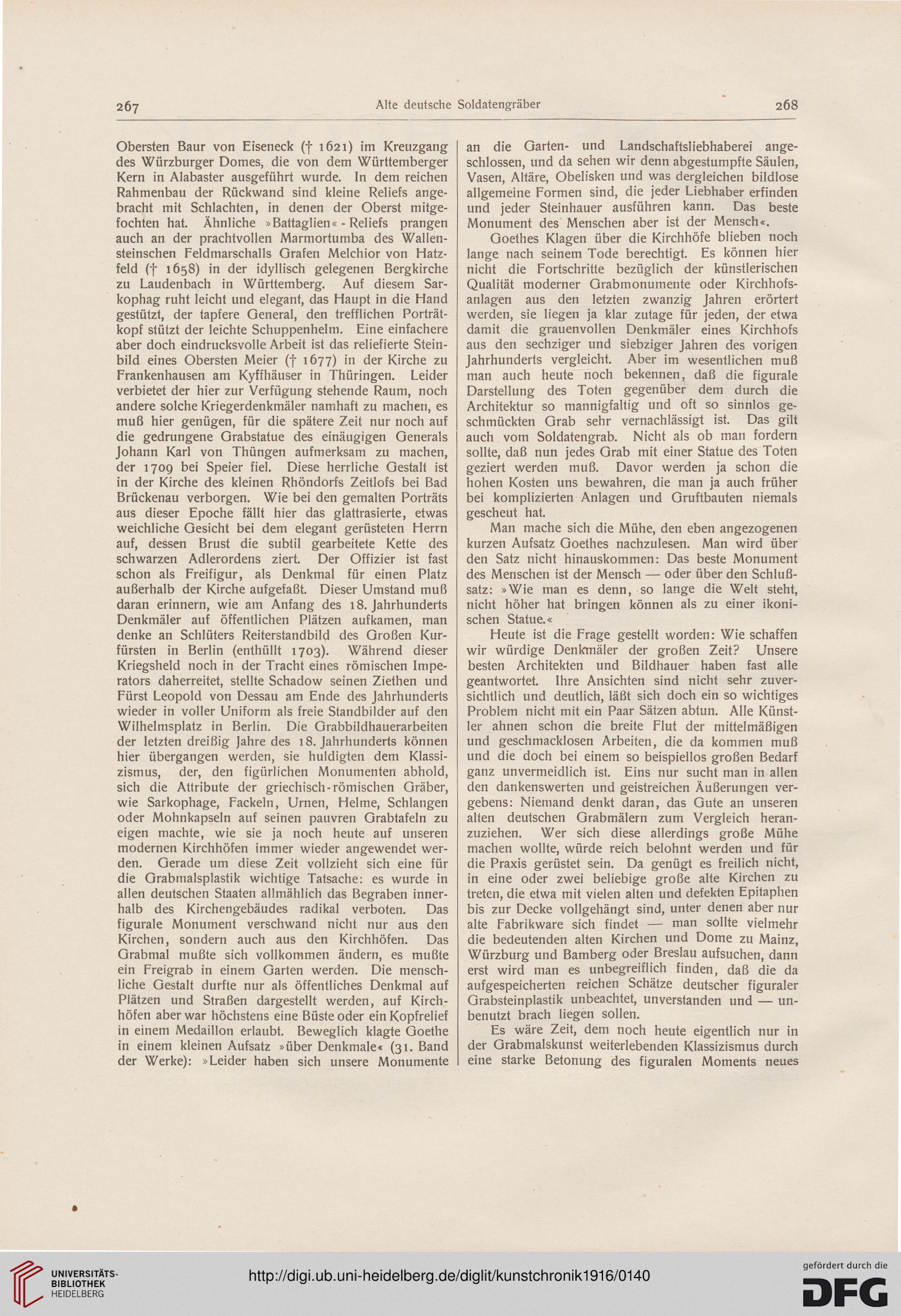267
Alte deutsche Soldatengräber
268
Obersten Baur von Eiseneck (f 1621) im Kreuzgang
des Würzburger Domes, die von dem Württemberger
Kern in Alabaster ausgeführt wurde. In dem reichen
Rahmenbau der Rückwand sind kleine Reliefs ange-
bracht mit Schlachten, in denen der Oberst mitge-
fochten hat. Ähnliche »Battaglien« - Reliefs prangen
auch an der prachtvollen Marmortumba des Wallen-
steinschen Feldmarschalls Grafen Melchior von Hatz-
feld (f 1658) in der idyllisch gelegenen Bergkirche
zu Laudenbach in Württemberg. Auf diesem Sar-
kophag ruht leicht und elegant, das Haupt in die Hand
gestützt, der tapfere General, den trefflichen Porträt-
kopf stützt der leichte Schuppenhelm. Eine einfachere
aber doch eindrucksvolle Arbeit ist das reliefierte Stein-
bild eines Obersten Meier (f 1677) in der Kirche zu
Frankenhausen am Kyffhäuser in Thüringen. Leider
verbietet der hier zur Verfügung stehende Raum, noch
andere solche Kriegerdenkmäler namhaft zu machen, es
muß hier genügen, für die spätere Zeit nur noch auf
die gedrungene Grabstatue des einäugigen Generals
Johann Karl von Thüngen aufmerksam zu machen,
der 1709 bei Speier fiel. Diese herrliche Gestalt ist
in der Kirche des kleinen Rhöndorfs Zeitlofs bei Bad
Brückenau verborgen. Wie bei den gemalten Porträts
aus dieser Epoche fällt hier das glattrasierte, etwas
weichliche Gesicht bei dem elegant gerüsteten Herrn
auf, dessen Brust die subtil gearbeitete Kette des
schwarzen Adlerordens ziert. Der Offizier ist fast
schon als Freifigur, als Denkmal für einen Platz
außerhalb der Kirche aufgefaßt. Dieser Umstand muß
daran erinnern, wie am Anfang des 18. Jahrhunderts
Denkmäler auf öffentlichen Plätzen aufkamen, man
denke an Schlüters Reiterstandbild des Großen Kur-
fürsten in Berlin (enthüllt 1703). Während dieser
Kriegsheld noch in der Tracht eines römischen Impe-
rators daherreitet, stellte Schadow seinen Ziethen und
Fürst Leopold von Dessau am Ende des Jahrhunderts
wieder in voller Uniform als freie Standbilder auf den
Wilhelmsplatz in Berlin. Die Grabbildhauerarbeiten
der letzten dreißig Jahre des 18. Jahrhunderts können
hier übergangen werden, sie huldigten dem Klassi-
zismus, der, den figürlichen Monumenten abhold,
sich die Attribute der griechisch-römischen Gräber,
wie Sarkophage, Fackeln, Urnen, Helme, Schlangen
oder Mohnkapseln auf seinen pauvren Grabtafeln zu
eigen machte, wie sie ja noch heute auf unseren
modernen Kirchhöfen immer wieder angewendet wer-
den. Gerade um diese Zeit vollzieht sich eine für
die Grabmalsplastik wichtige Tatsache: es wurde in
allen deutschen Staaten allmählich das Begraben inner-
halb des Kirchengebäudes radikal verboten. Das
figurale Monument verschwand nicht nur aus den
Kirchen, sondern auch aus den Kirchhöfen. Das
Grabmal mußte sich vollkommen ändern, es mußte
ein Freigrab in einem Garten werden. Die mensch-
liche Gestalt durfte nur als öffentliches Denkmal auf
Plätzen und Straßen dargestellt werden, auf Kirch-
höfen aber war höchstens eine Büste oder ein Kopfrelief
in einem Medaillon erlaubt. Beweglich klagte Goethe
in einem kleinen Aufsatz »über Denkmale« (31. Band
der Werke): »Leider haben sich unsere Monumente
an die Garten- und Landschaftsliebhaberei ange-
schlossen, und da sehen wir denn abgestumpfte Säulen,
Vasen, Altäre, Obelisken und was dergleichen bildlose
allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden
und jeder Steinhauer ausführen kann. Das beste
Monument des Menschen aber ist der Mensch«.
Goethes Klagen über die Kirchhöfe blieben noch
lange nach seinem Tode berechtigt. Es können hier
nicht die Fortschritte bezüglich der künstlerischen
Qualität moderner Grabmonumente oder Kirchhofs-
anlagen aus den letzten zwanzig Jahren erörtert
werden, sie liegen ja klar zutage für jeden, der etwa
damit die grauenvollen Denkmäler eines Kirchhofs
aus den sechziger und siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts vergleicht. Aber im wesentlichen muß
man auch heute noch bekennen, daß die figurale
Darstellung des Toten gegenüber dem durch die
Architektur so mannigfaltig und oft so sinnlos ge-
schmückten Grab sehr vernachlässigt ist. Das gilt
auch vom Soldatengrab. Nicht als ob man fordern
sollte, daß nun jedes Grab mit einer Statue des Toten
geziert werden muß. Davor werden ja schon die
hohen Kosten uns bewahren, die man ja auch früher
bei komplizierten Anlagen und Gruftbauten niemals
gescheut hat.
Man mache sich die Mühe, den eben angezogenen
kurzen Aufsatz Goethes nachzulesen. Man wird über
den Satz nicht hinauskommen: Das beste Monument
des Menschen ist der Mensch — oder über den Schluß-
satz: »Wie man es denn, so lange die Welt steht,
nicht höher hat bringen können als zu einer ikoni-
schen Statue.«
Heute ist die Frage gestellt worden: Wie schaffen
wir würdige Denkmäler der großen Zeit? Unsere
besten Architekten und Bildhauer haben fast alle
geantwortet. Ihre Ansichten sind nicht sehr zuver-
sichtlich und deutlich, läßt sich doch ein so wichtiges
Problem nicht mit ein Paar Sätzen abtun. Alle Künst-
ler ahnen schon die breite Flut der mittelmäßigen
und geschmacklosen Arbeiten, die da kommen muß
und die doch bei einem so beispiellos großen Bedarf
ganz unvermeidlich ist. Eins nur sucht man in allen
den dankenswerten und geistreichen Äußerungen ver-
gebens: Niemand denkt daran, das Gute an unseren
alten deutschen Grabmälern zum Vergleich heran-
zuziehen. Wer sich diese allerdings große Mühe
machen wollte, würde reich belohnt werden und für
die Praxis gerüstet sein. Da genügt es freilich nicht,
in eine oder zwei beliebige große alte Kirchen zu
treten, die etwa mit vielen alten und defekten Epitaphen
bis zur Decke vollgehängt sind, unter denen aber nur
alte Fabrikware sich findet — man sollte vielmehr
die bedeutenden alten Kirchen und Dome zu Mainz,
Würzburg und Bamberg oder Breslau aufsuchen, dann
erst wird man es unbegreiflich finden, daß die da
aufgespeicherten reichen Schätze deutscher figuraler
Grabsteinplastik unbeachtet, unverstanden und — un-
benutzt brach liegen sollen.
Es wäre Zeit, dem noch heute eigentlich nur in
der Grabmalskunst weiterlebenden Klassizismus durch
eine starke Betonung des figuralen Moments neues
Alte deutsche Soldatengräber
268
Obersten Baur von Eiseneck (f 1621) im Kreuzgang
des Würzburger Domes, die von dem Württemberger
Kern in Alabaster ausgeführt wurde. In dem reichen
Rahmenbau der Rückwand sind kleine Reliefs ange-
bracht mit Schlachten, in denen der Oberst mitge-
fochten hat. Ähnliche »Battaglien« - Reliefs prangen
auch an der prachtvollen Marmortumba des Wallen-
steinschen Feldmarschalls Grafen Melchior von Hatz-
feld (f 1658) in der idyllisch gelegenen Bergkirche
zu Laudenbach in Württemberg. Auf diesem Sar-
kophag ruht leicht und elegant, das Haupt in die Hand
gestützt, der tapfere General, den trefflichen Porträt-
kopf stützt der leichte Schuppenhelm. Eine einfachere
aber doch eindrucksvolle Arbeit ist das reliefierte Stein-
bild eines Obersten Meier (f 1677) in der Kirche zu
Frankenhausen am Kyffhäuser in Thüringen. Leider
verbietet der hier zur Verfügung stehende Raum, noch
andere solche Kriegerdenkmäler namhaft zu machen, es
muß hier genügen, für die spätere Zeit nur noch auf
die gedrungene Grabstatue des einäugigen Generals
Johann Karl von Thüngen aufmerksam zu machen,
der 1709 bei Speier fiel. Diese herrliche Gestalt ist
in der Kirche des kleinen Rhöndorfs Zeitlofs bei Bad
Brückenau verborgen. Wie bei den gemalten Porträts
aus dieser Epoche fällt hier das glattrasierte, etwas
weichliche Gesicht bei dem elegant gerüsteten Herrn
auf, dessen Brust die subtil gearbeitete Kette des
schwarzen Adlerordens ziert. Der Offizier ist fast
schon als Freifigur, als Denkmal für einen Platz
außerhalb der Kirche aufgefaßt. Dieser Umstand muß
daran erinnern, wie am Anfang des 18. Jahrhunderts
Denkmäler auf öffentlichen Plätzen aufkamen, man
denke an Schlüters Reiterstandbild des Großen Kur-
fürsten in Berlin (enthüllt 1703). Während dieser
Kriegsheld noch in der Tracht eines römischen Impe-
rators daherreitet, stellte Schadow seinen Ziethen und
Fürst Leopold von Dessau am Ende des Jahrhunderts
wieder in voller Uniform als freie Standbilder auf den
Wilhelmsplatz in Berlin. Die Grabbildhauerarbeiten
der letzten dreißig Jahre des 18. Jahrhunderts können
hier übergangen werden, sie huldigten dem Klassi-
zismus, der, den figürlichen Monumenten abhold,
sich die Attribute der griechisch-römischen Gräber,
wie Sarkophage, Fackeln, Urnen, Helme, Schlangen
oder Mohnkapseln auf seinen pauvren Grabtafeln zu
eigen machte, wie sie ja noch heute auf unseren
modernen Kirchhöfen immer wieder angewendet wer-
den. Gerade um diese Zeit vollzieht sich eine für
die Grabmalsplastik wichtige Tatsache: es wurde in
allen deutschen Staaten allmählich das Begraben inner-
halb des Kirchengebäudes radikal verboten. Das
figurale Monument verschwand nicht nur aus den
Kirchen, sondern auch aus den Kirchhöfen. Das
Grabmal mußte sich vollkommen ändern, es mußte
ein Freigrab in einem Garten werden. Die mensch-
liche Gestalt durfte nur als öffentliches Denkmal auf
Plätzen und Straßen dargestellt werden, auf Kirch-
höfen aber war höchstens eine Büste oder ein Kopfrelief
in einem Medaillon erlaubt. Beweglich klagte Goethe
in einem kleinen Aufsatz »über Denkmale« (31. Band
der Werke): »Leider haben sich unsere Monumente
an die Garten- und Landschaftsliebhaberei ange-
schlossen, und da sehen wir denn abgestumpfte Säulen,
Vasen, Altäre, Obelisken und was dergleichen bildlose
allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden
und jeder Steinhauer ausführen kann. Das beste
Monument des Menschen aber ist der Mensch«.
Goethes Klagen über die Kirchhöfe blieben noch
lange nach seinem Tode berechtigt. Es können hier
nicht die Fortschritte bezüglich der künstlerischen
Qualität moderner Grabmonumente oder Kirchhofs-
anlagen aus den letzten zwanzig Jahren erörtert
werden, sie liegen ja klar zutage für jeden, der etwa
damit die grauenvollen Denkmäler eines Kirchhofs
aus den sechziger und siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts vergleicht. Aber im wesentlichen muß
man auch heute noch bekennen, daß die figurale
Darstellung des Toten gegenüber dem durch die
Architektur so mannigfaltig und oft so sinnlos ge-
schmückten Grab sehr vernachlässigt ist. Das gilt
auch vom Soldatengrab. Nicht als ob man fordern
sollte, daß nun jedes Grab mit einer Statue des Toten
geziert werden muß. Davor werden ja schon die
hohen Kosten uns bewahren, die man ja auch früher
bei komplizierten Anlagen und Gruftbauten niemals
gescheut hat.
Man mache sich die Mühe, den eben angezogenen
kurzen Aufsatz Goethes nachzulesen. Man wird über
den Satz nicht hinauskommen: Das beste Monument
des Menschen ist der Mensch — oder über den Schluß-
satz: »Wie man es denn, so lange die Welt steht,
nicht höher hat bringen können als zu einer ikoni-
schen Statue.«
Heute ist die Frage gestellt worden: Wie schaffen
wir würdige Denkmäler der großen Zeit? Unsere
besten Architekten und Bildhauer haben fast alle
geantwortet. Ihre Ansichten sind nicht sehr zuver-
sichtlich und deutlich, läßt sich doch ein so wichtiges
Problem nicht mit ein Paar Sätzen abtun. Alle Künst-
ler ahnen schon die breite Flut der mittelmäßigen
und geschmacklosen Arbeiten, die da kommen muß
und die doch bei einem so beispiellos großen Bedarf
ganz unvermeidlich ist. Eins nur sucht man in allen
den dankenswerten und geistreichen Äußerungen ver-
gebens: Niemand denkt daran, das Gute an unseren
alten deutschen Grabmälern zum Vergleich heran-
zuziehen. Wer sich diese allerdings große Mühe
machen wollte, würde reich belohnt werden und für
die Praxis gerüstet sein. Da genügt es freilich nicht,
in eine oder zwei beliebige große alte Kirchen zu
treten, die etwa mit vielen alten und defekten Epitaphen
bis zur Decke vollgehängt sind, unter denen aber nur
alte Fabrikware sich findet — man sollte vielmehr
die bedeutenden alten Kirchen und Dome zu Mainz,
Würzburg und Bamberg oder Breslau aufsuchen, dann
erst wird man es unbegreiflich finden, daß die da
aufgespeicherten reichen Schätze deutscher figuraler
Grabsteinplastik unbeachtet, unverstanden und — un-
benutzt brach liegen sollen.
Es wäre Zeit, dem noch heute eigentlich nur in
der Grabmalskunst weiterlebenden Klassizismus durch
eine starke Betonung des figuralen Moments neues